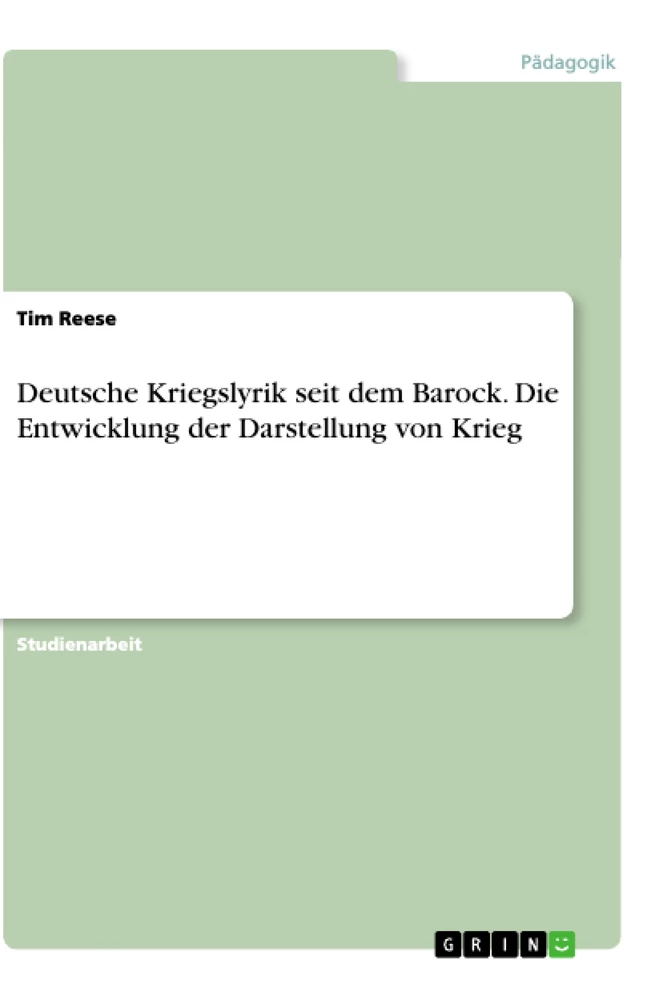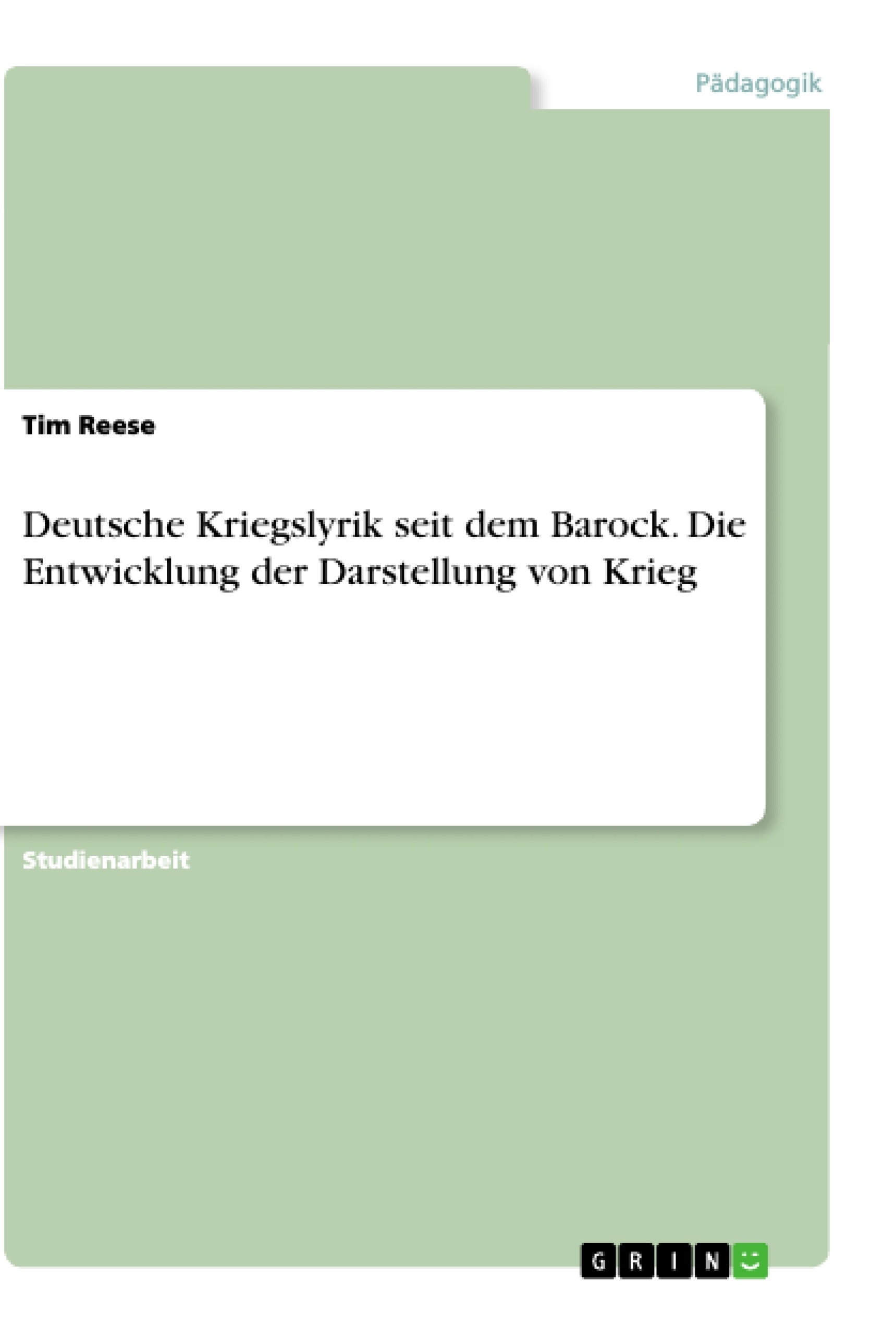Diese Arbeit thematisiert das Thema Kriegslyrik. Vom 30-jährigen Krieg ausgehend, umfasst die Arbeit die wesentlichen deutschen Literaturepochen vom Barock bis 1945. Schwerpunkte werden im Barock ("Tränen des Vaterlandes"), zur Zeit der Befreiungskriege (E.M. Arndt), im Expressionismus (1. Weltkrieg, "Grodek") und abschließend mit "Hiroshima" gesetzt.
Insgesamt besteht das Ziel darin, anhand ausgewählter Gedichte zu zeigen, wie sich das Bild des Krieges innerhalb der Lyrik vom Barock bis hin zum Abwurf der Atombombe entwickelt hat. An geeigneten Passagen werden Querverweise zu anderen Epochen gezogen und dies mit Gedichten unterlegt, ohne allerdings eine genaue Interpretation anzulegen. Es wird mehr Wert auf den Zusammenhang der Gedichte und die politisch motivierte Aussagekraft der Zeit gelegt, als auf die Beschreibung der genauen Details jedes einzelnen Gedichtes; dennoch soll eine genaue Gedichtanalyse zumindest bei den ausgewählten Schwerpunktgedichten den Gehalt des Gedichtes untermauern.
In der Lyrik des Barocks war das oberste Gebot, wie auch für die Literatur insgesamt, die Wahrung der Tugend und der Ordnung. Lyrik diente der Huldigung der Obersten. Im Zeitalter des Absolutismus galt der König oder der jeweilige Herrscher als unantastbar und so musste die Lyrik vor allem ihm gefallen. Denn durch diese Lobgedichte für die Obrigkeit wird den Untertanen ebenso eine Verhaltenslehre aufgestellt – diese Darstellungsweise war gewollt und wurde so auch häufig praktiziert. Allerdings gab es im Barock auch politisch motivierte Lyrik, die sich gegen den Kaiser oder gegen die Herrschenden allgemein richtete. Diese Verse waren aber zumeist anonyme Flugblätter, die die übrige Bevölkerung über Missstände im Reich aufklären oder für eine politische Richtung gewinnen wollten und dadurch das wichtigste, politische Ausdrucksmittel darstellten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der lyrische Umgang mit dem Thema Krieg in den Epochen
- II.1 Das Barock
- II.1.1 Das Barock als Epoche
- II.1.2 Lyrik im Barock
- II.1.3 Der historische Kontext
- II.1.4 Andreas Gryphius
- II.1.5 Das Sonett und der Alexandriner als Gedichtart und Versform des Barocks
- II.1.6 Tränen des Vaterlandes / Anno 1636
- II.1.6.1 Zur Entstehungsgeschichte
- II.1.6.2 Die Sprache des Andreas Gryphius
- II.1.6.3 Vergleich der Fassungen von 1636 und 1663
- II.1.6.3 Interpretation des Gedichtes
- II.1.6.4 Einordnung des Gedichts
- II.2 Aufklärung
- II.2.1 Die Aufklärung als Epoche
- II.2.2 Lyrik der Aufklärung
- II.3 Vom Sturm und Drang bis zur Romantik
- II.3.1 Der Sturm und Drang und die Romantik als Epoche
- II.3.2 Lyrik des Sturm und Drang und der Romantik
- II.4 Lyrik zur Zeit der Befreiungskriege
- II.4.1 Historischer Kontext
- II.4.2 Ernst Moritz Arndt
- II.4.3 Das Vaterlandslied 1812
- II.4.3.1 Interpretation des Gedichtes
- II.4.3.2 Einordnung des Gedichtes
- II.5 Vom Biedermeier bis zum Realismus
- II.5.1 Die Epochen und Strömungen
- II.5.2 Der historische Kontext
- II.5.3 Das Biedermeier
- II.5.4 Junges Deutschland
- II.5.5 Vormärz
- II.5.6 Der Realismus bzw. die Lyrik des Nachmärz bis zur Reichsgründung
- II.6 Vom Naturalismus zum Expressionismus
- II.6.1 Der Naturalismus als Epoche
- II.6.2 Lyrik des Naturalismus - Lyrik im Kaiserreich
- II.6.3 Der Übergang zum Expressionismus und die Lyrik des Ersten Weltkriegs
- II.6.4 Expressionismus
- II.6.5 Georg Trakl – Ein expressionistischer Dichter und Opfer des Ersten Weltkrieges
- II.6.6 Grodek
- II.6.6.1 Entstehungsgeschichte
- II.6.6.2 Über die Sprache und die Chiffre Trakls
- II.6.6.3 Interpretation des Gedichtes
- II.6.6.4 Einordnung des Gedichts
- II.7 Von der Weimarer Republik über die Neue Sachlichkeit bis 1933
- II.8 Drittes Reich – Lyrik im gleichgeschalteten Deutschland
- II.9 Der Abwurf der Atombombe 1945 – Eine neue Zeitrechnung der Kriegsführung
- II.9.1 Die Literatur und Lyrik nach 1945
- II.9.2 Der historische Kontext
- II.9.3 Marie-Luise Kaschnitz – Eine Zeitgenossin
- II.9.4 Hiroshima
- II.9.4.1 Interpretation des Gedichtes
- II.9.4.2 Einordnung des Gedichtes
- III. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Entwicklung des lyrischen Umgangs mit dem Thema Krieg in der deutschen Literatur vom Barock bis zur Zeit nach dem Abwurf der Atombombe 1945 zu untersuchen. Sie beleuchtet dabei die spezifischen Merkmale und Veränderungen der Kriegslyrik innerhalb der verschiedenen Epochen, indem sie exemplarische Gedichte analysiert und in ihren historischen Kontext einordnet.
- Die vielschichtigen Formen des lyrischen Ausdrucks von Kriegserfahrungen und -folgen
- Der Wandel des Kriegserlebens und -verständnisses im Laufe der Jahrhunderte
- Die Beziehung zwischen politischer Entwicklung und literarischer Gestaltung des Kriegsthemas
- Die Rolle der Lyrik als Medium der Kritik, des Protests und der Reflexion über Krieg und Gewalt
- Die Verwendung von Sprache und Stilmitteln zur Darstellung von Krieg und Leid
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet eine umfassende Einführung in das Thema und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie stellt die zentralen Fragestellungen und den methodischen Ansatz dar. Zudem werden die Schwerpunkte der Analyse, insbesondere die exemplarischen Gedichte von Andreas Gryphius, Ernst Moritz Arndt, Georg Trakl und Marie Luise Kaschnitz, vorgestellt.
Das zweite Kapitel ist der systematischen Analyse der Kriegslyrik in den verschiedenen literarischen Epochen gewidmet. Es beleuchtet die Entwicklung des Themas und die spezifischen Merkmale der Kriegslyrik in jeder Epoche, beginnend mit dem Barock und der Analyse von Andreas Gryphius' Gedicht "Tränen des Vaterlandes, Anno 1636".
Die weiteren Abschnitte des zweiten Kapitels befassen sich mit der Aufklärung, dem Sturm und Drang, der Romantik, der Lyrik zur Zeit der Befreiungskriege und der Epoche des Biedermeier bis zum Realismus. Sie analysieren wichtige Gedichte aus diesen Epochen und verdeutlichen die spezifischen Herausforderungen und Merkmale der Kriegslyrik in jeder Zeit.
Das zweite Kapitel schließt mit einer umfassenden Betrachtung des Naturalismus, des Expressionismus und des Ersten Weltkriegs. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Georg Trakls Gedicht "Grodek".
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Kriegslyrik in der deutschen Literatur, untersucht die Entwicklung des Themas in verschiedenen Epochen und analysiert exemplarische Gedichte von Andreas Gryphius, Ernst Moritz Arndt, Georg Trakl und Marie Luise Kaschnitz. Zentrale Begriffe sind dabei Kriegserfahrung, Kriegslyrik, Gedichtanalyse, historische Kontextualisierung, Epochenvergleich, Sprachstil, Symbolismus, Kriegsrealität, Kriegsfolgen und Kriegsdeutung.
- Quote paper
- Tim Reese (Author), 2007, Deutsche Kriegslyrik seit dem Barock. Die Entwicklung der Darstellung von Krieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/948045