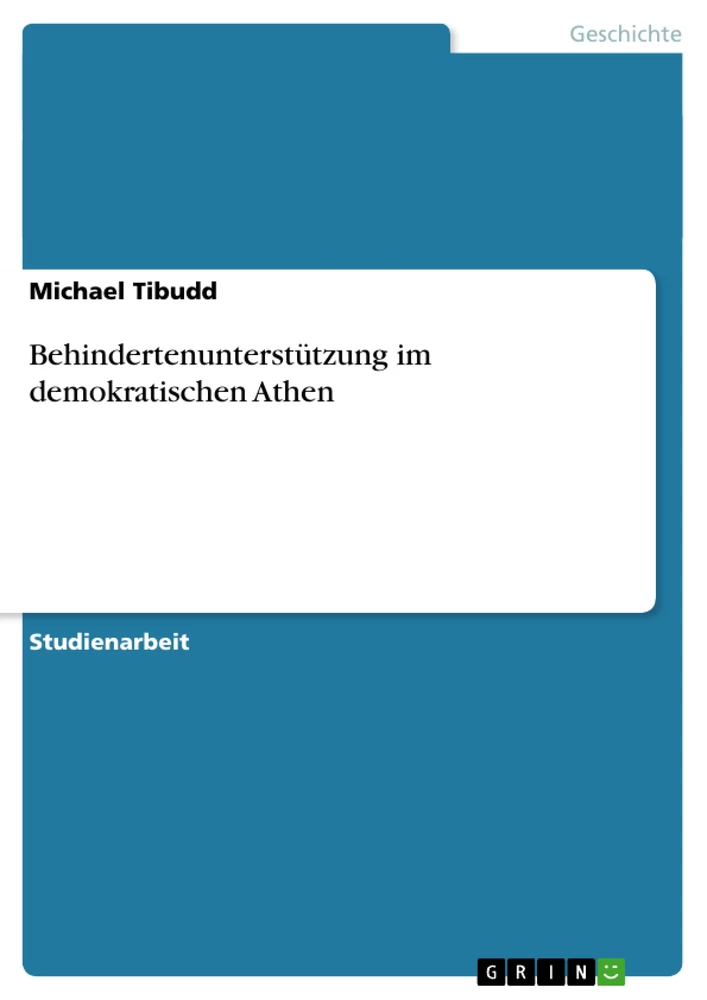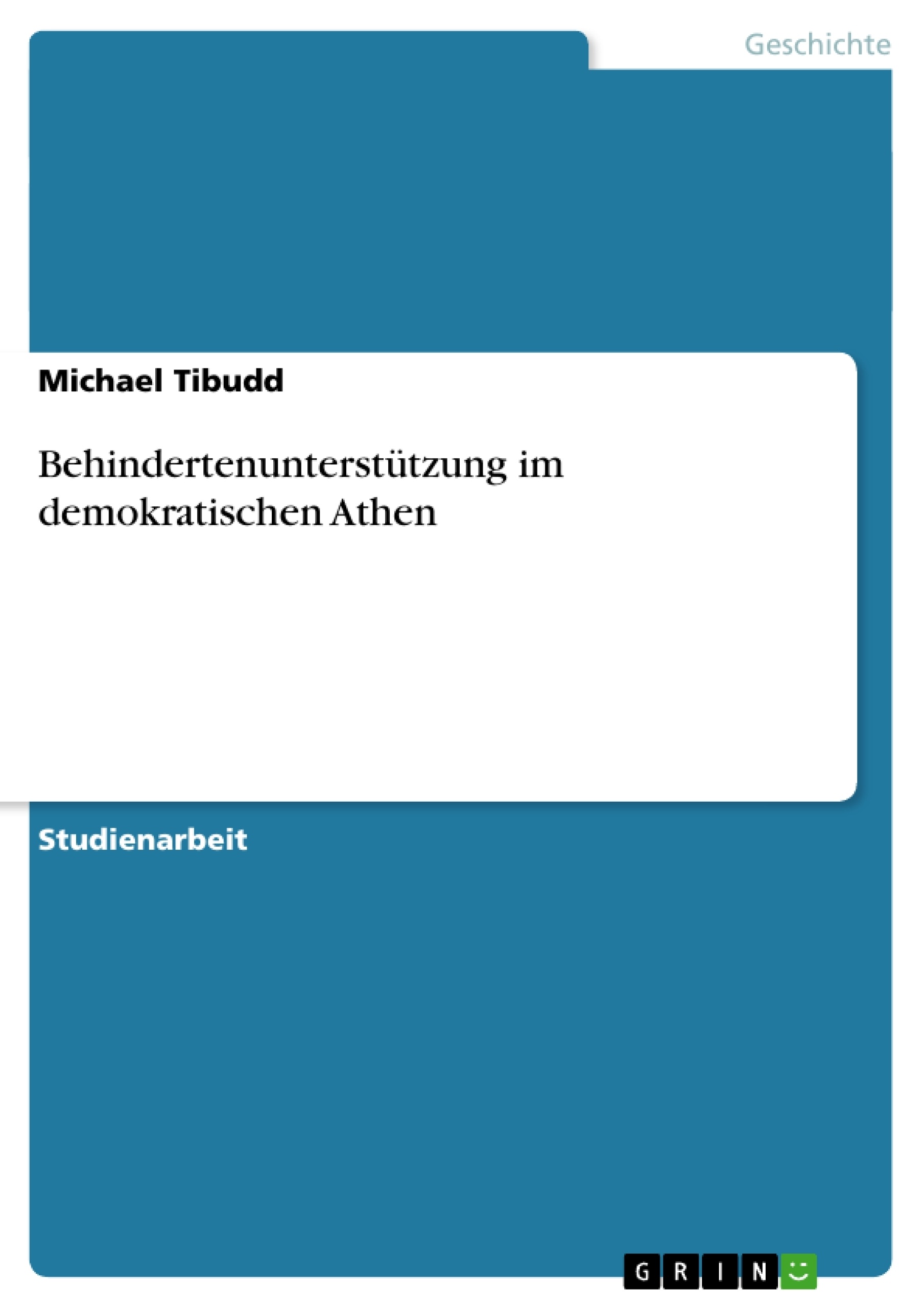Inhalt
EINLEITUNG
DER UMGANG MIT BEHINDERTEN
Die Entwicklung zur allgemeinen Lebenshilfe
Vordemokratische Zeit
Perikleische Demokratie
Erschließung der alltäglichen Praxis aus der Überlieferung
Athenaion Politeia
Die Lysias - Rede
Der Kontrast: Isolation aufgrund geistiger Behinderung
DISKUSSION DER URSACHEN FÜR DIE SITUATION IN ATHEN
Die Demokratie und deren Entstehung als solche
Soziale Gerechtigkeit?
ABSCHLIEßENDE BEMERKUNGEN UND AUSBLICK
ANHANG
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
Im Verständnis eines althistorisch wenig vorgebildeten Menschen dürfte der Gedanke an staatliche Sozialfürsorge im Altertum wenig Bedeutung finden, glaubt man doch fest daran, derartige Notwendigkeiten erst an den Folgen der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts und damit der Sozialen Frage erkannt zu haben. Jedoch stößt man bei besserer Kenntnis der Zeit auf Aspekte, die ein genaues Differenzieren notwendig machen und die ein erstaunliches Stück Sozialgeschichte aufzeigen. Zwar kann man das fünfte und vierte Jahrhundert vor Christus, in dem es besagte Wohltätigkeit gegeben hat, nicht als die Wiege der Menschlichkeit bezeichnen, dazu ist die Einzigartigkeit - nur das demokratische Athen kannte dieses Vorgehen - zu groß. Dennoch bleibt Erstaunen und Verwunderung über das humane Antlitz, das die Zeit aufgrund der abzuhandelnden Praxis trägt.
Man kann natürlich nicht die Kehrseite der Medaille verschweigen. Zu dieser kommt man schnell, wenn man die Quellensituation zu diesem gesamten Themenkomplex betrachtet. Außer einer Passage in Aristoteles` Athenaion Politeia1 und einer Rede von Lysias2, die für einen Behinderten geschrieben ist, der sich und seinen Status als Empfänger von Unterstützung vor den Institutionen Athens verteidigen muss, findet sich keine Grundlage zu weiteren Aussagen. Dagegen erfährt man von anderer Seite3, dass sich die Großzügigkeit nur auf einen Teil der Behinderungen bezog. So wurde nur die körperliche Versehrtheit, von der ja auch Aristoteles ausschließlich spricht, als unterstützungswürdiger Fall betrachtet, hingegen bedeutete eine offensichtliche geistige Behinderung Isolation von der Gesellschaft und darüber hinaus auch oft offene Anfeindung. Auch lassen sich verschiedene Ansätze bei der Forschung nach Ursachen diskutieren, so dass erheblicher Klärungsbedarf gegeben ist.
Der Umgang mit Behinderten
Die Entwicklung zur allgemeinen Lebenshilfe
Vordemokratische Zeit
Mangels exakter Überlieferungen zur Frage der Behindertenunterstützung als solcher ist es schwer, ihre Anfänge zeitlich einzuordnen, da die antiken Autoren nur vereinzelt Hinweise dazu geben. Diese wenigen Hinweise lassen es jedoch zu, erste Ansätze einer Unterstützung Solon zuzuschreiben. Nach Diogenes Laertius wurde den Kämpfenden zugesichert, dass ihre ,,Söhne denn auch auf öffentliche Kosten unterhalten und erzogen" würden4. Diese Söhne waren zwar nicht selbst körperbehindert, konnten aber in der Regel aus Altersgründen ihren Lebensunterhalt noch nicht selbst verdienen.
Daraus ersichtlich wird das Pflichtbewusstsein, das die Athener gegenüber ihren Soldaten aufbrachten: der Kämpfer sollte sich keine Sorgen um seine Familie machen müssen, die Dankbarkeit der Gesellschaft und deren Sorge um seine Nachkommenschaft waren ihm gewiss.
Der nächste Schritt und die erste wirkliche Unterstützung Körperbehinderter geschah unter Peisistratos. Plutarch spricht zunächst von den vielen Gesetzen, die der Tyrann von Solon übernommen hatte und geht dann auf Ergänzungen ein. In diesem Rahmen nennt er das Gesetz, ,,welches den Kriegsgeschädigten Unterhalt auf Staatskosten zubilligt"5. Ein Krieger konnte nun demnach also auch für den Fall einer Verletzung mit öffentlicher Hilfe rechnen.
Zwar ist laut Matthew P. J. Dillon die generelle Tendenz antiker Autoren zu beachten, Solon als den Urheber möglichst vieler Gesetze zu nennen, allerdings neigt er in diesem Fall dazu, die Historizität der Regelung als gegeben zu betrachten6 und ist damit anderer Ansicht als Jacoby, der die gleichen Aussagen von Plutarch und Diogenes Laertius für unhistorisch hält7.
In beiden Fällen ist aber keine Rede von der Unterstützung weiblicher Behinderter. Dieses Aussparen hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass in der antiken Kriegführung Frauen nicht eingesetzt wurden und damit keine weiblichen Verwundeten zu beklagen waren, andererseits, bezüglich der Waisenunterstützung seit Solon, die, wenn überhaupt, nur für Söhne im Kriege gefallener geleistet wurde, mit der Tatsache, dass die Frau im öffentlichen Leben Athens insgesamt eine untergeordnete Rolle spielte und Fürsorge im familiären Rahmen geleistet wurde.8
Perikleische Demokratie
Bis jetzt war ausschließlich die Rede von Kriegsversehrten und deren Angehörigen. Für eine allgemeine Unterstützung für alle, also auch für seit Geburt oder durch Unfälle im zivilen Leben Behinderte im sechsten und frühen fünften Jahrhundert, nach den Maßstäben also, die Aristoteles beschreibt (s. S.6), gibt es keine Quellengrundlage. Somit muss man den Beginn dieser generellen Hilfe, den Aristoteles nicht erwähnt, aus der gesamtpolitischen Entwicklung Athens erschließen.
Man kann in diesem Zusammenhang die Einführung von Dikastikon und Bouleutikon unter Perikles als besonders geeignet betrachten. Schon die kleisthenischen Reformen hatten mit ihrer Einteilung Attikas in Trittyen und damit der Unterbindung von regionalen Abhängigkeitsverhältnissen ein erstes Zeichen gegen eine zu große Klientelbildung gesetzt (Dillon S. 32). Und als zur Mitte des fünften Jahrhunderts Kimon mit seinem Privatvermögen begann, Bedürftige Menschen zu unterstützen, sich damit aber nebenbei auch eine beträchtliche potentielle Klientel verschaffte, reagierte sein politischer Rivale Perikles mit der Einführung der Bezahlung der Richtertätigkeit und der Ratsherren, um die große Anzahl an Bedürftigen und damit potentiellen Klienten des Kimon zu verringern9. Es liegt nahe, dass in diesem Zusammenhang in einer Art sozialpolitischen Rundumschlags des Perikles auch die Bezahlung von Behinderten generalisiert wurde (Dillon S. 30).
Einen anderen Ansatz verfolgt hier Eberhard Ruschenbusch, der die Einführung auch der Unterstützung zivil bedingter Missbildungen als eine Folge der Heimsuchung Athens durch die Pest in den ersten Jahren des Peloponnesischen Krieges sieht (Ruschenbusch S.81). Herbert Grassl stimmt dem zu und bringt diesen Anlass wiederum in Verbindung mit dem Versuch, ,,die psychologischen Folgen des Kriegsschocks aufzufangen"10 und nennt damit als Hauptbeweggrund für die Ausweitung der Leistung auch in den zivilen Bereich hinein den Krieg.
Erschließung der alltäglichen Praxis aus der Überlieferung
Athenaion Politeia
Den genauesten Nachweis für die Regelung zur Unterstützung der behinderten Bürger in demokratischer Zeit bietet die Athenaion Politeia des Aristoteles. Die entsprechende Stelle gibt exakte Auskunft über die notwendigen Entscheidungsprozesse und Voraussetzungen, die der nach eigener Ansicht Bedürftige erfüllen muss, um in den Genuss der staatlichen Unterstützung zu kommen. Demnach fällt dieser Aspekt in den Aufgabenbereich des Rates der 500, ,,denn es gibt ein Gesetz, welches bestimmt, daß man denen, die nicht mehr als drei Minen besitzen und so schwer körperbehindert sind, daß sie keine Arbeit verrichten können, nach Überprüfung durch den Rat aus öffentlichen Mitteln jeweils zwei Obolen pro Tag für ihren Lebensunterhalt geben soll."11 Der Personenkreis, dem die Hilfe zustand, war also genau definiert, es genügte nicht die offensichtlichste Empfehlung dafür, nämlich die Körperbehinderung selbst, die man nach Aristoteles' Beschreibung des entsprechenden Gesetzes im heutigen Alltag eher als Arbeitsunfähigkeit bezeichnen würde, sondern es galt auch, einen bestimmten Zensus (drei Minen) nicht zu überschreiten. Erst bei Zusammentreffen dieser Voraussetzungen konnte der Rat der 500 dem Behinderten also die Unterstützung bewilligen. Es war also Ziel der Überprüfung, Missbrauch beim Empfang der Leistungen vorzubeugen und Personen, die auch mittels anderer Quellen, sprich Erbschaften oder sonstigen Besitzes, überleben konnten, vom öffentlichen System auszuschließen. Der anschließende Satz sorgt für Verwirrung und bietet verschiedene Interpretationsmöglichkeiten: ,,Es gibt auch einen durch das Los bestimmten Schatzmeister (tamias) für sie." Das griechische Original bietet dem Übersetzer hier keine eindeutigen Anhaltspunkte für den Bezug des ,,sie". Sind damit die Behinderten gemeint oder ist dieser Satz unabhängig von dieser Problematik und bezieht sich auf die Ratsherren? P. J. Rhodes legt dieses Dilemma mit all seinen Facetten in seinem Kommentar zur Athenaion Politeia dar (Rhodes S. 570f).
Die Lysias - Rede
Bietet die Athenaion Politeia eine nüchterne Darstellung des Sachverhalts, so dient die Rede des Lysias (Lysias 24) als konkretes Beispiel für die alltägliche Praxis bei der von Aristoteles beschriebenen Entscheidungsfindung und liefert noch einige ergänzende Details zum gesamten Bild, das man sich von der institutionalisierten Unterstützung zu machen hat.
Von einem Behinderten, dessen Status als Empfänger der Unterstützung offenbar angegriffen worden ist (Lysias 24, 1), wird eine Verteidigungsrede vorgetragen, deren Verfasser Lysias ist. Darin wird Punkt für Punkt die Anklage, deren Wortlaut nicht überliefert ist und deren Inhalt deswegen nur aus der Reaktion in der Lysias - Rede rekonstruierbar ist, widerlegt. Der Angeklagte räumt ein, nicht vollkommen erwerbsunfähig zu sein (Lysias 24, 4f) und gibt dem Kläger damit zu einem bestimmten Grad Recht. Allerdings reiche das Ausmaß an Gewerbe, welches zu treiben er in der Lage sei, nicht aus, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, wodurch er zum Empfang der Leistung berechtigt sei. Ferner stellt der Kläger die Behinderung als solche in Frage, indem er angibt, der Angeklagte sei in der Lage, Pferde zu besteigen (Lysias 24, 5). Dies münzt der Behinderte in ein Argument zu seinen Gunsten um: er brauche das Pferd als Fortbewegungshilfe, weil er bedingt durch seine Behinderung nicht fähig sei, größere Strecken zu Fuß zu überwinden. Auch beweise das Reiten keineswegs Reichtum jenseits der im Gesetz zur Unterstützung der Behinderten festgelegten Grenzen, da er mangels eigener Mittel lediglich geliehene Pferde reite (Lysias 24, 10ff). Auch wird in diesem Kontext der teilweise sehr sarkastische Ton der Rede ersichtlich, als der Beschuldigte feststellt, sein Prozessgegner hüte sich, ,,in seiner Klage gegen mich als Beweis von Wohlstand geltend zu machen, dass ich zwei Stöcke trage, die anderen Menschen nur einen" (Lysias 24, 12). Der Kläger ,,behauptet weiter, ich sei ein übermüthiger, händelsüchtiger und durchaus frecher Mensch" (Lysias 24, 15), ,,weiter behauptet er daß viele schlechte Menschen sich um mich sammeln" (Lysias 24, 19). Offensichtlich wurde von einem von der Polis Unterstützten also erwartet, ein Mindestmaß an moralischer Tauglichkeit zu erfüllen. Von dieser Notwendigkeit scheint auch der Behinderte überzeugt zu sein, denn er bemüht sich, diese Anschuldigungen zu widerlegen und polemisiert im Gegenzug, indem er dem Kläger im Umkehrschluss genau die Eigenschaften unterstellt, die dieser als Teil der Anklage aufführt (Lysias 24, 15ff).
Es lässt sich lediglich ein bedeutender Unterschied feststellen, der aufgrund der zeitlichen Distanz zwischen der Lysias - Rede, die kurz nach der Wiederherstellung der Demokratie 403 gehalten worden sein muss12 , und der Verfassung der Athenaion Politeia in den zwanziger Jahren des vierten Jahrhunderts auftritt: spricht Aristoteles wie erwähnt von zwei Obolen, die den Behinderten pro Tag zustünden, so kämpft der Behinderte in dem Prozess, dessen Teil die Lysias - Rede ist, um einen Tagessatz von einer Obole (Lysias 24, 26). Dies legt den Schluss nahe, dass im Laufe des vierten Jahrhunderts eine allgemeine Preissteigerung stattgefunden haben muss und eine Erhöhung des Tagessatzes eine Anpassung an diese Entwicklung ist. Eine weitere Änderung der Unterstützung fand nach Jacoby 306/305 statt, als man von dem Prinzip, nach Tagessätzen abzurechnen, abwich und von nun an jeden Monat eine feste Summe von neun Drachmen auszahlte13 . Dies bedeutete finanzielle Einbußen: der neue monatliche Satz entsprach einer Reduzierung der Leistung um etwa zehn Prozent (vgl. Dillon S. 45f).
Unter Berufung auf eine Stelle in der Rede des Aeschines gegen Timarchus (Aeschines 1, 104) kommt Dillon (S. 42) letztlich zu dem Schluss, dass die Auszahlung der Unterstützung einmal im pro Prytanie stattfand, was er von Aristoteles (Ath. Pol 48, 2) manifestiert sieht.
Der Kontrast: Isolation aufgrund geistiger Behinderung
Alles bisher belegte und beschriebene bezieht sich weitgehend auf Menschen mit körperlicher Behinderung. Wie sich zeigen wird, galt keine der sozialen Maßnahmen gleichzeitig für geistig Behinderte. Generell fiel die Fürsorge für diese Personen in den Aufgabenbereich der Familie. Herbert Graßl entnimmt Plutarchs Solon - Vita (Plutarch, Solon 8, 2) den Hinweis nach einer Berichtspflicht der Familie gegenüber der Polis für den Fall, dass ein Mitglied geisteskrank ist. Weiter spricht er von der Schutzfunktion, die der Staat zugunsten der gesunden Mitglieder einer Familie innehatte, die sich vor allem bezüglich des Vermögensrechts äußerte, da dem Kranken Mitglied potentielle finanzielle Schädigungen der Familie insofern verwehrt blieben, als dass ihm die Errichtung eines Testaments unmöglich gemacht wurde und zum Beispiel auch Kaufverträge seinerseits grundsätzlich ungültig waren. Man könne also nicht im Entferntesten von Integration sprechen14 .
Eine Versorgung des Geisteskranken innerhalb der Familie führt auch zu einer gewissen Schutzfunktion für den Betroffenen selbst, insofern als dass ein geistig Behinderter in der Öffentlichkeit ungern gesehen war. Dies äußerte sich vor allem im Akt des Steinewerfens auf diese Menschen, über das als Solches in der Gelehrtenwelt ein breiter Konsens besteht, basierend auf verschiedenen Stellen in den Komödien des Aristophanes15 . Allerdings herrscht über die Intention dieser Handlungen Uneinigkeit.
Herbert Graßl liefert die Erklärung, dies geschehe mit der Absicht, die Geisteskranken zu vertreiben, um sich nicht in der Nähe dieser aufhalten zu müssen16 , womit er in Opposition zu Fridolf Kudlien tritt, der nachzuweisen versucht, dass solches Handeln ,,auch mit therapeutischer, also positiver Zielsetzung ausgeführt wurde"17 . Er führt als Belege Szenen aus dem Mythos an, so den Steinwurf der Athena nach dem wahnsinnigen Herakles (Pausanias IX, 11, 2), der diesen von der Tötung des Amphitryon abhielt. Kudlien interpretiert dieses Ablassen des Herakles als Heilung vom Wahnsinn, Graßl glaubt hier weniger an die ,,magische, sondern mechanische Wirkung des Steinwurfs"18 , der zu einer Ohnmacht des Herakles geführt habe, was durch den Zusatz bei Pausanias, ,,daß ihn aber vorher der Schlaf befiehl unter dem Schlag des Steines" (Pausanias IX, 11, 2) bekräftigt wird. So kann man eine mögliche therapeutische Wirkung des Steinewerfens wohl lediglich mit dem Ziel einer Schockbehandlung, wie es auch Kudlien (S. 431) zugibt, erkennen.
Diskussion der Ursachen für die Situation in Athen
Die Demokratie und deren Entstehung als solche
Athen ragt in vielerlei Hinsicht aus der Masse der Poleis im klassischen Griechenland heraus. Neben den rein statistischen Aspekten wie vor allem dem Bevölkerungsreichtum und der damit verbundenen weiten Überlegenheit gegenüber der Durchschnittspolis im wirtschaftlichen und strategischen Bereich tritt natürlich ein Merkmal besonders in den Vordergrund: die Demokratie. Die Ursachen, die zu ihrer Entstehung führten sind vielfältig und eine ausführliche Diskussion dieser würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Was es aber festzuhalten gilt ist das andere Menschenbild, das sich in Athen im Vergleich zu anderen Staaten der Antike entwickelt haben muss.
Der wichtigste Pfeiler der Demokratie Athens und des damit verbundenen Menschenbildes war das Streben nach Gleichheit19 , zu deren Erreichen die Institutionen der Polis auf verschiedenste Art vom Volk kontrolliert bzw. sogar beherrscht wurden. In diesem Sinne könnte also eine Unterstützung von Menschen, die von der Natur oder vom Schicksal benachteiligt wurden, als eine Art Ausgleich verstanden werden, der den Betroffenen eine - wenn auch beschränkte - Möglichkeit bieten soll, an diesem demokratischen Ideal teilzuhaben.
Soziale Gerechtigkeit?
Für Matthew P. J. Dillon (vgl. Dillon S. 34f) kann man daraus nicht in erster Linie ein Bewusstsein der Bewohner Athens für soziale Gerechtigkeit ableiten, sondern drückt dies vielmehr die Angst der nach Gleichheit strebenden Demokraten vor wachsender Ungleichheit aus, die dann entstünde, wenn Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbständig verdienen können, sich nicht auf Hilfe aus öffentlicher Hand verlassen könnten und sich daraufhin um des nackten Überlebens willen an gönnerhafte Privatleute wendeten. Nachdem der Grundsatz der Gleichheit es gebot, behinderte Menschen nicht von den entscheidenden Institutionen der Polis wie der Volksversammlung auszuschließen, eine Unterstützung durch Privatpersonen aber immer auch ein Stück Abhängigkeit zur Folge habe, bestehe bei dauerhaften derartigen Verbindungen die Gefahr von ausgeprägten Klientel - Patronatsverhältnissen, die letztendlich die Gleichheit im politischen Entscheidungsprozess verzerren würden. Er folgt also der Vorlage des Aristoteles20 , als dieser den Gegensatz zwischen Kimon, der durch seine großzügige Unterstützung Minderbemittelter entscheidend an Einfluss zu gewinnen drohte, und Perikles, der sich schließlich mit der Einführung von Dikastikon und Bouleutikon zur Wehr setzt, beschreibt. Wenn die verhältnismäßig geringe Anzahl an Behinderten auch eine Geringfügigkeit der Bedeutung ihrer Unterstützung bezüglich eines möglichen Klientelwesens bedinge, sei die staatliche Hilfeleistung doch hauptsächlich aus dessen Verhinderung motiviert. In diesem Zusammenhang stellt Dillon die These vom Staat als Patron derer, die er unterstützt, auf (Dillon, S. 54), die dann auch in dessen Abhängigkeit geraten.
Jedoch gibt es auch Einwände gegen diese Hauptmotivation nach dillonscher Interpretation. Der große Anteil, den Kriegsgeschädigte an der Menge der Unterstützten ausmachten legt auch ein anderes Motiv nahe: Dankbarkeit. Dafür spricht die bereits sehr frühe Unterstützung der Kriegsverwundeten und ihrer Nachfahren, die Solon für moralisch notwendig erachtet in Anbetracht der Ehren und deren Versilberung, die einem siegreichen Athleten bei olympischen oder isthmischen Spielen zuteil wurden21 .
Der Versehrte hatte schließlich sein Leben beim Einsatz für die Interessen der Polis aufs Spiel gesetzt und dabei seine Gesundheit verloren. Die Gemeinschaft stand also in der Schuld ihres Kämpfers, zu deren Wiedergutmachung die regelmäßige Unterstützung angemessen schien. Man kann also hier von einem moralisch motivierten sozialen Gerechtigkeitssinn sprechen. Ferner stellt sich gerade mit Bezug auf Kimon die Frage, ob denn ein angesehener, ohnehin einflussreicher und vor allem stolzer Aristokrat darauf aus gewesen sein kann, einige Behinderte zu seinen Abhängigen zu machen und dies zu politischen Zwecken auszunutzen, sich gewissermaßen mit ihnen zu schmücken, oder ob ein derartiges Handeln nicht mehr vom aristokratischen Selbstverständnis motiviert war, das eben eine Unterstützung Armer geradezu forderte22
Abschließende Bemerkungen und Ausblick
Die vorliegende Arbeit bietet eine annähernde Darstellung des Forschungsstandes im behandelten Bereich. Ziel eines weiteren Vorgehens in diesem Aspekt der Geschichte könnte es sein, epochenübergreifender Weise Vergleiche mit mittelalterlicher und neuzeitlicher Behandlung von derartig benachteiligten Randgruppen herzustellen und letztendlich alle historischen Facetten unter Berücksichtigung religiös - kultureller Veränderungen wie dem Aufstieg des Christentums, der Reformation oder naturwissenschaftlicher Meilensteine - Stichwort Darwin - und aller ihrer positiven und negativen Folgen auf die Lebensumstände der Behinderten zu erfassen. Eine daraus möglicherweise resultierende Erkenntnis, nämlich die kontinuierliche, wenn auch nicht pausen - und rückfallslose Verbesserung der Situation seit der Aufklärung und der Formulierung der Menschenrechte im europäisch geprägten Teil der Welt wäre Ausgangspunkt für eine Diskussion der Ursachen, warum sich trotzdem auch heute noch in so ,,politisch korrekten" Staaten wie der Bundesrepublik Deutschland Behinderte ausgegrenzt fühlen und in Zukunft in Zusammenhang mit der vielerseits postulierten Forderung nach einer Verringerung der Staatsausgaben für das Sozialwesen noch mehr um ihre verfassungsmäßig zugesicherte Würde kämpfen müssen.
Anhang
Quellenverzeichnis
The Speeches of Aeschines, übers. ins Engl. v. Charles Darwin Adams, London 1919 Nachdruck 1957
Aristophanes, Sämtliche Komödien, Hg. v. Carl Andresen, Olof Gigon, Siegfried Morenz u. Walter Rüegg. Zürich 1968
Aristoteles, Athenaion Politeia, übers. u. hg. v. Martin Dreher, Stuttgart 1993
Diogenes Laertius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen Buch I - X, übers. v. Otto Apelt, hg. v. Klaus Reich, Hamburg 2 1967
Die erhaltenen Reden des Lysias, übers., erläutert und mit Einleitungen versehen von Ferdinand Baur. Stuttgart2 1868
Pausanias, Reisen in Griechenland Bd. 3, übers. v. Ernst Meyer, hg. v. Felix Eckstein u. Peter C. Bol. Zürich 1989
Plutarch, Große Griechen und Römer Bd. 1, übers. v. Konrat Ziegler. Zürich 1954
Literaturverzeichnis
Dillon, Matthew P. J., Payments to the Disabled at Athens: Social Justice or Fear of Aristocratic Patronage, in: Anc. Soc. 25 (1995), S. 27 - 57
Graßl, Herbert: Behinderte in der Antike. Bemerkungen zur Stellung und Integration. In: Kloft, Hans (Hg.): Grazer Beiträge, Supplementband III, Graz 1988, 35 - 44
Graßl, Herbert, Zur sozialen Position geistig Behinderter im Altertum. in: Weiler, Ingomar (Hg.), Soziale Randgruppen und Außenseiter im Altertum, Graz 1988
Jacoby, F., Die Fragmente der griechischen Historiker III b Suppl. 1, Leiden 1954
Kudlien, Fridolf, Therapeutisches Steinewerfen. in: Hermes 110 (1982), S. 423 - 434
Rhodes, P. J., A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford 1981
Ruschenbusch, Eberhard, Athenische Innenpolitik im 5. Jahrhundert v. Christus, Bamberg 1979
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Aristoteles, Athenaion Politeia 49, 4
2 Lysias Rede 24
3 Plutarch I, 8, 2
4 Diogenes Laertius I (Solon) 55
5 Plutarch, Solon 31, 2
6 Dillon S. 28f
7 Jacoby, F., FGrHist III b Suppl. 1, S. 563
8 zur Rolle der Frauen in Athen s. Just, R.: Women in Athenian Law and Life. New York 1989
9 Aristoteles, Ath. Pol. 27, 3 - 5
10 Graßl, Herbert: Behinderte in der Antike S.42
11 Aristoteles, Athenaion Politeia 49, 4
12 Lysias 24, 25; vgl. Dillon S. 30
13 Jacoby, F.: FGrHist III b Suppl. 1, S. 563
14 vgl. Graßl, Herbert: Zur sozialen Position geistig Behinderter im Altertum S. 110
15 Aristophanes, Die Wespen 1491ff; Die Vögel 524f
16 vgl. Graßl, Herbert: Zur sozialen Position geistig Behinderter im Altertum S. 111f
17 Kudlien S. 431
18 Graßl, Herbert: Zur sozialen Position S.112
19 zum Gleichheitsbegriff siehe Bleicken, Jochen: Die athenische Demokratie. Paderborn4 1995, S. 536ff, mit Angaben zu weiterer Literatur
20 Aristoteles, Ath. Pol. 27, 3 - 5, s. S.5
21 Diogenes Laertius I (Solon), 55
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über die Behandlung von Behinderten im antiken Athen?
Dieser Text untersucht die Entwicklung der Unterstützung von Behinderten im antiken Athen, von den Anfängen in vordemokratischer Zeit bis zur perikleischen Demokratie und darüber hinaus. Er analysiert die alltägliche Praxis der Behindertenhilfe anhand von Quellen wie Aristoteles' Athenaion Politeia und Reden des Lysias. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Kontrast zwischen der Unterstützung körperlich Behinderter und der Isolation geistig Behinderter.
Welche Quellen werden für die Analyse des Themas herangezogen?
Die Analyse stützt sich hauptsächlich auf die Athenaion Politeia des Aristoteles, eine Rede des Lysias, die für einen Behinderten geschrieben wurde, sowie auf Werke von Plutarch, Diogenes Laertius und Aristophanes. Sekundärliteratur von Historikern wie Matthew P. J. Dillon, Herbert Graßl, Eberhard Ruschenbusch und Fridolf Kudlien wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie unterschied sich die Unterstützung von Behinderten in vordemokratischer und demokratischer Zeit?
In vordemokratischer Zeit, unter Solon und Peisistratos, konzentrierte sich die Unterstützung hauptsächlich auf Kriegsversehrte und deren Angehörige. Erst in der perikleischen Demokratie kam es zu einer allgemeinen Unterstützung, die auch zivilbedingte Behinderungen umfasste. Diese Entwicklung wird mit den politischen Reformen des Perikles und den sozialen Auswirkungen des Peloponnesischen Krieges in Verbindung gebracht.
Welche Kriterien mussten erfüllt sein, um staatliche Unterstützung zu erhalten?
Laut Aristoteles' Athenaion Politeia mussten Antragsteller nachweisen, dass sie nicht mehr als drei Minen besaßen und so schwer körperbehindert waren, dass sie keiner Arbeit nachgehen konnten. Der Rat der 500 prüfte die Anträge, um Missbrauch zu verhindern.
Wie unterschied sich der Umgang mit körperlich und geistig Behinderten?
Während körperlich Behinderte unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Unterstützung erhielten, waren geistig Behinderte in der Regel isoliert und auf die Fürsorge ihrer Familien angewiesen. Es gab sogar Berichte über Steinwürfe auf geistig Behinderte in der Öffentlichkeit, deren Intention jedoch umstritten ist.
Welche möglichen Motive für die staatliche Unterstützung von Behinderten werden diskutiert?
Es werden verschiedene Motive diskutiert, darunter die Angst vor wachsender Ungleichheit und der Entstehung von Klientelverhältnissen, Dankbarkeit gegenüber Kriegsgeschädigten sowie moralische Überlegungen zur sozialen Gerechtigkeit.
Wie veränderte sich die Höhe der staatlichen Unterstützung im Laufe der Zeit?
Während Aristoteles von zwei Obolen pro Tag sprach, die Behinderten zustanden, kämpfte der Behinderte in der Rede des Lysias um einen Tagessatz von einer Obole. Später, im vierten Jahrhundert, wurde auf eine feste Summe von neun Drachmen pro Monat umgestellt, was einer Reduzierung der Leistung entsprach.
Welche Fragen bleiben offen und wie könnte die Forschung weitergehen?
Die Arbeit schlägt vor, epochenübergreifende Vergleiche mit der Behandlung von Behinderten im Mittelalter und in der Neuzeit anzustellen und alle historischen Facetten unter Berücksichtigung religiös-kultureller Veränderungen zu erfassen. Es wird auch die Frage aufgeworfen, warum sich Behinderte trotz des Fortschritts in der Anerkennung ihrer Rechte auch heute noch ausgegrenzt fühlen.
- Citar trabajo
- Michael Tibudd (Autor), 1999, Behindertenunterstützung im demokratischen Athen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94802