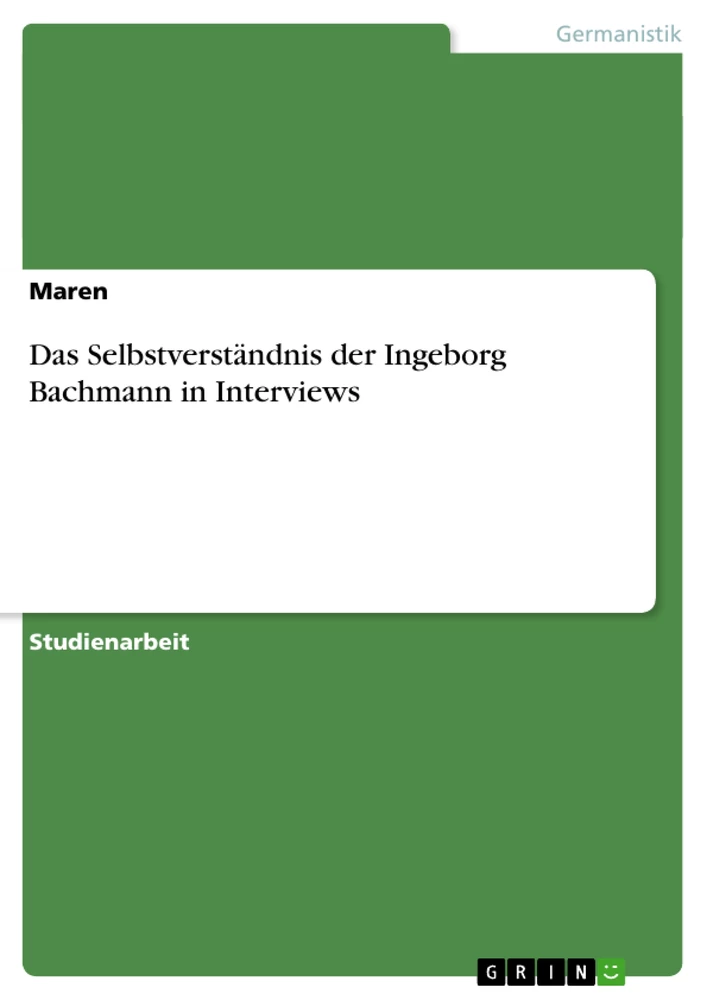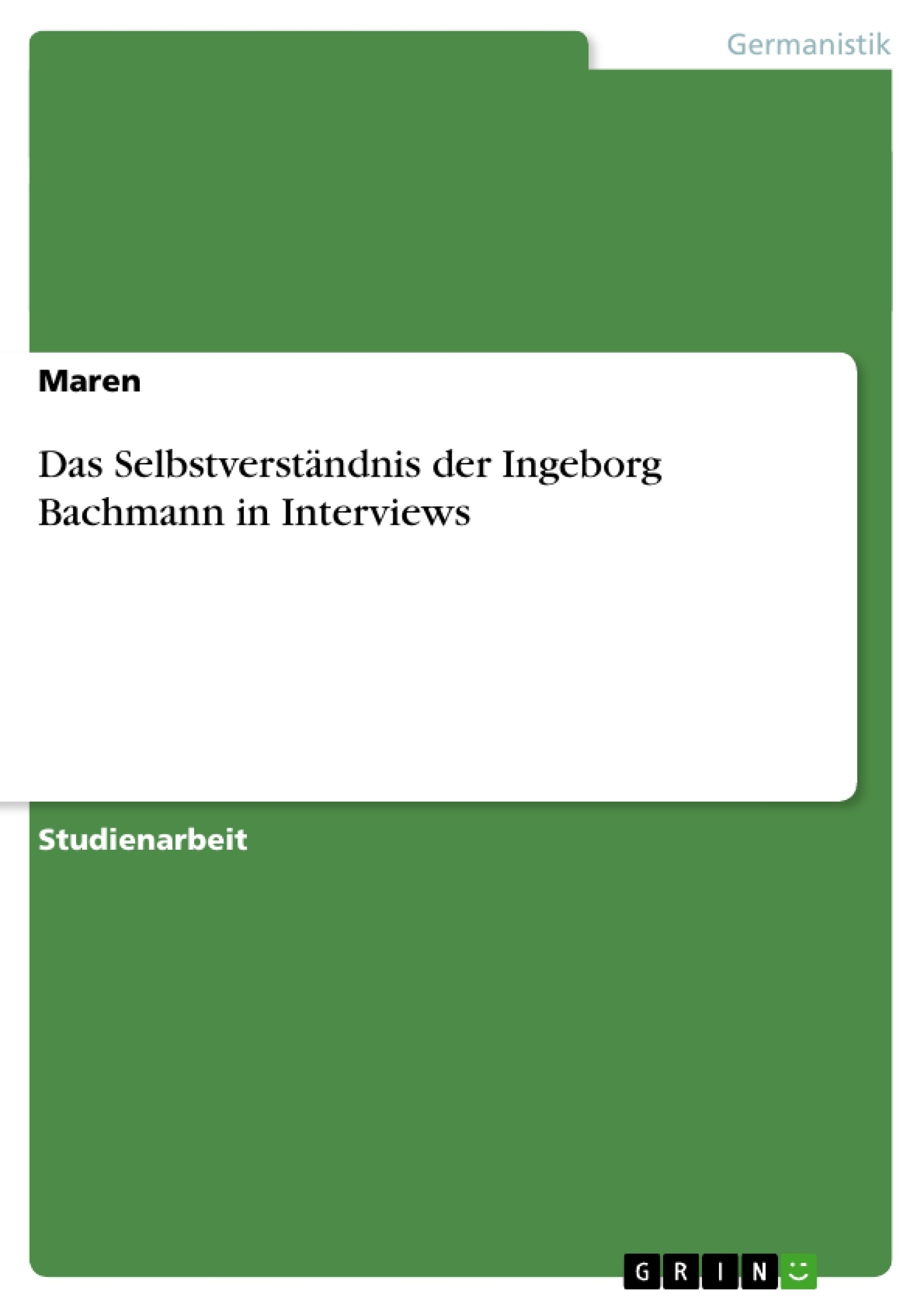1. Einleitung:
Dieses Referat wurde am 22.06.1999 Im Grundkurs A+B: „Biographien und Autobiographien von Autorinnen“ gehalten. Das Seminar beschäftigte sich mit autobiographischen und biographischen Texten über die Schriftstellerinnen Anna Seghers, Marieluise Fleisser, Ingeborg Bachmann und Christa Wolf . Ich habe über das Selbstverständinis referiert, das Ingeborg Bachmann in den von Koschel und Weidebaum unter dem Titel „Wir müssen wahre Sätze finden“ veröffentlichen Interviews äußert.1
Insbesondere sollte ich mich laut Aufgabenstellung auf das Interview mit N.N. von 1961 und auf das mit Gerda Bödefeld vom 24.12.71 konzentrieren. Beim Beschäftigen mit den Interviews beschloss ich dann allerdings, andere Interviews mit heranzuzuziehen, um die Äußerungen der Bachmann klarer und umfassender darzustellen. Insgesamt wurde das Referat dann eine Zusammenfassung der von Bachmann in den Interviews geäußerten Aussagen zu ihrer Person und zu bestimmten Themenbereichen.
Ich hatte dieses Referat zunächst mündlich vorgetragen und werde in der vorliegenden Verschriftlichung einige Korrekturen vornehmen, insbesondere betreffend der Struktur.
Zunächst werde ich Bachmanns Einstellung zu Interviews und Aussagen über die eigene Person darstellen, im Anschlußdaran komme ich auf den Wechsel, der Bachmann von der Lyrikerin zur Prosaautorin und ihre Motive dafür. Schließlich werde ich dann zu den für Bachmann und ihr Werk wichtigen Themenbereichen Sprache, Rolle der Schriftsteller und zu Bachmanns Überlegungen zur modernen Gesellschaft kommen. Zum Schlußmeiner Verschriftlichung werde ich dann bestimmte Probleme erläutern, die sich für mich im Laufe der Arbeit ergeben haben und nochmals die Wichtigkeit der Betrachtung von autobiographischem Material für das Gesamtverständnis eines Autors/einer Autorin diskutieren. Besonders wichtig scheint mir bei einem Referat über die Selbstaussagen einer Autorin, die Autorin selbst sprechen zu lassen. Um dem gerecht werden zu können, werde ich daher im Folgenden sehr stark mit Zitaten der Bachmann arbeiten.
2. Interviews und persönliche Dinge:
Ingeborg Bachmann hat nie gerne Interviews gegeben und auch nie gern von sich oder Privatem geredet. Sie war der Meinung, dass man das, was sie ausdrücken wollte, in ihren Werken findet. So fällt beim Lesen der Interviews auf, dass sie sich oft selbst zitiert, auf Textstellen ihrer oder anderer Romane verweist und immer wieder betont, dass das Schreiben ihr eigentliches Ausdrucksmedium sei: „[...]denn im Sprechen bleibt man ja hinter dem Schreiben zurück und tappt tolpatschig in den Gegenden herum, in denen man sich schreibend schon einmal zurechtgefunden hat.“2
So schließt sie auch jede Äußerung zu ihrer eigenen Person aus, und schränkt den Bereich, zu dem sie bereit ist, sich zu äußern ganz deutlich ein, indem sie sagt:: „Ich nehme Stellung, wenn es mir richtig erscheint, zu politischen, gesellschaftlichen Verhältnissen oder zu den Unglücken der einzelnen, wenn ich gerade in der Nähe bin. Nicht zu meinem Leben. Denn ich habe zu schreiben. Und über den Rest hat man zu schweigen.“3
Ihr Versuch, ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit zurückzuhalten steht in engem Zusammenhang mit ihrem ständigen Wechsel der Wohnorte. Und so gibt sie auf die Frage, warum sie nicht ständig in Österreich lebe, folgende Antwort:
„ Ich brauche Freiheit. Viel Freiheit. [...] Ich will nicht mundtot gemacht werden. Vielleicht kann man sogar sagen, daßich eine Kämpfernatur bin. Vor allem aber möchte ich in Ruhe arbeiten. Ungestört sein. Ich komme jetzt öfter nach Klagenfurt, um meine Eltern zu besuchen, Spaziergänge zu machen, aber ich sehne mich nach Frieden und suche meine Zuflucht daher in der Anonymität.“4
Mit diesem Bedürfnis nach Anonymität und nach Privatsphäre geht eine Ablehnung jeglicher traditionell biographischer Literatur einher. Sie distanziert sich von der herkömmlichen, an Lebensdaten orientierten Autobiographik, indem sie ihren Roman Malina, der oft autobiographisch gelesen worden ist, als „imaginäre Autobiographie“5 bezeichnet. Den Begriff erklärt sie folgendermaßen:
„ [...] Wir erfahren auch von ich und Malina nichts, was sonst in Autobiographien vorkommt oder vorzukommen hat, also keine Geschichte, keinen Lebenslauf. Eine Autobiographie würde ich es nur nennen, wenn man darin den geistigen Prozeßeines Ichs sieht, aber nicht das Erzählen von Lebensläufen, Privatgeschichten und ähnlichen Peinlichkeiten.“6
Allerdings ist ihr bewußt, dass Biographisches in ihre Arbeiten einfließt, doch besteht dies für sie nicht in Daten, denn „[...] die Angaben zur Person sind immer das, was mit der Person am wenigsten zu tun hat .“7 - aber sie gesteht ein:
„ [...] Selbstverständlich würde man auch manches in meinen Arbeiten auf Biographisches zurückführen können. Begegnungen mit der Wirklichkeit, mit Orten, Ländern und Menschen sind oft wichtig gewesen und können in verwandelter Form nach Jahren wiederauftreten. Wichtig sind aber auch geistige Begegnungen, und mir war die wichtigste die mit dem Werk des Philosophen Ludwig Wittgenstein [...].“8
So sieht Bachmann in der geistigen Entwicklung einer Person, in ihren Erfahrungen und der Beschäftigung mit Philosophie und Literatur die für die Biographie wichtigen Einflußfaktoren. Lebensdaten gehören für sie nicht dazu.
3. Sprache:
Für Ingeborg Bachmann war die Sprache stets ein zentraler Punkt ihres Schaffens. Sie hatte sich in ihrem Philosophiestudium stark mit Wittgenstein und Heidegger beschäftigt, was sie auch in ihrem literarischen Schaffen sehr stark beeinflusst hat: „Wichtig sind für mich geistige Begegnungen, und mir war die wichtigste die mit dem Werk des Philosophen Ludwig Wittgenstein, der die Probleme der Philosophie auf die Probleme der Sprache zurückgeführt hat.“9 An anderer Stelle beruft sie sich auf das Zitat Heideggers: „ Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“10 und gibt an, dass dies auch auf sie zutreffe. So war für Bachmann das Hinterfragen ihrer Sprache, die Arbeit mit Worten und das Finden „wahrer Sätze“11 stets der zentrale Punkt ihres Schaffens. Sie ist der Überzeugung „ [...] daßja nur eine einzige Bemühung beim Schreiben sinnvoll ist; die um Sprache. Gestern, heute und morgen liegen in ihr beschlossen. Wenn die Sprache eines Schriftstellers nicht standhält, hält auch, was er sagt, nicht stand.“12
Und so ist ihr Gebrauch der Sprache sehr bewußt, was besonders deutlich wird, as sie sich zu der Frage eines Journalisten äußert, was sie zu dem Vorwurf der Kritiker sage , die behaupteten, dass sie ihre Verse durch Bilder und Symbole verrätsele:
„Ich glaube weniger, daßich sie verrätsele, die Sprache allein ist schon etwas so Rätselhaftes. Und wenn man Gedichte schreibt oder Prosa schreibt, „bedient“ man sich ja nicht der Sprache. Ich meine, der Sprache bedient sich vielleicht der Journalist oder jemand, der bestimmte Ansichten zu verlautbaren hat. Ein Schriftsteller kann sich der Sprache überhaupt nicht bedienen, sondern ich glaube bei Nestroy heißt es einmal:“ Ich hab‘ einen Gefangenen gemacht, und der läßt mich nicht mehr los.“ Das ist natürlich auch ein Bild, aber ein recht intelligentes für das ganz andere Verhältnis, das ein Schriftsteller zur Sprache hat. [...] Daßman ein Wort anders ansieht; schon ein einzelnes Wort - je näher man hinsieht, von umso weiter her schaut es zurück - und es ist doch mit sehr vielen Rätseln beladen; da kann ein Schriftsteller sich nicht der vorgefundenen Sprache, also der Phrasen, bedienen, sondern er mußsie zerschreiben. Und die Sprache, die wir sprechen und fast alle sprechen, ist eine Sprache der Phrasen. Und da erscheint so vielen etwas, was sie lesen, also was für mich wirklich geschrieben ist, als schwer verständlich oder rätselhaft. So rätselhaft ist das gar nicht; mir kommt es oft sehr viel rätselhafter vor, was zusammengeredet wird aus diesen vorfabrizierten Sätzen.“13
Bachmann vertritt diesen Grundgedanken konsequent und sieht darin die Hauptaufgabe der Schriftsteller: „Die Schriftsteller werden [...] abdanken müssen, wenn sie nur noch die Phrasen im Mund haben, die die anderen auch haben.“14
4. Von der Lyrikerin zur Prosaautorin:
Im Jahre 1957 erschien Bachmanns Lyrikband „Anrufung des großen Bären“, es war der letzte Lyrikband der Bachmann. Vier Jahre später erschien ihr erster Erzählband „das dreißigste Jahr“. Diesen Wechsel von der Lyrikerin zur Autorin erzählender Prosa bezeichnet Bachmann als „Übersiedlung“15, da sie seitdem keine Lyrik mehr schrieb. An anderer Stelle spricht sie von einem „Umzug im Kopf“16, der der erste Schritt für sie von der Lyrik zur Prosa gewesen sei.
Als Grund für diese Übersiedlung gibt sie an:
„ Sie müssen sich denken, daßman plötzlich alles dagegen haben kann, gegen jede Metapher, jeden Klang, jeden Zwang, Worte zusammenrücken zu lassen, gegen dieses absolute glückliche Auftreten von Worten und Bildern. Daßman es ersticken möchte, damit man noch einmal überprüfen kann, was daran ist, was es sein sollte.“17
Und sie ergänzt :
„ Ich weißnoch immer wenig über Gedichte, aber zu dem wenigen gehört der Verdacht. Verdächtige dich genug, verdächtige die Worte, die Sprache, das habe ich mir oft gesagt, vertiefe diesen Verdacht - damit eines Tages vielleicht etwas Neues entstehen kann - oder es soll nichts mehr entstehen.“18
Zwei Jahre später antwortet sie auf die Frage, was ihr das wichtigste sei in ihrer Produktion - ob Lyrik, Prosa oder Hörspiele:
„Die sind mir alle eins, Angriffe und Expeditionen in eine Richtung, von verschiedenen Seiten aus mit verschiedenen Mitteln. Notwendig ist mir nur, daßich in einem für mich richtigen Augenblick Schreiben abbreche und Schreiben woanders aufnehme.“19
Ihr Wechsel von der Lyrikerin zur Prosaautorin hängt also mit ihrem Sprachbegriff und ihrem Sprachbewußtsein zusammen. Um die für sie so wichtigen „wahren Sätze“ zu finden, mußsie abwägen, mußauch die Art des Schreibens unterordnen, genau, wie die Sprache untergeordnet werden muß:
„ Ich habe mich immer aufgefordert gefühlt, und war darum auf Aufforderung aus, ich möchte drum auch die Worte in die Schranken fordern dürfen, zu ihrer Wahrheit zu kommen [...] die Worte sind was sie sind, sie sind schon gut, aber wie wir sie stellen, verwenden, das ist selten gut. Wenn es schlecht ist, wird es uns umbringen.“20
Schon lange vor ihrer „Übersiedlung“ erwähnt sie den Wunsch: „ Ich möchte später einen Roman schreiben, nur weißich noch nicht, wo ansetzen..“21 Es ist für sie also zum einen eine Frage des Zeitpunkts, zum anderen aber auch der Notwendigkeit, die Art des Schreibens zu verändern, um etwas Neues ausdrücken zu können, was nach dieser Veränderung verlangt.
5. Die Rolle des Schriftstellers:
Bachmann bekommt in den Interviews oft die Frage gestellt, welche Rolle für sie ein Schriftsteller oder ein Künstler habe und worin seine Aufgaben in ihren Augen bestünden. Sie nimmt diese Frage jedes Mal auf, besteht allerdings auch immer wieder darauf, dass sie die Fragestellung für verkehrt hält:
„[...] mich hat das schon sehr früh zu ärgern angefangen. Denn ich halte alle diese Fragestellungen für grundverkehrt, auch für sehr anmaßend. Und obwohl es immer wieder interessante Verlautbarungen einzelner Schriftsteller gibt über ihre Aufgabe, ich selbst weißnicht, was sie ist. [...] Trotzdem gibt es natürlich etwas, aber das hat jeder mit sich selbst abzumachen, für sich zu lösen, inwiefern er seine Arbeit rechtfertigen kann und zuerst einmal vor sich rechtfertigen kann. [...] Der Versuch, nicht mehr zu sagen, als man zu sagen hat, sich nicht zu übernehmen mit Pseudoproblemen, die man sich äußerlich angeeignet hat. Die wirklichen Probleme hat man auf eine ganz andere Weise, sie sind nicht zu diskutieren auf Konferenzen, auf Kongressen. Und wenn es ein wirkliches Problem dieser Art gibt, dann ist es eben indiskutabel im besten Sinn. Und die einzige Antwort darauf ist die Arbeit, das Werk oder das Gelingen dieses Werkes.“ 22
Auch hier besteht sie wieder darauf, dass der Schriftsteller die Wahrheit erfassen muß, die wahren Probleme erkennen mußund sich nicht mit „Pseudoproblemen“, wie sie es nennt, befassen soll.
Für Bachmann mußder Schriftsteller die Welt deutlicher sehen als seine Leser, er mußPhrasen vermeiden, er mußdie Welt sehen wie sie ist, um sie dann seinen Lesern so zu spiegeln, dass sie sie auch sehen können, wie sie ist:
„Und wenn man überhaupt fragt, welche Aufgaben ein Schriftsteller hat [...], dann würde ich immer sagen, die Menschen dorthin zu bringen oder mitzureißen, in die Erfahrungen, die die Schriftsteller machen und die ihnen durch diese gefährliche Entwicklung dieser modernen Welt weggenommen werden.“23
An einer anderen Stelle beschreibt sie die Rolle des Künstlers wie folgt:
„Die Rolle des Künstlers - das ist mir etwas zu Fiktives. Es gibt doch sehr verschiedene Rollen, die Künstler haben, zugeteilt bekommen oder sich anmaßen. Und sie reichen von dem Gewissen der Nation bis zu den letzten kauzigen Spitzweg - Figuren, von Politikern, die Gedichte schreiben und Schriftstellern, die Politik machen. [...] und sich am meisten doch nur ähneln durch eben den ernsten und unbequemen Geist, den verändern wollenden, wo er zutage tritt, wo ein kritisches Verhältnis zu der jeweiligen Wirklichkeit diese Wirklichkeit überhaupt erst beweist. Wo nichts mehr zu verbessern, nichts mehr neu zu sehen, zu denken, nichts mehr zu korrigieren ist, nichts mehr zu erfinden und zu entwerfen, ist die Welt tot.“24
Hier spricht auch ein starker Idealismus, der Bachmann immer wieder hat verzweifeln lassen, sie selbst beschreibt diesen Glauben an die Möglichkeit, etwas zu verändern und zu bewegen indem sie sagt:
„ Ich glaube wirklich an etwas, und das nenne ich „ein Tag wird kommen“. Und eines Tages wird es kommen. Ja, wahrscheinlich wird es nicht kommen, denn man hat es uns ja immer zerstört. Es wird nicht kommen, und trotzdem glaube ich daran. Denn wenn ich nicht mehr daran glauben kann, kann ich auch nicht mehr schreiben.“25
Die Wichtigkeit des Schreibens für die Bachmann klingt in all diesen Zitaten mit, sie hat schon als Kind mit dem Schreiben angefangen, zum Teil heimlich. Schriftstellerin habe sie nie werden wollen, gesteht sie in dem Interview mit Gerda Bödefeld vom 24. Dezember 1971 . Sie habe nie daran gedacht, aus ihrer Leidenschaft einen Beruf zu machen. Aber ein Leben ohne schreiben könne sie sich „selbstverständlich nicht“26 vorstellen. Der Erfolg ihrer Gedichte und ihrer Prosa freut sie natürlich, obgleich sie nie damit gerechnet hätte.27
Die Arbeit als Schriftstellerin vergleicht sie mit der Arbeit eines Tänzers: „„auch bei Tänzern glauben Sie, jemand schweben zu sehen, und merken nichts von der Muskelarbeit, der ungeheuren Anstrengung.“28 und sie beschreibt, wie sie einmal eine Tänzerin beobachtet habe und sich darüber bewußt geworden sei „über den Preis, den jemand für das Zaubern und Bezaubern zu bezahlen hat“29
6. die Gesellschaft
Ingeborg Bachmann litt unter Todesangst, und zwar schon seit frühester Kindheit. Als den Moment ihrer ersten Todesangst gibt sie den Einzug der Hitlertruppen in Klagenfurt an.30 Diese Angst hat sie nie losgelassen, hat sie krank gemacht. So ist Bachmanns Sicht auf die Gesellschaft, auf die moderne Welt, die sie umgibt, sehr hart. denn sie geht davon aus: „ Es ist ein so großer Irrtum zu glauben, daßman nur in einem Krieg ermordet wird oder nur in einem Konzentrationslager - man wird mitten im Frieden ermordet.“31 und für dieses Morden „ sorgen eben die anderen [...] Aber der Anlaßist immer ein Mensch.[...] oder mehrere“.32 Dass dieser Blick auf die Gesellschaft schwer zu begreifen ist, ist ihr bewußt und sie erklärt: „[...] zu sagen, was neben uns jeden Tag passiert, wie Menschen, auf welche Weise sie ermordet werden von den andern, das mußman zuerst einmal beschreiben, damit man überhaupt versteht, warum es zu dem großen Morden kommen kann.“33 Für die Bachmann ist die Gesellschaft also ein Kriegsschauplatz, auf dem ein permanentes Morden stattfindet. Und als Hauptthema ihres Werkes gibt sie das „Leiden am Leben“34 an. Das Individuum steht, ihrer Ansicht nach, bedroht, ohne Halt da, wird von allen Seiten angegriffen und schließlich ermordet, innerlich zerstört. Bachmann geht sogar noch weiter und prägt eine Vorstellung, die immer wieder diskutiert worden ist und die deutsche Nachkriegsliteratur entscheidend beeinflußt hat. Sie überträgt die Vorstellung des Faschismus in die zwischenmenschlichen Beziehungen: „ [...], wo fängt der Faschismus an. [...] Er fängt an in Beziehungen zwischen Menschen. Der Faschismus ist das erste in der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, und ich habe versucht zu sagen [...], hier in dieser Gesellschaft ist immer Krieg.“35 Immer wieder ist diese Sichtweise diskutiert und problematisiert worden. Auf diese Diskussion kann ich an dieser Stelle leider nicht ausführlich eingehen, da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Im Seminar wurde allerdings darüber gesprochen, wie man diese Vorstellung, der Faschismus fange in den täglichen Beziehungen zwischen Menschen an, zu verstehen habe. Und wir sind zu dem Resultat gelangt, dass Bachmann hier die Vorurteile problematisiert, die die Gesellschaft uns vorgibt, die vorgefertigten Bilder und Schubladen, in die Menschen einander, sobald sie aufeinandertreffen, einordnen. ein Mann und eine Frau haben schon aus ihren Rollen heraus ein ungefähres Bild voneinander, bevor sie einander wirklich kennen. Und Bachmann geht sogar noch weiter und sagt, dass wir durch dieses Bild, durch diese Vorurteile, die wir gegen uns selbst und gegen andere habeneingeschränkt sind in userer Sicht. Dass die Gesellschaft uns dadurch „mordet“, uns etwas wegnimmt, etwas vorenthält. Über diese Gedanken ist Bachmann immer wieder verzweifelt. Und sie versucht, ihn in ihrem Werk auszudrücken:
„Ich glaube, daßdas aus allen Büchern herauskommt, daßalle Menschen in allen Beziehungen aneinander vorbeireden; dieses scheinbare Verständnis, das man Offenheit nennt, ist ja gar keines. Verstehen - das gibt es nicht. Offenheit ist nichts als ein komplettes Mißverständnis. Im Grunde ist jeder allein mit seinen, unübersetzten Gedanken und Gefühlen.“36
Dass Bachmann sich unverstanden fühlte, wird immer wieder deutlich, in ihrem Misstrauen der Sprache gegenüber, im Abwägen der Worte, in der Ablehnung von Interviews, in ihrer Zurückgezogenheit und nicht zuletzt auch und natürlich besonders in ihrem Werk.
7. Schlußbemerkung
Mein Referatsthema beschränkte sich ursprünglich auf zwei der von Koschel und Weidebaum veröffentlichten Interviews mit Ingeborg Bachmann. Als ich aber mit der Arbeit an dem Referat begonnen habe, fiel mir auf, dass ein wirklich umfassender Blick auf die Selbstaussagen der Bachmann sich nur ergeben kann, wenn man die Interviews als Ganzes betrachtet.
Allerdings ist auch in einem solchen Referat ein genaues Befassen mit den von mir aufgegriffenen Themenbereichen nur sehr eingeschränkt möglich. So kann dieses Referat nur ein Einblick sein, ein Anfang. Es ist nicht zu vergessen, dass man der Bachmann, die ja eben selbst fand, dass man im gesprochenen Wort hinter dem geschriebenen zurückbleibt, nicht wirklich gerecht werden kann, wenn man eine Arbeit überschreibt mit: „ Selbstaussagen der Bachmann in den Interviews“, sondern dass ihrer Ansicht nach alles, was sie über sich selbst auszusagen hat, in erster Linie in ihrem Werk zu suchen ist.
Dennoch finde ich den Einblick, den mir die Interviews geben konnten, sehr aufschlußreich. Die Interviews können nicht das Werk ersetzen, aber sie können eine Hilfe sein, eine Ergänzung.
Auch Interviews sind autobiographisches Material, und daher ist die Frage nach dem Umgang mit Interviews von Autoren eng verknüpft mit der Frage danach, inwieweit es grundsätzlich legitim ist, biographische oder autobiographische Daten heranzuziehen, wenn man sich mit einem Autor / einer Autorin auseinandersetzt. Und gerade bei Ingeborg Bachmann ist diese Frage aufgrund ihrer eigenen, sehr harten Meinung dazu, sehr interessant. Im Seminar haben wir diese Frage immer wieder gestellt und versucht, für uns selbst darauf eine Antwort zu finden. Ich selbst habe mich im Zuge dieses Referats besonders mit der Frage beschäftigt, wo die Indiskretion anfängt. Dieser Punkt ist mit Sicherheit schwer festzulegen, aber als Literaturwissenschaftler sollte man dennoch immer bemüht sein, ihn nicht zu überschreiten. Es ist mit Sicherheit eine große Hilfe, in Briefen, Interviewaufzeichnungen oder anderen persönlichen Schriften der Autoren nach Hinweisen und Äußerungen zu bestimmten Themen zu suchen, dort Bestätigung zu finden oder Verständnishilfe. Aber es darf nie der einzige Weg sein, und der Autor und sein Nachlass müssen mit Respekt und Gefühl für die Schamgrenze und die Privatsphäre des Autors betrachtet werden.
[...]
1 komplette Quellenangabe: Bachmann, Ingeborg: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews. Hg. v. Chr. Koschel und I.v.Weidebaum. München, Zürich 1983 (im Folgenden angegeben als: Koschel/Weidebaum)
2 Koschel /Weidebaum S. 64
3 Koschel /Weidebaum S. 77
4 Koschel/Weidebaum S. 59
5 Koschel /Weidebaum S. 73
6 Koschel /Weidebaum S. 88
7 Koschel/Weidebaum S.81
8 Weidebaum/Koschel S. 12
9 Koschel /Weidebaum S. 12
10 Koschel /Weidebaum S. 83
11 Koschel/Weidebaum S. 19
12 Koschel /Weidebaum S. 11
13 Koschel /Weidebaum S. 83-84
14 Koschel /Weidebaum S. 84
15 Koschel /Weidebaum S. 38
16 Koschel /Weidebaum S. 31
17 Koschel /Weidebaum S. 25
18 Koschel /Weidebaum S. 25
19 Koschel /Weidebaum S. 40
20 Koschel /Weidebaum S. 25
21 Koschel /Weidebaum S. 20
22 Koschel /Weidebaum S. 66-67
23 Koschel /Weidebaum S. 140
24 Koschel /Weidebaum S. 63
25 Koschel /Weidebaum S. 145
26 Koschel /Weidebaum S. 114
27 Koschel /Weidebaum S. 113
28 Koschel /Weidebaum S. 115
29 Koschel /Weidebaum S. 115
30 Koschel /Weidebaum S. 111
31 Koschel /Weidebaum S. 89
32 Koschel /Weidebaum S. 89-90
33 Koschel /Weidebaum S. 116
34 Koschel /Weidebaum S. 111
35 Koschel /Weidebaum S. 144
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Referat über Ingeborg Bachmann?
Dieses Referat fasst die Aussagen Ingeborg Bachmanns in verschiedenen Interviews zu ihrer Person, ihrer Arbeit und bestimmten Themenbereichen zusammen. Es beleuchtet ihre Einstellung zu Interviews, ihren Wechsel von Lyrik zu Prosa, ihre Sprachauffassung, ihre Rolle als Schriftstellerin und ihre Sicht auf die moderne Gesellschaft.
Welche Einstellung hatte Ingeborg Bachmann zu Interviews und zur Darstellung persönlicher Dinge?
Bachmann gab ungern Interviews und sprach ungern über ihr Privatleben. Sie betonte, dass das, was sie ausdrücken wollte, in ihren Werken zu finden sei und dass das Schreiben ihr eigentliches Ausdrucksmedium sei. Sie lehnte traditionelle Autobiographien ab und bevorzugte es, ihren Roman *Malina* als "imaginäre Autobiographie" zu bezeichnen, die sich auf den geistigen Prozess und nicht auf Lebensdaten konzentriert.
Was war für Ingeborg Bachmann die Bedeutung von Sprache?
Die Sprache war für Bachmann ein zentraler Punkt ihres Schaffens. Sie beschäftigte sich intensiv mit Wittgenstein und Heidegger, was ihr Werk stark beeinflusste. Sie hinterfragte ihre Sprache, arbeitete mit Worten und suchte nach "wahren Sätzen". Sie sah es als Aufgabe der Schriftsteller, Phrasen zu vermeiden und die Welt deutlich darzustellen.
Warum wechselte Ingeborg Bachmann von der Lyrik zur Prosa?
Bachmann bezeichnete diesen Wechsel als "Übersiedlung" oder "Umzug im Kopf". Sie distanzierte sich von Metaphern und Klängen und wollte überprüfen, was wirklich in den Worten steckt. Sie verdächtigte die Worte und die Sprache und wollte etwas Neues entstehen lassen.
Welche Rolle sah Ingeborg Bachmann für Schriftsteller?
Bachmann hielt die Fragestellung nach der Rolle des Schriftstellers für verkehrt. Sie betonte, dass jeder Schriftsteller seine Aufgabe selbst finden und seine Arbeit rechtfertigen muss. Sie sah es als wichtig an, die Wahrheit zu erfassen, die wahren Probleme zu erkennen und die Welt den Lesern so zu spiegeln, dass sie sie auch sehen können, wie sie ist.
Wie betrachtete Ingeborg Bachmann die moderne Gesellschaft?
Bachmann litt unter Todesangst seit ihrer Kindheit. Sie sah die Gesellschaft als Kriegsschauplatz, auf dem ein permanentes Morden stattfindet. Sie übertrug die Vorstellung des Faschismus in die zwischenmenschlichen Beziehungen und problematisierte die Vorurteile und vorgefertigten Bilder, die Menschen voneinander haben. Sie glaubte, dass Menschen aneinander vorbeireden und dass jeder allein mit seinen unübersetzten Gedanken und Gefühlen ist.
Welche Bedeutung haben die Interviews für das Verständnis von Ingeborg Bachmanns Werk?
Die Interviews können das Werk nicht ersetzen, aber sie können eine Hilfe und Ergänzung sein. Sie geben einen Einblick in Bachmanns Gedanken und Ansichten und können zum besseren Verständnis ihres Werkes beitragen. Es ist jedoch wichtig, die Interviews kritisch zu betrachten und die Privatsphäre des Autors zu respektieren.
- Quote paper
- Maren (Author), 1999, Das Selbstverständnis der Ingeborg Bachmann in Interviews, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94776