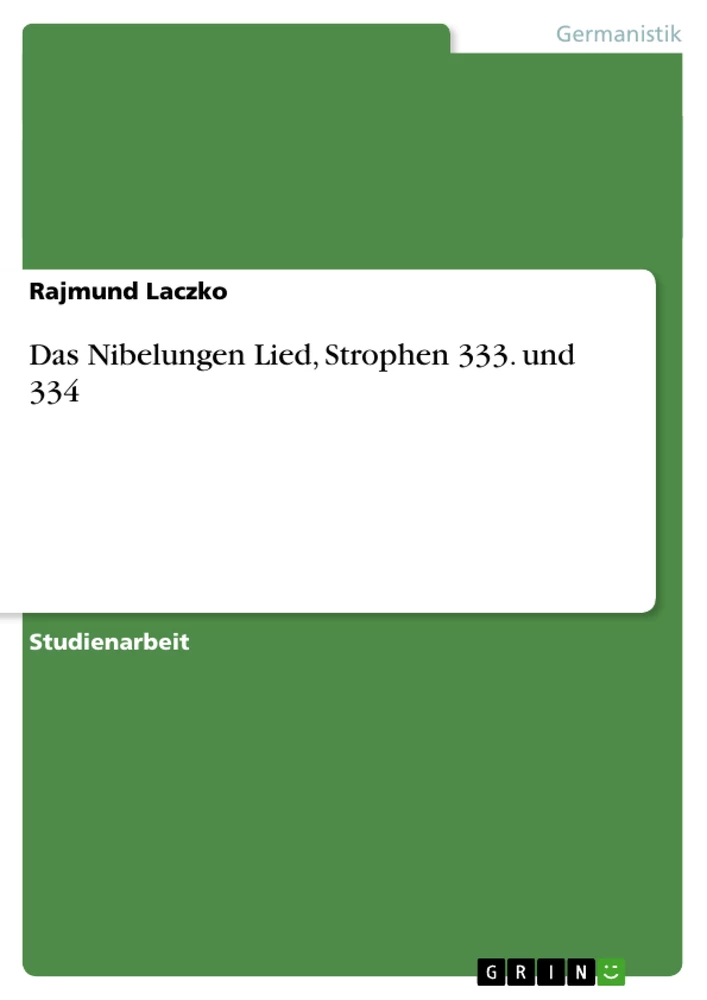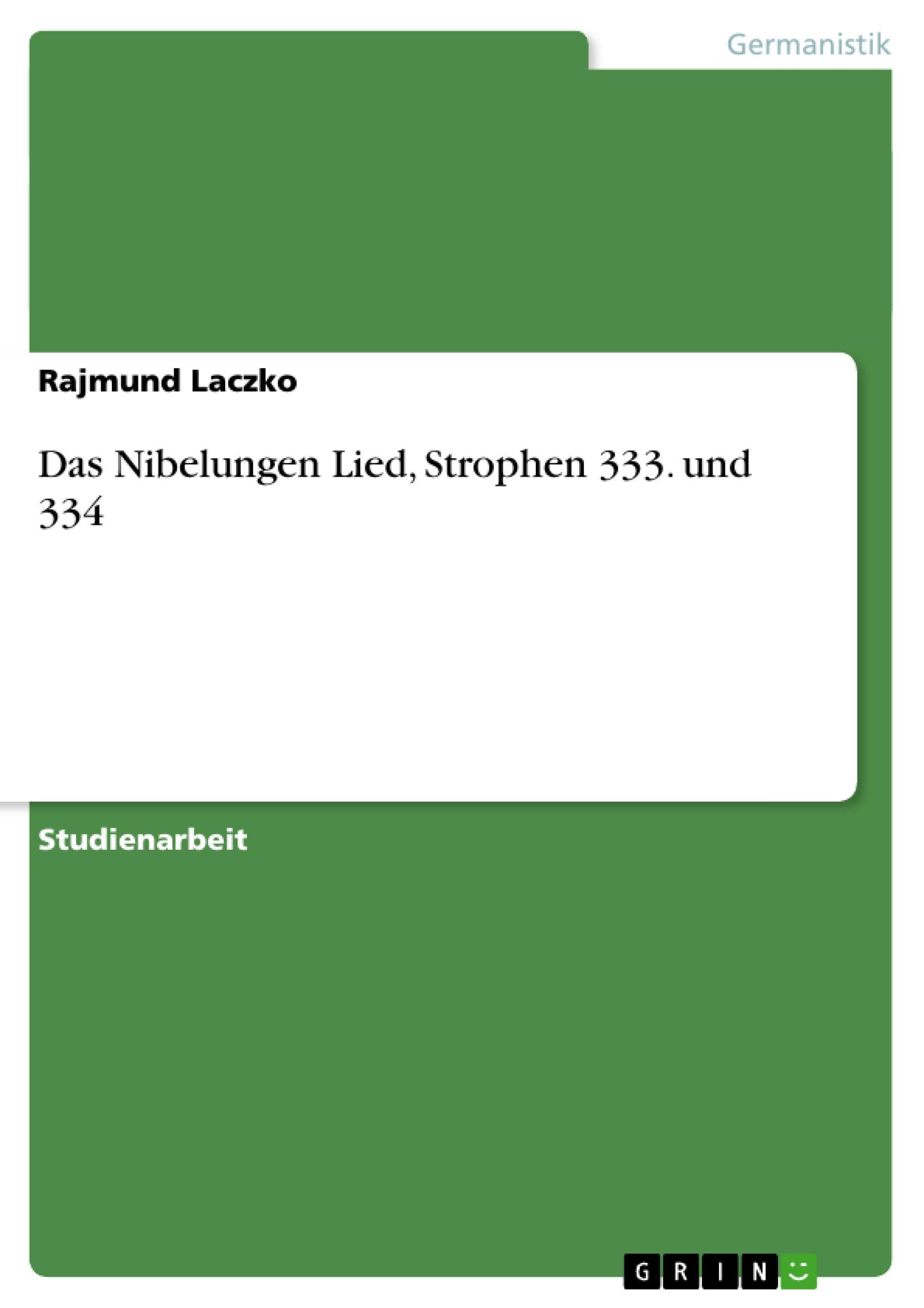Was verbirgt sich wirklich hinter den Versen des Nibelungenliedes? Tauchen Sie ein in eine faszinierende linguistische Reise, die die geheimnisvollen Strophen 333 und 334 dieses epischen Werkes in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Diese detaillierte Analyse, ideal für Germanistik-Studierende, Sprachwissenschaftler und Liebhaber der mittelhochdeutschen Literatur, seziert nicht nur den Originaltext und seine neuhochdeutsche Übertragung, sondern enthüllt auch die subtilen phonetischen und morphologischen Veränderungen, die sich über die Jahrhunderte vollzogen haben. Entdecken Sie die Entwicklung von Vokalen und Konsonanten, das Verschwinden von Archaismen und die Transformation der Grammatik, die das Mittelhochdeutsche vom modernen Deutsch trennen. Von der Diphtongierung bis zur Apokopierung, von Stammvokalwechseln bis zu Veränderungen in der Verbkonjugation – dieses Buch bietet eine umfassende Untersuchung der sprachlichen Nuancen, die das Nibelungenlied zu einem unschätzbaren Zeugnis deutscher Sprachgeschichte machen. Erhellen Sie die dunklen Ecken des mittelhochdeutschen Wortschatzes, verstehen Sie die Bedeutung von Zirkumflexen und ergründen Sie die Feinheiten der Substantivdeklination. Mit einem sorgfältigen Blick auf historische Kontexte und sprachliche Gesetzmäßigkeiten entschlüsselt diese Analyse die verborgenen Botschaften und die tiefere Bedeutung, die in den Versen des Nibelungenliedes eingeschrieben sind. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die Entwicklung der deutschen Sprache und die Meisterwerke der mittelalterlichen Literatur begeistern. Lassen Sie sich von der Präzision und dem Detailreichtum dieser Studie fesseln und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für die sprachlichen Wurzeln unserer Kultur. Dieses Buch ist mehr als nur eine Analyse; es ist eine Einladung, die Vergangenheit zu erkunden und die Schönheit der deutschen Sprache in all ihren Facetten zu entdecken. Werden Sie Zeuge, wie die alten Worte zum Leben erwachen und eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen.
Inhaltsverzeichnis:
1. Die Strophen 333. Und 334. des Nibelungen Lied
1. 1. In mittelhochdeutscher Schrift
1. 2. In neuhochdeutscher Umschrift
2. Phonetische Analyse
3. Morphologische Analyse
4. Literaturverzeichnis
1. Die Strophen 333. Und 334. des "Nibelungen Lied"
1. 1. In mittelhochdeutscher Schrift:
333.
Des antwurte Sîvrit, der Sigmundes sun:
"gîstu mir dîne swester, sô wil ich ez tuon,
die scoenen1 Kriemhilde, ein küneginne her2.
sô gér ich dehéines lônes nâch mînen arbeiten mer3.
334.
"Daz lob ich", sprach dô Gunther, "Sîvrit, an dîne hant.
und kumt diu schoene4 Prünhilt her in ditze lant,
sô wil ich dir ze wîbe mîne swester geben,
sô mahtu mit der scoenen5 immer vroelîche6 leben."
Archaismen (in der heutigen Sprache nicht mehr vorhandene Ausdrücke) im Text:
-her: entweder froh oder vornehm, heute nicht mehr vorhanden
-gér: heute heißt es verlangen, auch nicht mehr gänglich
Historismen (in der heutigen Sprache noch vorhandene, aber bereits durch anderen Formen ersetze Ausdrücke) im Text:
-lob: heute als geloben, noch im Gebrauch, aber eher durch versprechen ersetzt.
1. 2. In neuhochdeutscher Umschrift
333.
Darauf antwortete Siegfried, der Sohn von Sig(e)mund7:
"gibst du mir deine Schwester, so will ich es tun,
die schöne Kriemhilde, eine vornehme8 Königin.
so verlange ich keinen Lohn nach meinen Arbeiten9 mehr."
334.
"Das gelobe ich", sprach da Günther, "Siegfried, an deine Hand10
und11 kommt die schöne Brünhild(e) hier in dieses Land,
so will ich dir zu Weib meine Schwester geben,
so magst du mit der Schönen immer fröhlich leben."
2. Phonetische Analyse:
In der mittelhochdeutschen Rechtschreibung wurden die gedehnten Vokale durch sogennanten Zirkumflexen gekennzeichnet, ein Längezeichen auf den gedehnten Vokale wie î, ô oder â. In der neuhochdeutschen Umschrift wird es wie folgend gelöst:
1. Dehnung durch "h":
Im Text finden wir das Beispiel "mer", heute wird es so geschrieben: mehr, und lôn - Lohn, sun - Sohn.
2. Diphtongierung: ist eine Erscheinung nach der zweiten (althochdeutschen) Lautverschiebung: lange Einzelvokale (Monophtonge) entwickeln sich zu Zweilaute (Diphtonge): dîne - deine, mînen - meinen, wîbe - Weib
3. Monophtongierung: Zweilaute (Diphtonge) entwickeln sich zu langen Einzelvokalen (Monophtonge): darauf fand ich kein Beispiel.
4. Apokopierung: (Tilgung der schwachen "e" am Ende des Wortes)
küneginne - Königin
wîbe - Weib
5. Synkope: (Tilgung der schwachen "e" im Inneren des Wortes)
Das kommt im Text nicht vor.
6. Im 17/18. Jahrhundert ist ein Wechsel zwischen u und o zu beobachten:
sun - Sohn
7. Die Hauptwörter (Substantive; die deutsche Benennungen entstehen im 17. Jahrhundert) werden im Neuhochdeutschen großgeschrieben:
swester - Schwester, küneginne - Königin, arbeiten - Arbeiten, usw.
8. Mittelhochdeutsche s wird sch geschrieben im Wortanlaut vor m, n, l, w, p, und t im Rahmen der Hauptveränderungen im Konsonantismus im Spätmittelalter, zu Luthers Zeiten: swester - Schwester
9. Auch die Zusammensetzungen sc und sk werden als sch im Neuhochdeutschen realisiert: scoene - schöne
10. Konsonantenverhärtungen am Ende des Wortes finden wir bei: lant - Land, hant - Hand
11. Gemirata - die Herausbildung der Doppelkonsonanten im Spätmittelalter (1250-1450): wil - will, kumt - kommt
12. Mittelhochdeutsche z (germanische t) bleibt neuhochdeutsch in allen Positionen stimmlose s:
ez - es, daz - das
3. Morphologische Analyse
1. Stammvokalwechsel ist infolge der ersten Lautverschiebung zu merken bei: antwurte - antwortete, kumt - kommt
2. Die typische Dativendung der starken Deklination der Substantive "e" wurde im Neuhochdeutschen getilgt:
zu wîbe - zu Weib
3. Änderungen in der Verbkonjugation sind folgende:
3. 1. Im Singular des Präsens bewirken die hohen Endungsvokale "u" und "i" den Wechsel von ë > i: gëben - giben. Bei der Flexion sehen wir folgende Entwicklung:
Ein b-Schwund ist zu beobachten bei den flektierten Formen, infolge der Kontraktion: gibet - gib, gibes - gis; daraus: (du gîs - gîs du -) gîstu - gîst. Heute ist es wieder aus dem Infinitiv "geben" abgeleitet.
Das Gleiche ist bei "mahtu" auch abzuleiten.
3. 2. antwurte - antwortete
Die Präsensform des Verbes lautete mhd. antwürten, infolge des Rückumlautes bildete es die Präteritumform als antwurte. Heute ist diese Form nicht mehr vorhanden.
4. Bei der Flexion der Adjektive ist folgende Änderung zu beobachten: in mhd. Flexion, Nominativ Singular aller drei Geschlechter und Akkusativ Singular Neutral gibt es eine Endung -e, sonst in sämtlichen Kasus und im gesamten Plural -en, -(e)n, wie z. B.: die scoenen Kriemhilde - die schöne Kriemhilde
4. Literaturverzeichnis:
- Das Nibelungen Lied. Hrsg: Helmut De Boor. F. A. Brockhaus Wiesbaden 1972.
- Dr. Müller József: Mittelhochdeutsche Texte mit Erläuterungen. Tankönyvkiadó Budapest 1985.
- Heinz Mettke: Mittelhochdeutsche Grammatik. VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1970.
[...]
1 die Buchstaben "oe" sollten zusammengeschrieben werden.
2 das Dehnungszeichen auf der "e" sollte verkehrt stehen, aber ich habe sowas am PC nicht gefunden.
3 siehe Fußnote 2.
4 siehe Fußnote 1.
5 siehe Fußnote 1.
6 siehe Fußnote 1.
7 ich fand beide Schreibvarianten in dem Nachnamenbuch.
8 Das Nibelungen Lied in der Ausgabe F. A. Brockhaus, Wiesbaden 1972 gibt die Neuschrift auf das Wort "her" als "froh". Das Buch "Mittelhochdeutsche Texte mit Erläuterungen" von Dr. József Müller aber gibt die Neuschrift als "vornehme". Von dem Text ausgehend entschied ich mich für die letzte Möglichkeit.
9 Nach dem Buch Das Nibelungen Lied in der Ausgabe F. A. Brockhaus, Wiesbaden 1972 steht dafür heute: für meine Mühe
10 Nach dem Buch Das Nibelungen Lied in der Ausgabe F. A. Brockhaus, Wiesbaden 1972 interpretiert man die Wörter "an deine Hand" als "dir in die Hand"
Häufig gestellte Fragen zum Nibelungenlied
Was ist der Inhalt der Strophen 333 und 334 des Nibelungenliedes?
Die Strophen 333 und 334 des Nibelungenliedes beinhalten einen Dialog zwischen Siegfried und Gunther. Siegfried bietet seine Hilfe an und bittet im Gegenzug um Gunthers Schwester Kriemhilde zur Frau. Gunther willigt ein, unter der Bedingung, dass Siegfried ihm bei der Werbung um Brünhild(e) hilft.
Was sind Archaismen und Historismen in den Strophen 333 und 334?
Archaismen sind Wörter, die in der heutigen Sprache nicht mehr verwendet werden. Im Text sind Beispiele "her" (entweder froh oder vornehm) und "gér" (verlangen). Historismen sind Wörter, die noch vorhanden sind, aber durch andere Ausdrücke ersetzt wurden. Ein Beispiel ist "lob" (geloben), das heute eher durch "versprechen" ersetzt wird.
Was sind die Hauptpunkte der phonetischen Analyse der Strophen?
Die phonetische Analyse umfasst: Kennzeichnung gedehnter Vokale durch Zirkumflexe, Dehnung durch "h" (z.B. mer -> mehr), Diphtongierung (lange Einzelvokale entwickeln sich zu Zweilauten, z.B. dîne -> deine), Apokopierung (Tilgung des schwachen "e" am Ende des Wortes, z.B. küneginne -> Königin), Wechsel zwischen u und o (z.B. sun -> Sohn), Großschreibung von Hauptwörtern, Veränderungen von mittelhochdeutsch "s" zu "sch" im Wortanlaut, Verhärtungen von Konsonanten am Wortende (z.B. lant -> Land), Geminata (Herausbildung von Doppelkonsonanten, z.B. wil -> will) und die Beibehaltung von mittelhochdeutsch "z" als stimmloses "s" (z.B. ez -> es).
Was sind die Hauptpunkte der morphologischen Analyse der Strophen?
Die morphologische Analyse umfasst Stammvokalwechsel (z.B. antwurte -> antwortete), Tilgung der Dativendung "-e" bei starken Substantiven (z.B. zu wîbe -> zu Weib), und Änderungen in der Verbkonjugation (z.B. gëben -> giben, gîstu -> gîst). Die Analyse geht auch auf die Flexion von Adjektiven und hier speziell auf Nominativ Singular Endungen ein.
Welche Literatur wird für die Analyse des Nibelungenliedes verwendet?
Folgende Literatur wird verwendet: Das Nibelungen Lied (Hrsg: Helmut De Boor), Mittelhochdeutsche Texte mit Erläuterungen (Dr. Müller József), Mittelhochdeutsche Grammatik (Heinz Mettke).
- Quote paper
- Rajmund Laczko (Author), 1997, Das Nibelungen Lied, Strophen 333. und 334, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94770