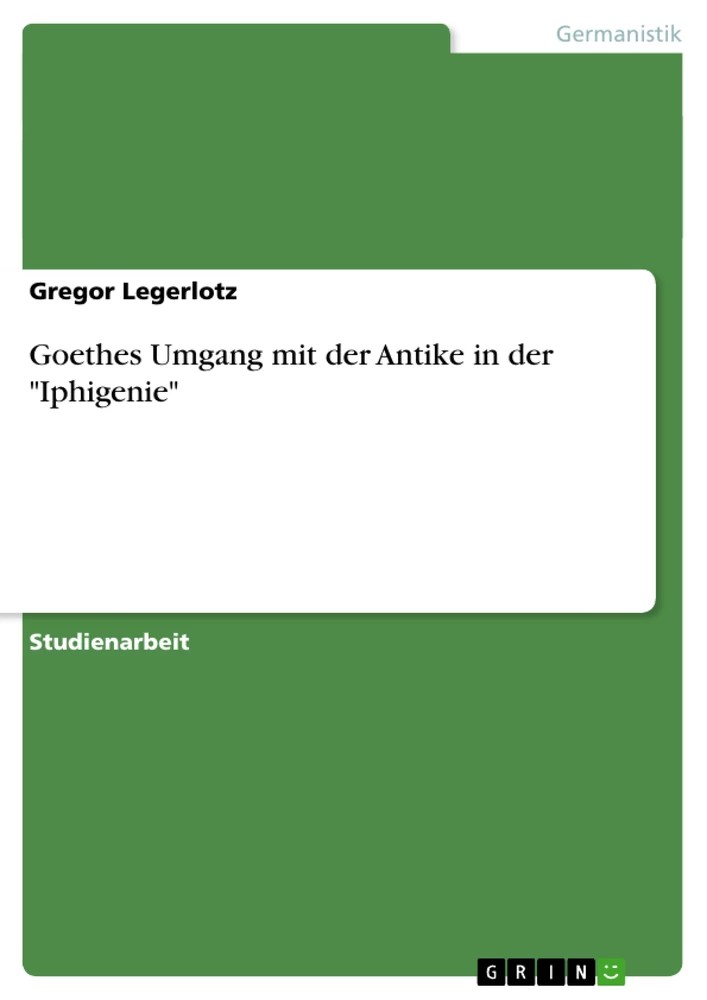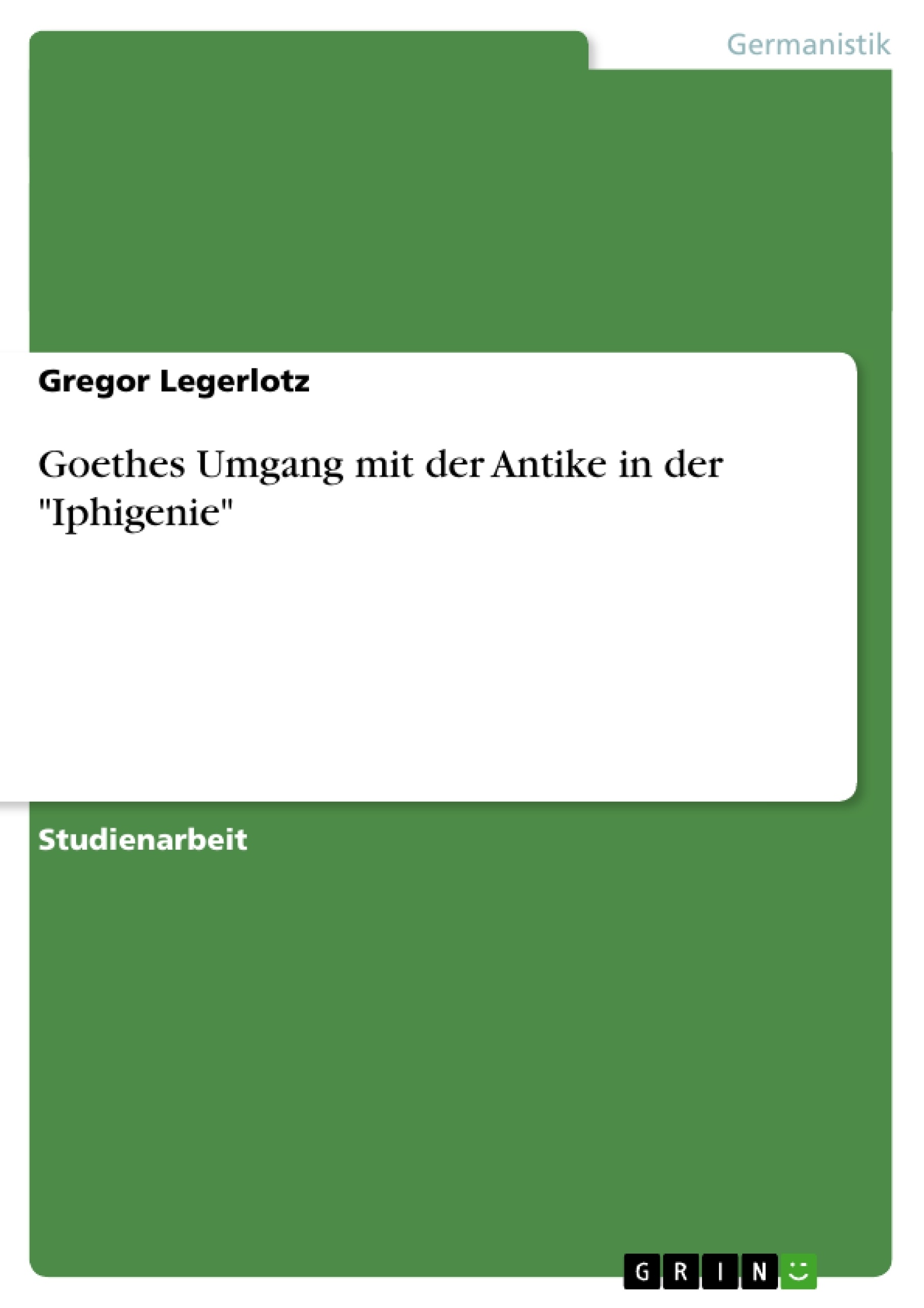Goethes Euripidesvorlage als Zeugnis der antiken Kultur: Thematische Eingrenzung
Wenn man sich mit dem Thema "Goethes Umgang mit der Antike in der ‘Iphigenie’"
befaßt, so läuft man schnell Gefahr, das Augenmerk zuerst auf Antike im Titel zu lenken.
Sicher liegt dies nahe: Goethes Vorlage für seine Bearbeitung des Stoffs, der den
Tantalidenmythos thematisiert, war eins der beiden Iphigeniendramen des Euripides,
dt.: Iphigenie bei den Taurern.
Es geht aber nicht primär um die Antike, sondern um den Umgang damit. Die Arbeit
wird sich daher nicht mit der Antike selbst befassen. Es muß also um das Aufzeigen von
Veränderungen gehen, denn "[es] kann kein Zweifel darüber herrschen, daß sich beide
Werke in ihrer dramatischen Auffassung sehr voneinander unterscheiden." Umgangim
Sinne des Themas ließe sich also mit gezielte Veränderungen paraphrasieren. Der
Umgang mit der Antike wird in der Arbeit kategorisiert. Zuvor sei noch dargelegt, in
welchem Sinne der Antike - Begriff gemeint ist. Dieser steht mit seiner Vielfalt und
Weitläufigkeit der Spezifität des Themas entgegen und muß daher konkretisiert werden.
Aufgrund des großen Zeitabstandes zwischen der Euripideischen Vorlage und der
Bearbeitung des Stoffs durch Goethe zeichnet den Umgang mit Antike immer ein
"ungenügendes Verständnis für antike Realien und Gedankengänge" aus. Die Aussagen
über Antike werden daher unter der Prämisse getroffen, daß das Stück von Euripides
ein Zeugnis der griechischen Kultur ist. Kultur soll in diesem eingeschränkten
Zusammenhang als Interdependenz von Literatur und Gesellschaft verstanden werden.
Die Kategorisierung soll unter folgenden Gesichtspunkten vorgenommen werden:
1. Abweichungen von Euripides
2. Der Einfluß von Goethes religiösen Vorstellungen
3. Goethes Umdeutung der Vorlage im Sinne des Autonomiegedankens
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Goethes Euripidesvorlage als Zeugnis der antiken Kultur: Thematische Eingrenzung
- Kategorien des Umgangs mit der Antike in der "Iphigenie"
- Abweichungen von Euripides
- Bedeutung des Mythos in den beiden Versionen
- Die Figuren
- Die Götternamen
- Die Form
- Der Einfluß von Goethes religiösen Vorstellungen auf den Umgang mit der Antike
- Goethes Umdeutung der Vorlage im Sinne des Autonomiegedankens
- Die Autonomie auf der Ebene des Mythos
- Die Autonomie auf der Ebene der Figuren
- Iphigenie und der König
- Schuld und Sühne des Orest
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Goethes "Iphigenie auf Tauris" im Hinblick auf den Umgang des Autors mit der Antike. Sie analysiert die Veränderungen, die Goethe an seiner Euripidesvorlage vorgenommen hat, und beleuchtet den Einfluss seiner eigenen religiösen Vorstellungen und des Autonomiegedankens auf die Interpretation des antiken Stoffes.
- Untersuchung der Abweichungen von Euripides' "Iphigenie bei den Taurern"
- Analyse der Bedeutung des Mythos und seiner Interpretation in beiden Versionen
- Beurteilung des Einflusses von Goethes religiösen Ideen auf die Darstellung der Antike
- Interpretation von Goethes Umdeutung der Vorlage im Hinblick auf den Autonomiegedanken
- Analyse der Figuren und ihrer Bedeutung im Kontext der antiken und modernen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Goethes "Iphigenie auf Tauris" als eine Bearbeitung des antiken Stoffes vor und grenzt das Thema der Arbeit ein. Sie untersucht den "Umgang" mit der Antike als gezielte Veränderung der Euripidesvorlage.
Das zweite Kapitel kategorisiert die Abweichungen von Euripides' "Iphigenie bei den Taurern" in Goethes Stück. Es beleuchtet die Unterschiede in Bezug auf die Bedeutung des Mythos, die Gestaltung der Figuren und die Verwendung von Götternamen und Form.
Schlüsselwörter
Goethe, Iphigenie auf Tauris, Euripides, Antike, Mythos, Religiöse Vorstellungen, Autonomiegedanke, Figuren, Kultur, Tragödie, Abweichungen, Umdeutung, Interpretation, Vergleich.
- Quote paper
- Gregor Legerlotz (Author), 1997, Goethes Umgang mit der Antike in der "Iphigenie", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94767