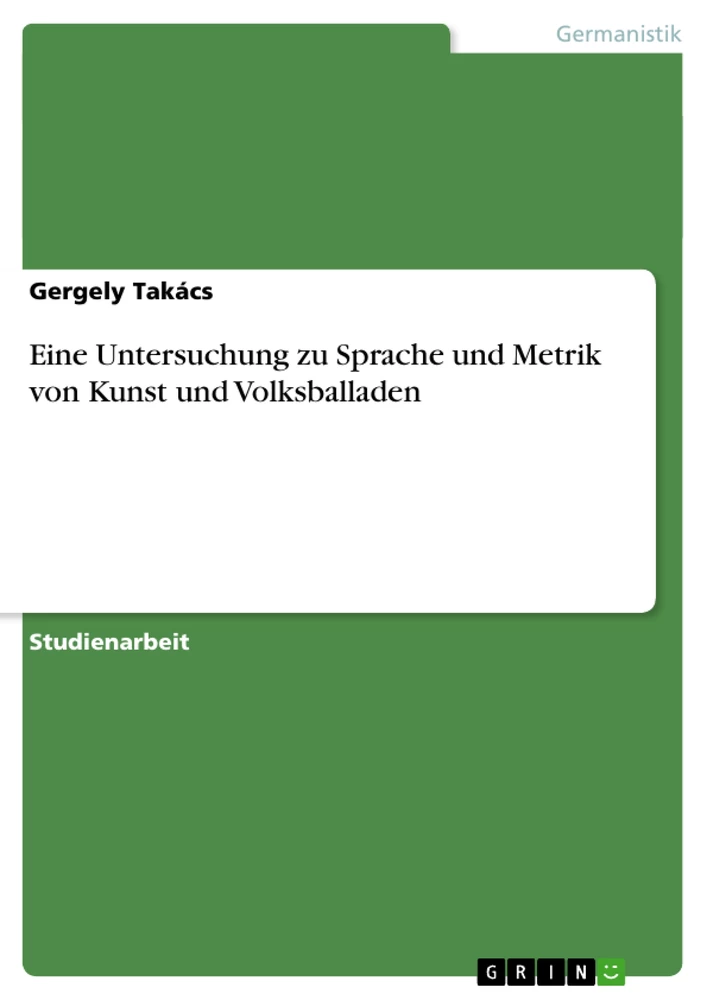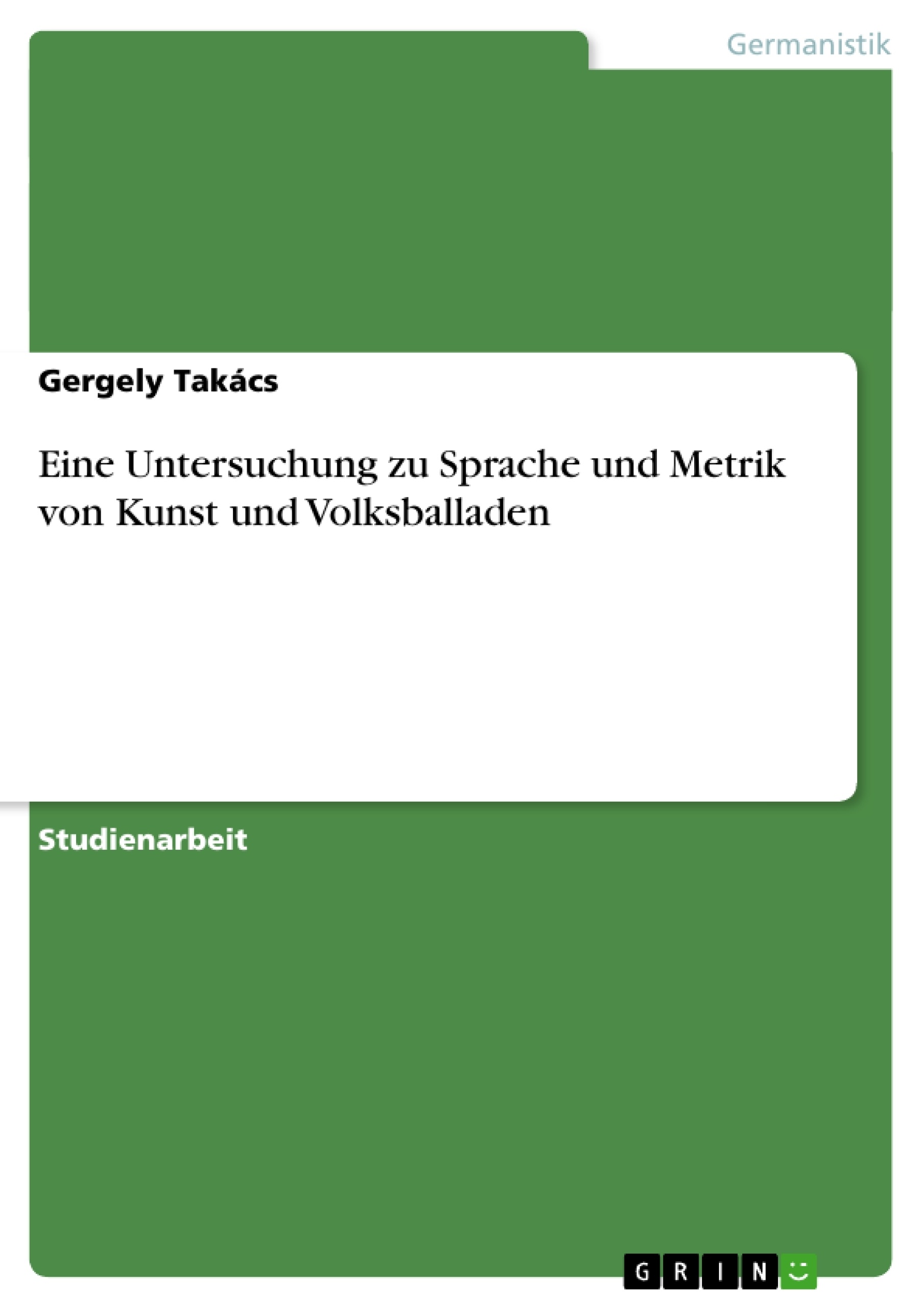Da schon bei der Definition der Ballade nicht klar entschieden werden kann, um welche Gattung der Ballade es sich handelt, ob die Kunstballade oder die Volksballade definiert wird, möchte ich in meiner Arbeit zeigen, daß die Kunstballade, trotz ihrer Volksnähe charakteristische Züge trägt, an denen sie eindeutig von der Volksballade unterschieden und definiert werden kann.
Dies werde ich anhand der sprachlichen und metrischen Begebenheiten der Kunstballade "Der Untreue Knabe" und der Volksballade "Das Lied vom Herren und der Magd." zeigen. Was die gattungsspezifische Merkmale angeht, so werde ich mich weitestgehend auf Gottfried Weißerts Monographie zur "Ballade" aus der Sammlung Metzler und auf das "Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte" stützen.
Inhaltsverzeichnis
0. Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Kunstballade
2.1 "Der Untreue Knabe"
3. Die Volksballade
3.1 "Das Lied vom Herren und der Magd"
4. Schlußbemerkung
5. Literaturverzeichnis
6. Anhang
1. Einleitung
Das, im Deutschen verwendete Wort Ballade ist, in der Bedeutung von Tanzlied seit dem 16. Jh. belegt. Das Wort Ballade "ist dem Französischen entlehnt, abgeleitet aus dem provencalischen "ballade", das wiederum dem italienischen "ballata" entstammt und von dem Verb "ballare" (tanzen) abgeleitet ist."1 Durchgesetzt hat sich im deutschen Sprachraum hingegen, der Begriff der Ballade, welcher aus dem Englischen stammt und "eine volkstümliche Erzählung in Liedform bedeutet."2
Gegenstand der Ballade ist meistens menschliches Schicksal, das in einer entscheidenden Wendung erfaßt wird. Das Handeln der Ballade ist auf Konflikt (meist tragisch) und Lösung hin ausgerichtet. Die unmittelbare Darstellung, das Vorhandensein von Dialogen und die Ausrichtung auf den Konflikt könnten darauf schließen lassen, daßdie Gattung Ballade dramatisch sei. Auf das epische Charakter ließe sich durch das Erzählen, auf das lyrische durch die Behandlung des Themas und durch die lyrischen Mitteln schließen. Weitere Merkmale, die zum Balladentypus gehören sind "thematisch die Vorliebe für das Ungewöhnliche, Extreme und Schaurige, formal die Vorliebe für strophische Gliederung [...], sprachlich die Verwendung einer sinnlich prägnanten, oft volkstümlichen oder archaisierenden Wortschicht, vor allem, wo (seit Herder) die Volksballade stilistisches Vorbild ist."
Die drei Grundgattungen der Dichtkunst sind hier vertreten. Goethe hat in der Ballade das "Ur-Ei" der Dichtung gesehen.
"[...] Übrigens ließe sich an einer Auswahl solcher Gedichte die ganze Poetik gar vortragen, weil hier die Elemente noch nicht getrennt, sondern wie in einem lebendigen Ur-Ei zusammen sind [...] (Kunst und Altertum II, 1 1821)"3 Goethe stand hier noch unter Herderscher Einfluß, "[...], der glaubte, gerade in diesen balladenhaften Formen der Volkspoesie Urformen menschlicher Poesie entdeckt zu haben, [...]"4
Da schon bei der Definition der Ballade nicht klar entschieden werden kann, um welche Gattung der Ballade es sich handelt, ob die Kunstballade oder die Volksballade definiert wird, möchte ich in meiner Arbeit zeigen, daßdie Kunstballade, trotz ihrer Volksnähe charakteristische Züge trägt, an denen sie eindeutig von der Volksballade unterschieden und definiert werden kann.
Dies werde ich anhand der sprachlichen und metrischen Begebenheiten der Kunstballade "Der Untreue Knabe" und der Volksballade "Das Lied vom Herren und der Magd." zeigen.
Was die gattungsspezifische Merkmale angeht, so werde ich mich weitestgehend auf Gottfried Weißerts Monographie zur "Ballade" aus der Sammlung Metzler und auf das "Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte" stützen.
2. Die Kunstballade
Die Erscheinung von Percys "Reliques of Ancient Poetry" (1765) löste in Deutschland die Sammlertätigkeit nach einheimischen Volksliedern aus. Auch Goethe sammelte Volksballaden und veröffentlichte 1771 die, im Elsaßgefundenen 12 Balladen aus mündlicher Überlieferung. Seine anfängliche Kunstballaden basieren auf die, aus der eigenen Sammlung stammenden Volksballaden.
Die Kunstballade "[...] hat keine feste strophische Form oder metrische Form zur Voraussetzung [...]", aber "die Gliederung der Ballade in gleiche Strophen ist die Regel". Die hier behandelten Kunstballaden haben zu eigen, daßsie sehr stark versuchen an die Gattung Volksballade möglichst nahe heranzukommen. Hier ergibt sich ein Definitionsproblem, ob die Volksballaden tatsächlich vom Volk geschaffen wurden oder durch die Zersingung einer bereits vorhandenen Ballade ihren volkstümlichen Charakter gewannen. Dieses Problem werde ich im folgendem Kapitel, in dem der Volksballade klären.
Außer der vierzeiligen "Chevy-Chase" Strophe wird der Ballade keine Strophenform zugesprochen.
Bei Goethe ist aber ein Formenreichtum zu beobachten. Die von ihm oft verwendete "siebenzeilige Lutherstrophe5 " ist auch in seiner Kunstballade "Der untreue Knabe" vorzufinden.
Die Kunstballade hat die Volksballade als Vorlage, so haben die volkstümliche Sprache, der Stil und das aus volkseigenen geschöpfte Thema auch die Funktion, ebenfalls das Volk als Rezipient anzuzielen.
2.1 "Der Untreue Knabe"
Diese Ballade hat meines Erachtens möglicherweise drei Volksballaden aus Goethes Sammlung als Grundlage. Diese sind "Das Lied vom Herren und der Magd", "Das Lied vom eifersüchtigen Knaben" und "Das Lied vom iungen Grafen"6. Von diesen drei Balladen werde ich im späteren "Das Lied vom Herren und der Magd" behandeln, weil mir diese als am meisten geeignete Ballade als Vorlage für die behandelte Kunstballade erscheint.
Volkstümlich wird hier die Sprache verwendet und auch die Themenwahl basiert auf Volksballaden. Der Anfang:
Es war ein Buhle frech genung ist charakteristisch für die Gattung Volksballade.
Die gattungsspezifische Merkmale der Volksballade werde ich im später erläutern. Die metrische Ordnung dieser Kunstballade ist der erste Ansatzpunkt für ihre Differenzierung von der Gattung Volksballade.
Die Ballade ist streng jambisch geordnet mit wechselnd männlicher bzw. weiblicher Kadenz. Der Kreuz- bzw. Paarreim ist durch die ganze Ballade verwirklicht, er bestimmt z.B.: in der 6. Zeile die Kadenz. In der folgenden Tabelle ist die metrische Ordnung der Ballade aufgeführt, welche sich auf die ganze Ballade übertragen läßt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten7
Diese Kadenzabweichung deutet auf die strenge Komposition der Ballade hin, welche bei Volksballaden nicht vorzufinden ist. In der Volksballade wird zur Betonung des Ausgesagten die Wiederholung verwendet, hier dafür ein anderes literarisches Mittel, nämlich die Tautologie8.
9 Es blitzt und donnert, stürmt und kracht
Die Verwendung des Irrationalen, das in der Sturm und Drang Epoche als volkstümlich geglaubt wurde ist ein nächster Ansatzpunkt zur Unterscheidung. In der zugrunde liegenden Volksballade ist keine Irrationalität vorzufinden. Die Kunstballade führt dagegen zugleich mehrere Motive auf, die als irrational gelten. "Der untreue Knabe" fühlt den Moment, in dem das Mädel stirbt. Seine Reaktion wird in dem "Totenritt"10 beschrieben.
Er gab die Sporen kreuz und queer
Und ritt auf alle Seiten,
Herüber, `nüber, hin und her,
Kann keine Ruh' erreiten;
Reit sieben Tag und sieben Nacht:
Es blizt und donnert, stürmt und kracht,
Die Fluthen reißen über.
(Strophe 3)
Dieses Motiv des "Totenritts" wird später bei den Romantikern oft verwendet. Goethe widmet eine ganze Strophe diesem Ritt, um die Stimmung und den Gemütszustand des Knaben darzustellen und auch den Leser emotional zu berühren.
Die Verwendung der Naturelemente ist ebenfalls ein typisches Mittel um volksnahe Stücke zu schaffen, sie werden hier als Symbol verwendet. Die Verwendung der Symbolik diesen Grades zum Ausdruck von Emotionen ist im Falle der Volksballade nicht charakteristisch. Dialoge, wie bei Volksballaden typisch sind von Goethe weggelassen worden, die Vergegenwärtigung und die Ausrichtung auf das Ende hin werden von der Erzählung übernommen, aber die Unmittelbarkeit geht dadurch verloren und die volkstümliche Erzählung wird wesentlich erschwert.
Balladentypologisch möchte ich diese Ballade nicht eindeutig einordnen, aber am nächst liegen die natur- und die totenmagische Balladentypen. Hier ist der Wiedergängermotiv nicht vorhanden, weil der Knabe von einer nicht benannten Kraft zu einem Ort "gezogen" wird, wo er dann nach einem Sturz von "drei Lichtlein" zu dem verstorbenen Mädchen geführt wird, das in einem hohen Saal "mit weisen Tüchern angethan" mitten einer Gruppe von Gästen bereits auf ihn wartet um ein Fest zu feiern. Wahrscheinlich das Fest ihrer Vermählung, mit welchem der Knabe am Anfang der Ballade das Mädel verführt hatte.
Als Bräutigam herumgescherzt;
(Z. 6, Strophe 1)
Auch das Motiv der "Höhle" ist für naturmagische Balladen typisch.
Auf einmal steht er hoch im Saal
(Z. 1, Strophe 6)
Die volkstümliche Sprache wird durch den künstlerischen Gebrauch eindeutig unterscheidbar von Volksballaden. Die Emotionale Rührung des Leser erfolgt nicht durch direkte Aussagen oder durch den volksballadentypischen sog. "incremental repetition"11, also durch die Wiederholung und Steigerung - obwohl die Steigerung hier verwendet wird, sehe ich diese Form der Steigerung z.B.: die Tautologie, als eher künstlerisches Mittel an - sondern durch die verdeckte Sprache der Lyrik.
Es ist diese Art der Symbolverwendung, die Goethes frühe Balladen trotz aller Einfachheit der Sprache und Motivverwandtschaft deutlich von der Volksballade unterscheiden.
3. Die Volksballade
Hier möchte ich die Frage des Erschaffers einer Volksballade klären. Bis zum 20 Jh. haben sich zwei Schulen gehalten. Die eine Schule vertrat die Ansicht vom kollektiven Ursprung. Dieser Meinung nach soll die Volksballade spontan, bei den üblichen Tätigkeiten des Volkes entstanden sein. Die andere Schule vertritt die Meinung des "individual autorship"12.
"Nach der heutigen Anschauung besitzen die V.n wie jedes Volkslied einen Verfasser und eine ,Ursprungsform`. [...]"13
Dieser Meinung schließe ich mich an und möchte sie auch durch die metrischen Begebenheiten der Volksballade "Das Lied vom Herren und der Magd" unterstützen.
3.1 "Das Lied vom Herren und der Magd"
Die Ballade beginnt mit dem volksballadentypischen Anfang "Es war [...]"14, der auch für rein erzählende Volkstexte charakteristisch ist.
Die Annahme, die Volksballade sei von einem einzelnen Autor geschaffen worden läßt sich durch die Untersuchung der metrischen und sprachlichen Eigenschaften dieser Ballade unterstützen. Gleichzeitig findet auch meine Annahme Unterstützung, die Volksballade von der Kunstballade eindeutig unterscheiden zu können.
Diese Ballade ist metrisch geordnet, die jambische Ordnung ist aber infolge der Zersingung nicht mehr durchgehend erhalten. Die verwendete Strophenform ist die "Volksliedstrophe" (vierzeiler), welche durch abwechselnde Kadenz gekennzeichnet ist.
Die abwechselnd männliche und weibliche Kadenz wird aber an den Ausnahmestellen der jambischen Ordnung durch halbe Jamben oder Trochäen verletzt. z.B.: Z. 3515
V- V- - V -V -
Wir schickens dem rechten Vater heim,
Das Fehlen einer reinen Reimordnung und der stellenweise verwendete Kehrreim verstärken den volkstümlichen Charakter. Die einfache szenische Struktur und der große textliche Umfang gegenüber der behandelten Kunstballade, welcher über die Erzählung auf das Ende ausgerichtet wurde, erfordern hier das Dialog. Im Dialog wird hier teils auch der Gefühlsausdruck verwirklicht, welches nur durch die Rahmenerzählung in der ersten, der elften und der letzen Strophe unterbrochen wird. Den volkstümlichen Erzählcharakter unterstützt auch die verwendete "Ich-Form", die in der behandelten Kunstballade fehlt. Und als ich kam nach Werthelstein
(Z. 1, Strophe 5)
Als Gegenstand der Ballade ist das menschliche Schicksal gewählt worden, hier das volkstümliche Motiv des untreuen Geliebten, aber die Irrationalität, die in der Kunstballade volkstümlich geglaubt wurde, wird nicht verwendet. Der edle Herr erfährt über das Brief der Magd über ihren Tod. Auch der Ort wird nicht mystifiziert, der Ritt des Herren wird in zwei Versen beschrieben, zwar ist er hier durch ein Metapher ersetzt, eine wesentliche Bedeutung jedoch gewinnt er nicht.
Er flog wohl über Stock und Stiel
Wie Vögel unterm Himmel
(Z. 3-4, Strophe 12)
In der 14. Strophe findet die "Begegnung" mit der toten Magd statt, aber im Gegensatz zu der Kunstballade auf realer Ebene, der Herr wird nicht "irregeführt"16, er betrachtet die Leiche und setzt aus eigenem Entschlußseinem Leben ein Ende.
Er zog ein Messer aus seinem Sack
Und stach sich selber ins Herze,
Hast du gelitten den bittern Todt
So will ich leiden Schmerzen
(Strophe 15.)
In der Volksballade erfolgen klare Aussagen und der Gefühlsausdruck ist direkt erkennbar. Der einfache Sprachgebrauch wird zwar an manchen Stellen von künstlerischen Mitteln in eine "höhere Sprache" versetzt, aber die Auffassung der frühen Kunstballadendichter über das "Kindesverstand des Volkes" findet hier keine Unterstützung, weil einige Stellen in der Ballade, entgegen der Tatsache, daßdas Volk nur das zum Verständnis nötige weitergibt und erzählt, trotz der Zersingung höchstwahrscheinlich gegenüber ihrer ursprünglichen Form unverändert geblieben sind.
4. Schlußbemerkung
Wie dieser Vergleich gezeigt hat, waren die Kunstballadendichter, so auch Goethe, bemüht ihren Werken eine gewisse Volkstümlichkeit, Volksnähe zu geben. Wie diese Volkstümlichkeit aussieht habe ich versucht in meiner Arbeit zu darzulegen.
Der Versuch volkstümliche Motive und Sprache zu übernehmen ist bei Goethe an der fußmetrischen Regulierung und am Aufgehen der Handlung in der Symbolverwendung, gegenüber der einfachen Symbolverwendung der Volksballade, gescheitert. Zwar haben die angewandten Wort- und Satzverkürzungen und der Rückgriff auf die typischen Phrasen und Motive der Volksballade die erwünschte Volksnähe fast erreicht, aber die verschiedenen dichterischen "Unzulänglichkeiten" haben es nicht ermöglicht eine richtige Volksballade zu schaffen. Diese Merkmale geben mir Anlaßzur Annahme, daßKunstballaden, auch in anderen Epochen, von Volksballaden meistens deutlich unterschieden werden können.
5. Literaturverzeichnis
1. Primärliteratur
Goethe, Johann Wolfgang von: Der junge Goethe, Hrsg. von Hanna Fischer-Lamberg,
Bände II und IV-; Berlin 1963 und 1968
2. Sekundärliteratur
Weißert, Gottfried: Ballade; Sammlung Metzler - Band 192; 2. überarbeitete Aufl., 1993 Stuttgart, Weimar
Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur, S. 1007 ff., Stichwort: Volksballade 7. Verbesserte, erweiterte Aufl., Alfred Kröner Verlag, 1989 Stuttgart
Wagenknecht, Christian: Deutsche Metrik - Eine historische Einführung,
3. Durchgesehene Aufl., 1993 München, Verlag C.H. Beck
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte I-IV, Walther de Gruyter, Berlin - New York 1984
Band 1. S. 902 ff., Stichwort: Kunstballade
Band 2. S. 723 ff., Stichwort: Volksballade
Anhang
[...]
1 Gottfried Weißert - Ballade, S. 1., Sammlung Metzler Band 192, 2. überarbeitete Aufl., Stuttgart 1993 (des Weiteren nenne ich nur den Titel, wenn ich mich auf dieses Buch beziehen will)
2 ebd.
3 Ballade, S. 5
4 ebd.
5 Wagenknecht, Christian - Deutsche Metrik, C.H. Beck Studium, 3. Durchgesehene Aufl. 1993 Göttingen
6 Siehe Anhang
7 Siehe Anhang, "Der untreue Knabe", 1. Strophe
8 Tau·to·lo·gie w.11 Bezeichnung derselben Sache durch mehrere Ausdrücke, z.B. alter Greis, schon bereits
9 Siehe Anhang, "Der untreue Knabe", 3. Strophe, Z. 6
10 Ballade, S. 30 f.
11 Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, Band 2. S. 723.
12 Ebd. S. 725 f.
13 Ebd. S. 726.
14 Siehe Anhang
15 Siehe Anhang
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Dieser Text ist eine vergleichende Analyse von Kunstballaden und Volksballaden, speziell untersucht anhand von Goethes "Der Untreue Knabe" als Beispiel für eine Kunstballade und "Das Lied vom Herren und der Magd" als Beispiel für eine Volksballade.
Was ist eine Ballade laut diesem Text?
Eine Ballade wird hier als eine volkstümliche Erzählung in Liedform beschrieben, die meistens menschliches Schicksal in einer entscheidenden Wendung erfasst. Sie vereint Elemente der Epik, Lyrik und Dramatik.
Was sind die Hauptmerkmale einer Kunstballade, wie sie hier definiert wird?
Die Kunstballade wird durch eine bewusste stilistische Gestaltung, oft volkstümliche Sprache und Themenwahl, aber auch durch eine strenge metrische Ordnung und Komposition gekennzeichnet. Im Vergleich zur Volksballade werden hier auch irrationale Elemente und Symbolik eingesetzt.
Was sind die Hauptmerkmale einer Volksballade, wie sie hier definiert wird?
Die Volksballade zeichnet sich durch eine volkstümliche Sprache, einfache szenische Struktur und Dialoge aus. Metrisch ist sie oft weniger streng geordnet als die Kunstballade und kann Unregelmäßigkeiten aufgrund mündlicher Überlieferung aufweisen. Sie vermeidet die Irrationalität der Kunstballade und stellt Ereignisse realistischer dar.
Welche Werke werden in diesem Text analysiert?
Die Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf Johann Wolfgang von Goethes Kunstballade "Der Untreue Knabe" und die Volksballade "Das Lied vom Herren und der Magd".
Welche literaturwissenschaftlichen Ansätze werden in diesem Text verwendet?
Der Text stützt sich auf Gottfried Weißerts Monographie zur "Ballade" und das "Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte". Es werden sprachliche, metrische und inhaltliche Aspekte der Balladen untersucht, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.
Was ist die Hauptthese dieses Textes?
Die Hauptthese ist, dass die Kunstballade trotz ihrer Volksnähe charakteristische Züge trägt, anhand derer sie eindeutig von der Volksballade unterschieden und definiert werden kann. Dies wird durch sprachliche und metrische Analysen der beiden ausgewählten Balladen belegt.
Welche Rolle spielt Goethe in Bezug auf die Balladenforschung in diesem Text?
Goethe wird als Sammler und Dichter von Balladen dargestellt, dessen frühe Kunstballaden stark von Volksballaden beeinflusst waren. Der Text untersucht, wie Goethe versuchte, Volkstümlichkeit in seine Kunstballaden zu integrieren, und warum ihm dies nicht vollständig gelang.
Was wird im Schlußteil des Textes zusammengefasst?
Der Schlußteil fasst zusammen, dass die Kunstballadendichter, einschließlich Goethe, bemüht waren, ihren Werken Volkstümlichkeit zu verleihen. Es wird argumentiert, dass Goethes Versuch durch die fußmetrische Regulierung und die stärkere Symbolverwendung gescheitert ist, was zu einer deutlichen Unterscheidung von Volksballaden führt.
- Quote paper
- Gergely Takács (Author), 1999, Eine Untersuchung zu Sprache und Metrik von Kunst und Volksballaden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94757