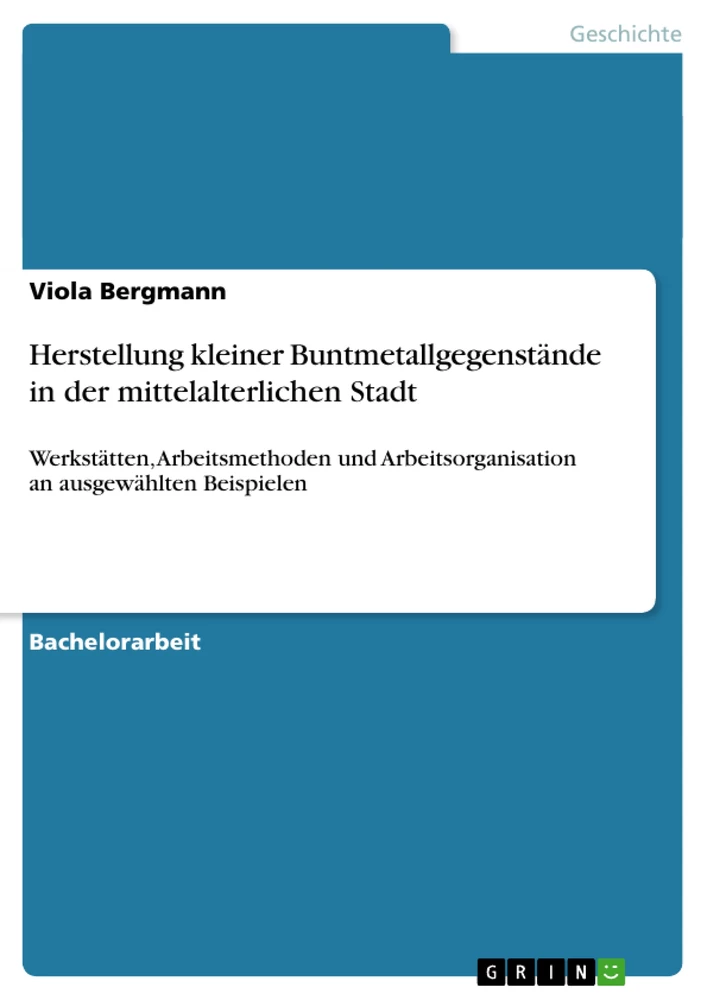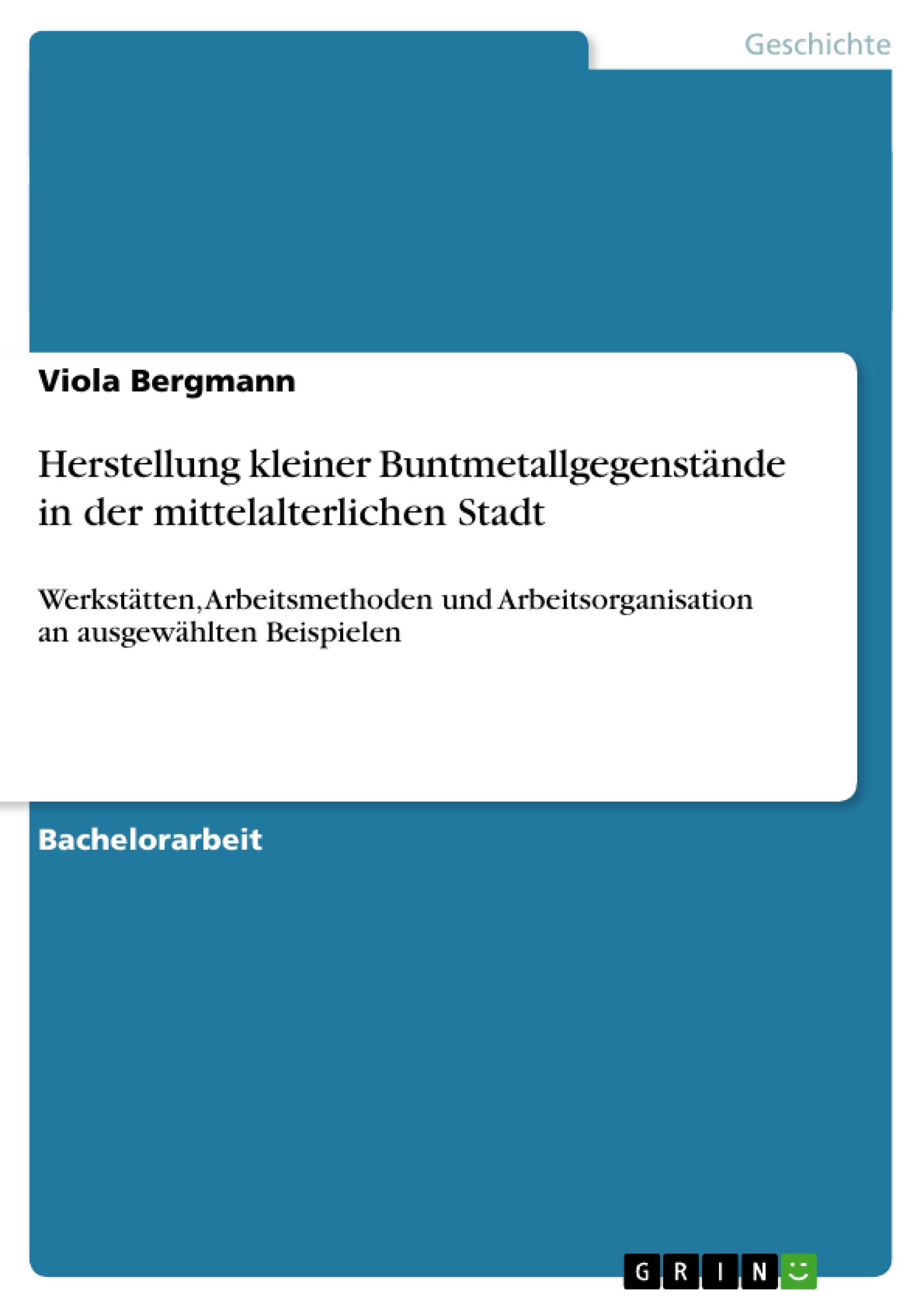Die Bezeichnung Buntmetall umfasst üblicherweise alle legierungsfähigen Metalle außer Eisen und den Edelmetallen Gold und Silber. Dies sind in erster Linie Kupfer und die Kupferlegierungen Bronze und Messing, aber auch Blei, Zinn und deren Legierungen. Während Kupfer und Kupferlegierungen in rötlichen und rotgoldenen Farben auftreten, sind Blei und Zinn weiß bis grau und um einiges weicher. Gemeinsam ist diesen Metallen ein ansprechendes glänzendes Aussehen und dass man sie mit den im Mittelalter verfügbaren Mitteln und Verfahren gut verarbeiten und gestalten konnte. Außerdem waren diese Metalle billiger als Edelmetalle,die sie häufig kopieren sollten. Hierin mögen die Gründe dafür gelegen haben,dass Buntmetalle ab dem 10. Jh. immer beliebter wurden und sich zu einem der wichtigsten Werkstoffe überhaupt entwickelten. Aus Buntmetall bestanden neben Großgegenständen wie Grapen oder Leuchter auch viele Kleinteile wie Schnallen, Buch- und Möbelbeschläge, Pferdegeschirrteile, Hausrat, Toilettengerät sowie Fibeln und weitere Trachtbestandteile. Die Herstellung dieser Kleinteile ist Thema der vorliegenden Arbeit.
Forschungsstand
Für die kleinen Buntmetallfunde der mittelalterlichen Städte, die Tätigkeiten der Produzenten und ihre Werkstätten hat sich die archäologische Forschung lange Zeit nur wenig interessiert. Lediglich H. Drescher hat sich ab den 1970er Jahren intensiv mit den Herstellungsmethoden des vor- und frühgeschichtlichen Metallhandwerks beschäftigt. Seine richtungweisenden Arbeiten, in denen er Versuchsergebnisse, genaue Kenntnis der historischen Quellen und seine immense praktische Erfahrung verband, behandeln jedoch hauptsächlich die Herstellung von Großgeräten.
Die ersten mir bekannten Arbeiten, die sich mit kleinen Buntmetallfunden befassen, sind zwei unpublizierte Abschlussarbeiten aus den 1990er Jahren. Die Magisterarbeit von Th. Liebert behandelt die Buntmetallfunde der Burg Plesse, und J. Matthies beschäftigt sich in seiner Diplomarbeit mit den mittelalterlichen Metallfunden aus der Altstadt von Magdeburg. Inwieweit sich Liebert mit den Herstellungstechniken auseinandersetzt, konnte ich nicht feststellen, da mir die Arbeit nicht zugänglich war. Die Arbeit über Magdeburg besteht aus einer umfangreichen Fundaufnahme mit zeitlicher und typologischer Einordnung der Fundstücke, die Herstellungsmethoden werden jedoch nicht thematisiert.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Problemstellung und Vorgehensweise
- Verwendete Quellen
- Themeneingrenzung
- 1. Rohstoffe
- Verwendete Metalle
- Reines Kupfer
- Gewinnung/Verhüttung
- Herkunftsorte
- Legierungen
- Bronze
- Messing
- Bezug fertiger Legierungen oder Halbzeuge
- Altmetall
- Weitere benötigte Metalle
- Probieren und Scheiden
- Naturwissenschaftliche Bestimmung von Metallen
- Waagen und Gewichte
- Weitere Rohstoffe
- 2. Die Werkstatt
- Öfen
- Eingetiefte ovale und birnenförmige Schmelzöfen
- Rechteckige mit Steinplatten ausgekleidete Ofengruben
- Öfen mit geschlossenem Ofenraum und Blasebalg
- Windöfen
- Schachtöfen
- Werkstätten
- Der Arbeitsplatz nach Theophilus
- Lage der Werkstatt in der Stadt
- Öfen
- 3. Herstellungmethoden
- 3. A. Guss von Roh- und Fertigteilen
- Gussstiegel
- Gussverfahren
- Guss von Barren
- Guss von nachzuschmiedenden Rohteilen
- Formguss
- Wachsausschmelzverfahren
- Guss in wiederverwendbaren Formen
- Anzeichen für Guss an Metallgegenständen
- 3. B. Weiterverarbeitung gegossener Rohteile
- Werkzeug
- Versäubern
- Feilen
- Kaltverformung
- Hämmern und Treiben
- Schmieden
- Pressen und Prägen
- Draht ziehen
- Blech und Draht biegen
- Drehen
- Trennen
- Verbinden von Einzelbestandteilen
- Hartlöten
- Weichlöten
- Vernieten
- Verzieren
- Muster feilen
- Plastische Verzierungen
- Muster punzieren
- Ziselieren
- Muster gravieren
- Niello
- Feuervergolden
- Emaillieren
- Steinbesatz
- Durchbrucharbeiten
- 3. A. Guss von Roh- und Fertigteilen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Arbeitsorganisation in mittelalterlichen Buntmetallwerkstätten anhand ausgewählter Beispiele. Ziel ist es, die Arbeitsschritte, Produktionsmittel und die Organisation der Herstellung kleiner Buntmetallgegenstände zu rekonstruieren, um ein umfassenderes Bild der mittelalterlichen Arbeitswelt zu erhalten und die Effektivität archäologischer Forschung zu verbessern.
- Rohstoffe und deren Beschaffung
- Werkstatteinrichtungen und Öfen
- Herstellungstechniken (Gießen, Kaltverformung, Verzierung)
- Werkzeuge und deren Anwendung
- Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit der Herstellung kleiner Buntmetallgegenstände im mittelalterlichen städtischen Kontext. Sie untersucht die Werkstätten, Arbeitsmethoden und Arbeitsorganisation anhand archäologischer Funde und historischer Quellen, wobei ein Fokus auf Kupfer und dessen Legierungen liegt, ergänzt durch Beispiele aus Blei und Zinn. Die bisherige Forschungslage zeichnet sich durch eine unzureichende Auseinandersetzung mit den Herstellungsmethoden kleiner Buntmetallgegenstände aus.
1. Rohstoffe: Dieses Kapitel beschreibt die im Mittelalter verwendeten Metalle und Legierungen, insbesondere Kupfer, Bronze und Messing, sowie Blei und Zinn. Es behandelt die Gewinnung und Verhüttung von Kupfer, die Herstellung von Bronze und Messing mittels des Galmeiverfahrens, und die Bedeutung von Altmetall. Die Herkunftsorte der Metalle werden erörtert, wobei der Fokus auf den regionalen und überregionalen Handel liegt. Weiterhin werden Methoden zur Bestimmung der Metallzusammensetzung und deren Herkunft mittels naturwissenschaftlicher Analyseverfahren vorgestellt.
2. Die Werkstatt: Dieses Kapitel befasst sich mit den Öfen und Werkstätten der mittelalterlichen Buntmetallhandwerker. Es beschreibt verschiedene Ofentypen (ovale, birnenförmige, rechteckige Schmelzgruben; Öfen mit geschlossenem Ofenraum und Blasebalg; Windöfen; Schachtöfen) und deren rekonstruierte Funktionsweisen anhand archäologischer Befunde. Die Kapitel analysiert die räumliche Organisation der Werkstätten, basierend auf den archäologischen Befunden aus Höxter und Göttingen, wobei sowohl eingetiefte als auch ebenerdige Werkstätten betrachtet werden. Die Lage der Werkstätten innerhalb der Stadt wird im Kontext des städtischen Wachstums und der Beziehungen zu kirchlichen Institutionen diskutiert.
Schlüsselwörter
Mittelalter, Buntmetall, Kupfer, Bronze, Messing, Blei, Zinn, Werkstatt, Ofen, Guss, Kaltverformung, Treiben, Schmieden, Pressen, Prägen, Drahtziehen, Löten, Vernieten, Verzieren, Email, Archäologie, Metallurgie, Arbeitsorganisation, Handwerk.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelalterliche Buntmetallwerkstätten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Arbeitsorganisation in mittelalterlichen Buntmetallwerkstätten anhand ausgewählter Beispiele. Das Ziel ist die Rekonstruktion der Arbeitsschritte, Produktionsmittel und Organisation bei der Herstellung kleiner Buntmetallgegenstände, um ein umfassenderes Bild der mittelalterlichen Arbeitswelt zu erhalten und die Effektivität archäologischer Forschung zu verbessern.
Welche Metalle und Legierungen werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Kupfer und seine Legierungen (Bronze und Messing), aber behandelt auch Blei und Zinn. Es werden die Gewinnung und Verhüttung von Kupfer, die Herstellung von Bronze und Messing (Galmeiverfahren) und die Verwendung von Altmetall beschrieben.
Welche Aspekte der Rohstoffbeschaffung werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet die Herkunftsorte der Metalle und den regionalen und überregionalen Handel. Es werden auch Methoden zur naturwissenschaftlichen Bestimmung der Metallzusammensetzung und Herkunft vorgestellt.
Welche Arten von Öfen und Werkstätten werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Ofentypen (ovale, birnenförmige, rechteckige Schmelzgruben; Öfen mit geschlossenem Ofenraum und Blasebalg; Windöfen; Schachtöfen) und deren Funktionsweisen anhand archäologischer Befunde. Die räumliche Organisation der Werkstätten (eingetiefte und ebenerdige) wird analysiert, ebenso deren Lage innerhalb der Stadt im Kontext des städtischen Wachstums und der Beziehungen zu kirchlichen Institutionen.
Welche Herstellungstechniken werden untersucht?
Die Arbeit behandelt Gießen (inkl. Wachsausschmelzverfahren und Guss in wiederverwendbaren Formen), Kaltverformung (Hämmern, Treiben, Schmieden, Pressen, Prägen, Drahtziehen, Biegen, Drehen, Trennen), Verbinden von Einzelteilen (Hartlöten, Weichlöten, Vernieten) und Verzierungstechniken (Muster feilen, plastische Verzierungen, Punzieren, Ziselieren, Gravieren, Niello, Feuervergolden, Emaillieren, Steinbesatz).
Welche Werkzeuge werden erwähnt?
Die Arbeit beschreibt die Werkzeuge, die bei den verschiedenen Herstellungsschritten verwendet wurden, ohne jedoch eine detaillierte Liste zu liefern. Der Fokus liegt auf der Anwendung der Werkzeuge im Kontext der jeweiligen Arbeitsverfahren.
Wie wird die Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung behandelt?
Die Arbeit untersucht die Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung in den mittelalterlichen Buntmetallwerkstätten, jedoch werden keine konkreten Beispiele für Arbeitsteilung im Detail beschrieben. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion des Gesamtprozesses der Metallverarbeitung.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf archäologischen Funden und historischen Quellen. Konkrete Quellenangaben werden im Text genannt, sind aber in diesem FAQ nicht im Detail aufgeführt.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird geboten?
Es werden Zusammenfassungen der Einleitung, des Kapitels zu den Rohstoffen und des Kapitels zur Werkstatt angeboten. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die jeweiligen Inhalte und die Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen Mittelalter, Buntmetall, Kupfer, Bronze, Messing, Blei, Zinn, Werkstatt, Ofen, Guss, Kaltverformung, verschiedene Verzierungstechniken, Archäologie, Metallurgie und Arbeitsorganisation.
- Quote paper
- Baccalaurea Artium Viola Bergmann (Author), 2006, Herstellung kleiner Buntmetallgegenstände in der mittelalterlichen Stadt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94644