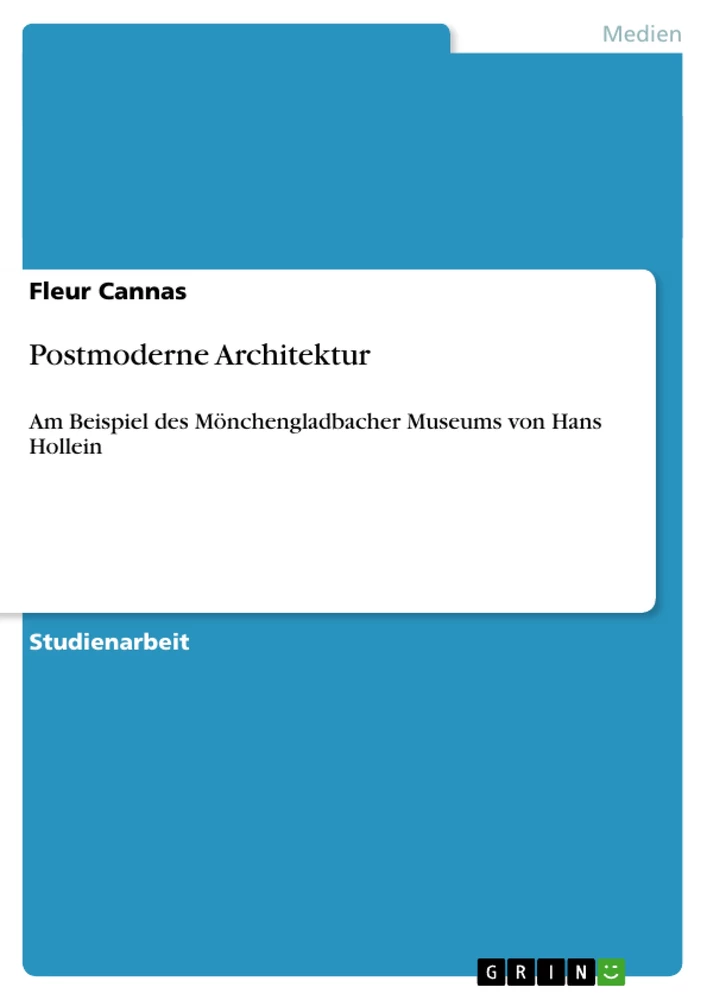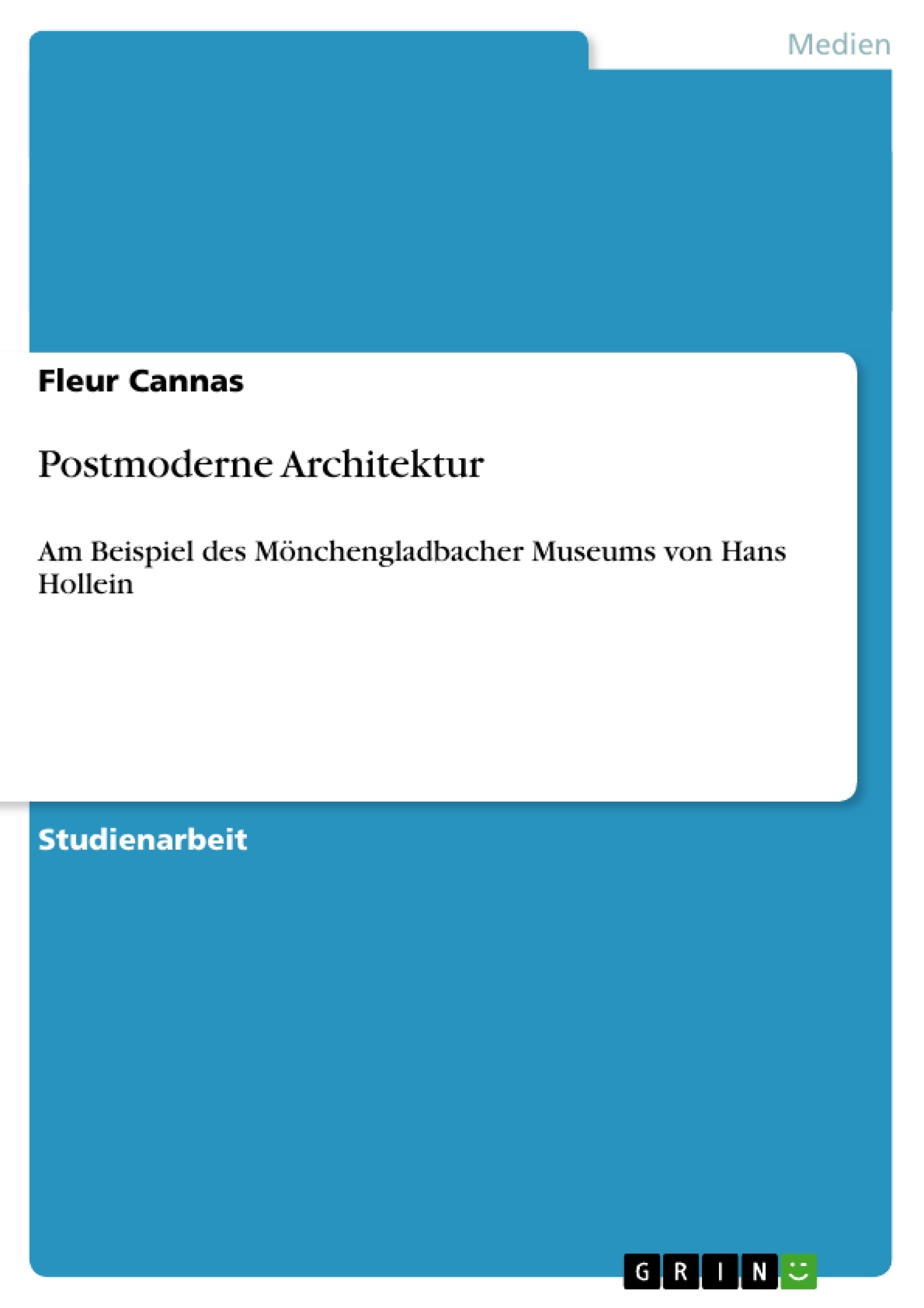Der Mittelmäßige liebt nur das Leichtdefinierbare.
Das Problem wohlformiert, analysiert und gelöst.
Aber Architektur ist nicht nur das Lösen von Problemen.
Architektur ist eine Feststellung.
Hans Hollein, ARCHITEKTUR- INHALT UND FORM (1964)1
Vielleicht waren es nostalgische Gedanken, entsprungen aus der Sehnsucht nach
Wärme und Schönheit? Vielleicht war es einfach an der Zeit etwas zu ändern? Die
Architekturlandschaft, die wir vor uns sahen, farb- und schmucklos, mit all ihren
scharfen Kanten, schnitt uns in die Augen.
Die Gebäudeklötze, wie Kometen vom Himmel gefallen, wahllos in die Welt gesetzt,
ohne Achtung vor ihrer Umwelt, der natürlichen Landschaft um sie herum.
„Das Wort »Fassade« ist uns zum Begriff der Vortäuschung und des Falschen geworden.
Doch mit dieser modernen Moral der Vereinfachung und der Rückführung der Architektur
auf die elementaren und primären Formen ging einher, daß unsere Städte zu einer
Ansammlung glatter Kästen wurden, denen man schließlich nur noch ihre leistungsstarke
Zweckmäßigkeit als Raumcontainer ansah. Und um uns breitet sich der Ozean der
Monotonie aus.“2
Dies war der Zeitpunkt an dem die Postmoderne ihren Einzug in die Architektur
erhielt. Die Rückbesinnung zum Menschen, seinen Bedürfnissen und seiner Umwelt
trifft in den 1970er und 80er Jahren auf immer größer werdende Resonanz.
Der 1934 in Wien geborene Architekt Hans Hollein gehört zu den bekanntesten
Vertretern der postmodernen Architektur. Das Abteimuseum in Mönchengladbach ist
einer seiner innovativsten Beiträge zur Architektur der Gegenwart. Mit diesem Bau
prägte er in den 80er Jahren den Begriff der Architekturlandschaft und der Collage.
Bei Hollein kommt es zu einer Verschränkung dieser beiden Begriffe. Zum einem hat
der Bau den Ansprüchen postmoderner Forderungen zu genügen, was zu einem
collageartigen Gefüge an unterschiedlichen Architektursprachen führt. Zum anderen
soll er seiner Umwelt gerecht werden und sich integrativ in die ihn umgebende
architektonische Landschaft einfügen. Dies kann zu einer „Verlandschaftlichung“ der
Architektur selbst führen.
Im Rahmen dieser Proseminarsarbeit soll herausgearbeitet werden, inwieweit Hans
Holleins Museumsbau in Mönchengladbach den postmodernen Werten gerecht wird.
Aufgrund des Unfangs der Arbeit wird nur auf die äußerlichen Elemente des Baus eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Die Postmoderne
- 1.1 Der Begriff der Postmoderne
- 1.2 Postmoderne Architektur
- 1.2.1 Entstehung postmoderner Architektur als Reaktion auf die Moderne?
- 1.2.2 Sprachliche Pluralität nach Charles Jencks
- 1.2.3 Fiktion nach Heinrich Klotz
- 2. Die Postmoderne am Beispiel Hans Holleins
- 2.1 Museum Mönchengladbach
- 2.2 Bauwerk ist wieder Kunstwerk
- 2.3 Architekturlandschaften
- 1. Die Postmoderne
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit Hans Holleins Museumsbau in Mönchengladbach den postmodernen Werten entspricht. Der Fokus liegt auf den äußeren Elementen des Gebäudes. Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Einführung in den Begriff der Postmoderne und deren Bedeutung für die Architektur, unter Einbezug der theoretischen Ansätze von Charles Jencks und Heinrich Klotz.
- Der Begriff der Postmoderne und seine Entwicklung
- Postmoderne Architektur als Reaktion auf die Moderne
- Analyse des Museumsbaus Mönchengladbach von Hans Hollein
- Holleins Konzept der Architekturlandschaft und Collage
- Die Verschränkung von postmodernen Forderungen und der Integration in die Umgebung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellung der Arbeit vor: Inwieweit entspricht Holleins Museumsbau in Mönchengladbach postmodernen Werten? Sie kritisiert die moderne, funktionalistische Architektur als kalt und uninspiriert und beschreibt die Postmoderne als eine Reaktion auf diese Tendenz, die eine Rückbesinnung auf den Menschen und seine Umwelt fordert. Hans Hollein wird als wichtiger Vertreter dieser Bewegung vorgestellt, und das Mönchengladbacher Museum als sein innovativer Beitrag. Die Arbeit kündigt an, sich auf die äußeren Elemente des Gebäudes zu konzentrieren und im ersten Kapitel den Begriff der Postmoderne und relevante Theorien zu erläutern.
II. Hauptteil, 1. Die Postmoderne: Dieses Kapitel untersucht den Begriff der Postmoderne, seine Entstehung und Entwicklung über verschiedene Disziplinen hinweg, insbesondere in der Literatur und Architektur. Es beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs, beginnend mit frühen Anwendungen bis hin zu seiner endgültigen Positivierung in den 1960er Jahren. Der Abschnitt erörtert die „Mehrsprachigkeit“ der postmodernen Literatur und die Schwierigkeit, die Postmoderne in der Architektur zeitlich genau zu definieren, da sie als Reaktion auf die Moderne zu verstehen ist, jedoch gleichzeitig mit modernen und vormodernen Strömungen koexistiert. Die Arbeit von Robert Venturi, „Complexity and Contradiction“, wird als ein wichtiger Beitrag zum Ende der klassischen Moderne angeführt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Hans Holleins Postmodernes Museum in Mönchengladbach
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Museumsbau von Hans Hollein in Mönchengladbach im Hinblick auf seine Übereinstimmung mit postmodernen Werten. Der Fokus liegt dabei auf den äußeren Elementen des Gebäudes.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff der Postmoderne, seine Entwicklung und Bedeutung für die Architektur, insbesondere im Kontext der Arbeiten von Charles Jencks und Heinrich Klotz. Sie analysiert den Museumsbau in Mönchengladbach als Beispiel postmodernen Bauens, untersucht Holleins Konzept der Architekturlandschaft und Collage und beleuchtet die Verschränkung postmodernen Denkens mit der Integration des Gebäudes in seine Umgebung. Die Arbeit setzt sich kritisch mit der modernen, funktionalistischen Architektur auseinander und präsentiert die Postmoderne als Gegenbewegung.
Welche Autoren und Theorien werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf die Theorien von Charles Jencks und Heinrich Klotz zur Postmoderne und Architektur. Robert Venturi's Werk "Complexity and Contradiction" wird als wichtiger Beitrag zum Ende der klassischen Moderne erwähnt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Fazit. Der Hauptteil umfasst die Erörterung der Postmoderne im Allgemeinen und eine detaillierte Analyse des Museumsbaus in Mönchengladbach. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Der Hauptteil ist in Unterkapitel unterteilt, die den Begriff der Postmoderne, die postmoderne Architektur (insbesondere im Bezug auf die Reaktion auf die Moderne), und die spezifischen Merkmale von Holleins Bauwerk behandeln.
Welche Aspekte von Holleins Museum werden besonders untersucht?
Der Fokus liegt auf den äußeren Elementen des Museumsbaus in Mönchengladbach. Holleins Konzept der Architekturlandschaft und Collage wird detailliert untersucht.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu einer Schlussfolgerung bezüglich der Übereinstimmung des Museumsbaus mit postmodernen Werten. (Der genaue Inhalt der Schlussfolgerung ist aus dem gegebenen Textauszug nicht ersichtlich.)
Was sind die Schlüsselbegriffe der Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind Postmoderne, Postmoderne Architektur, Hans Hollein, Museum Mönchengladbach, Charles Jencks, Heinrich Klotz, Architekturlandschaft, Collage, Moderne, Funktionalismus.
- Quote paper
- Fleur Cannas (Author), 2007, Postmoderne Architektur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94620