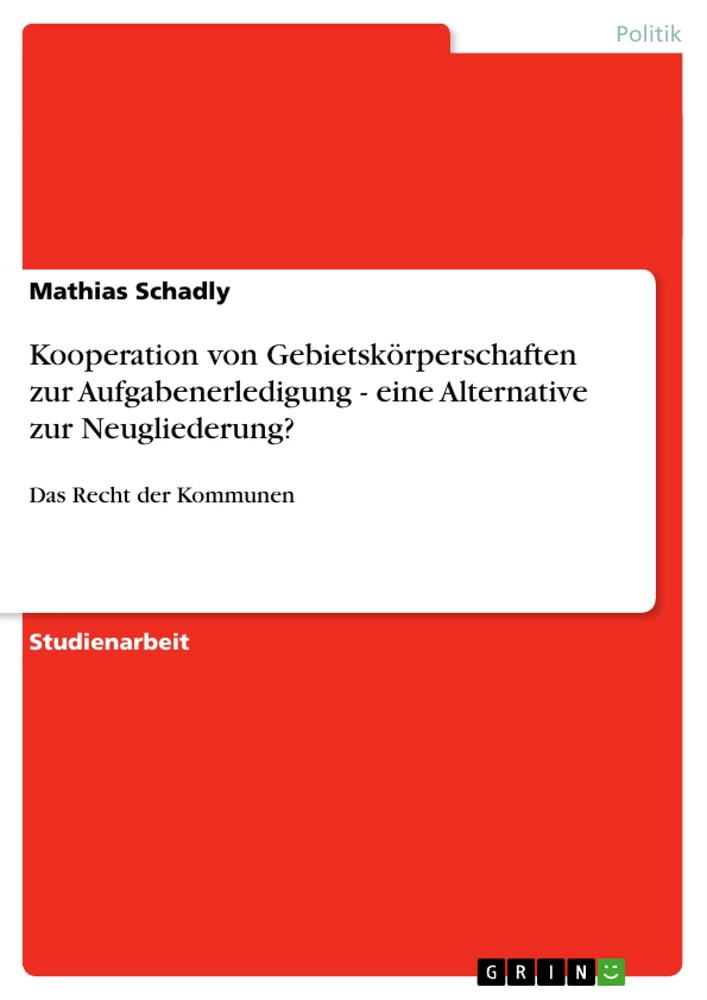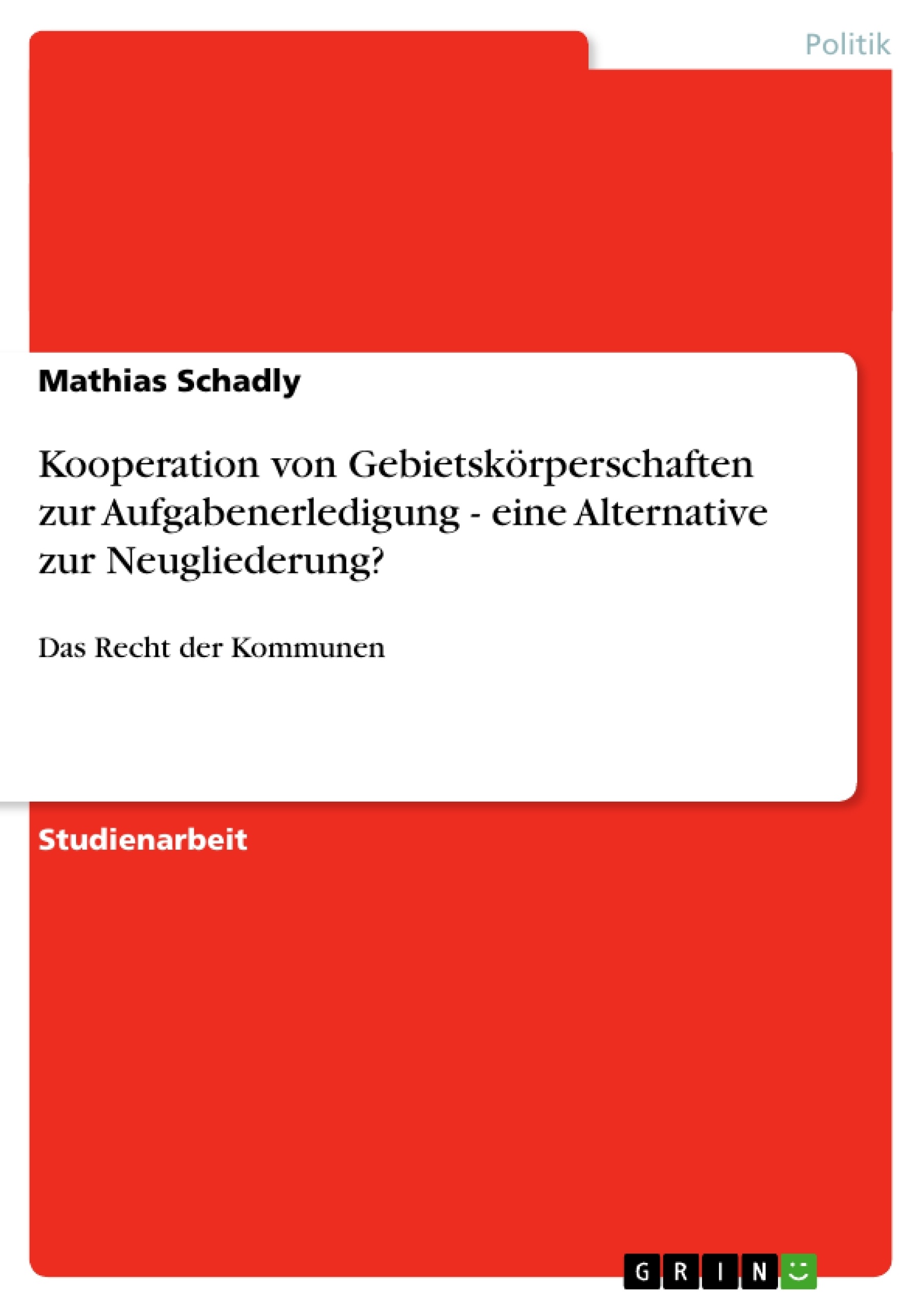Einleitung
Die Frage der kommunalen Zusammenarbeit hat eine lange Geschichte und stellt sich nicht erst in unserer Zeit. Die Beweggründe für die Zusammenarbeit haben sich aber im Laufe der Zeit verändert. Ziel dieses Aufsatzes ist es, dem Leser einen Überblick über die rechtlichen Möglichkeiten für Zusammenarbeit von Kommunen und deren Ausgestaltung und Anwendung zu geben. Der Arbeit möchte ich einige Grundüberlegungen voranstellen.
1. Kooperation ist regional unterschiedlich begründet. Klare Unterschiede existieren zwischen ländlichen Gebieten und Ballungsgebieten. Demografische Überlegungen und der Umgang mit den sehr unterschiedlichen Verwaltungsmassen in den verschiedenen Regionen bei gleichartigen kommunalen Aufgaben bilden hier den Ansatzpunkt.
2. Zur Kommunalen Zusammenarbeit stehen den Gebietskörperschaften unterschiedliche Formen offen. Es wird dabei zwischen eher weichen (formlosen) oder härteren (stark formalisierten) Ausgestaltungsformen unterschieden. Dabei ist erkennbar, dass sich je nach Aufgabengebiet Gestaltungsformen durchgesetzt haben.
3. Die Rechtsformen die den Kommunen zur Zusammenarbeit zur Verfügung stehen sind vielseitig. Ob öffentliches Recht oder Privatrecht, die Entscheidungen sind oft mit Wirtschaftlichkeitsüberlegungen verbunden. Ideen des New Public Management mit Schlagworten wie „Outsourcing“, „contracting out“ oder „make or buy“ sind Kerngedanken.
4. Kontrolle und Legitimierung öffentlicher Aufgabenwahrnehmung ist für eine Demokratische Grundordnung unerlässlich. Formen der Kontrolle gehen heute über die traditionelle Form der Finanzkontrolle hinaus, wobei diese nicht an Wichtigkeit verliert.
Neben der reinen Darstellung der einzelnen Rechtsformen und deren Verwendung, möchte ich die Möglichkeiten der Kontrolle dieser Kooperationen beschreiben. Eine kritische Würdigung und eine alternative Lösungsvariante sollen natürlich in dieser Arbeit nicht vergessen werden. Diese werde ich in dem letzten Gliederungspunkt vornehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die rechtliche Stellung der Kommunen
- 1.1 Die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Grundgesetz
- 1.2 Der Landkreis
- 1.3 Klassische Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung
- 2. Notwendigkeiten für Zusammenarbeit
- 2.1 Im ländlichen Bereich
- 2.2 In Ballungsgebieten/Verflechtungsräumen von Großstädten
- 3. Formen der Kooperation
- 3.1 Die Arbeitsgemeinschaft
- 3.2 Der Zweckverband
- 3.3 Formlose Kooperation
- 3.4 Kapitalgesellschaften
- 3.5 Vereine
- 3.6 Die Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
- 4. Grenzen der Kooperation
- 4.1 Hoheitliche Aufgaben
- 5. Bewertungsmöglichkeiten für Kommunale Aufgabenerfüllung
- 5.1 Betriebswirtschaftliche Betrachtungen
- 5.2 Demokratische Mitbestimmung und Kontrolle
- 6. Alternative: kommunale Neuordnung
- 7. Zusammenfassendes Thesenpapier
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz zielt darauf ab, dem Leser einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Möglichkeiten für die Zusammenarbeit von Kommunen in Deutschland zu geben. Die Arbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Kooperation, beleuchtet die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit und analysiert deren Anwendung in der Praxis. Dabei stehen die Gründe für die Kooperation in unterschiedlichen Regionen im Vordergrund.
- Die rechtliche Grundlage der kommunalen Zusammenarbeit
- Die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit und ihre Ausgestaltung
- Die Gründe für die Kooperation in ländlichen Gebieten und Ballungsräumen
- Die Bedeutung der Kontrolle und Legitimierung von Kooperationen
- Eine kritische Würdigung und alternative Lösungsansätze für die Aufgabenerfüllung von Kommunen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der kommunalen Zusammenarbeit dar und skizziert die zentralen Themenbereiche des Aufsatzes. Kapitel 1 beleuchtet die rechtliche Stellung der Kommunen, insbesondere die Selbstverwaltungsgarantie des Grundgesetzes, die Rolle des Landkreises und die klassischen Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung. Kapitel 2 untersucht die Notwendigkeiten für Zusammenarbeit, sowohl in ländlichen Gebieten als auch in Ballungsräumen. In Kapitel 3 werden verschiedene Formen der Kooperation vorgestellt, darunter die Arbeitsgemeinschaft, der Zweckverband und die Öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Kapitel 4 thematisiert die Grenzen der Kooperation, insbesondere im Hinblick auf hoheitliche Aufgaben. Kapitel 5 widmet sich der Bewertung von Möglichkeiten zur Aufgabenerfüllung, einschließlich betriebswirtschaftlicher Betrachtungen und der demokratischen Kontrolle. Schließlich stellt Kapitel 6 die Alternative der kommunalen Neuordnung dar.
Schlüsselwörter
Kommunale Zusammenarbeit, Selbstverwaltungsgarantie, Grundgesetz, Landkreis, Pflichtaufgaben, Daseinsvorsorge, Kommunales Wirtschaften, Regionalentwicklung, Arbeitsgemeinschaft, Zweckverband, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Kontrolle, Legitimierung, New Public Management, kommunale Neuordnung.
- Quote paper
- Mathias Schadly (Author), 2006, Kooperation von Gebietskörperschaften zur Aufgabenerledigung - eine Alternative zur Neugliederung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94577