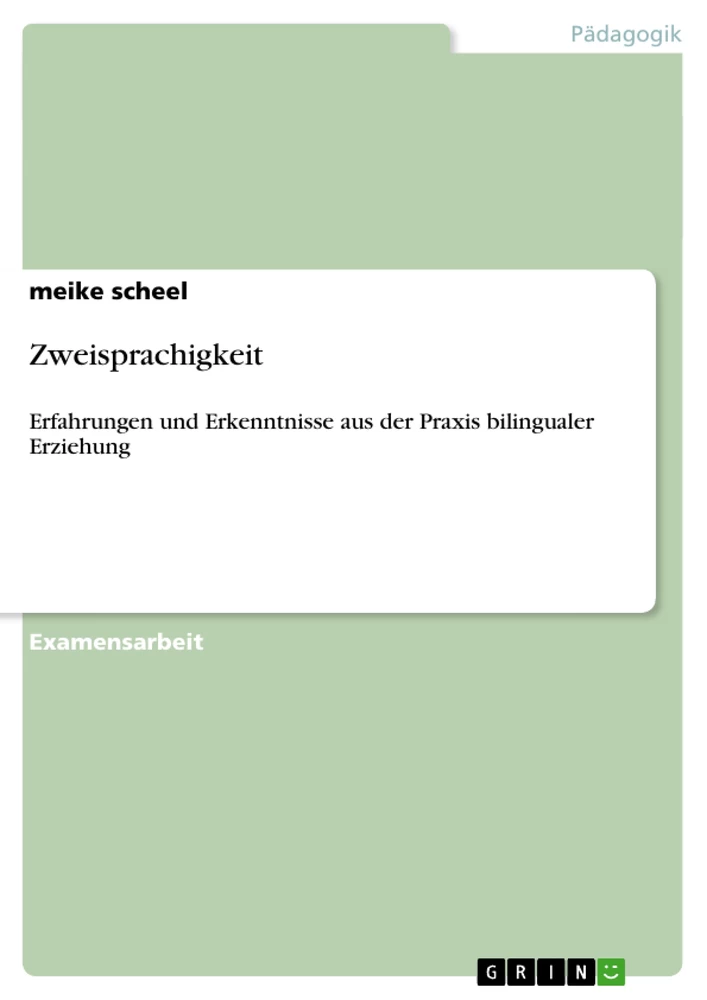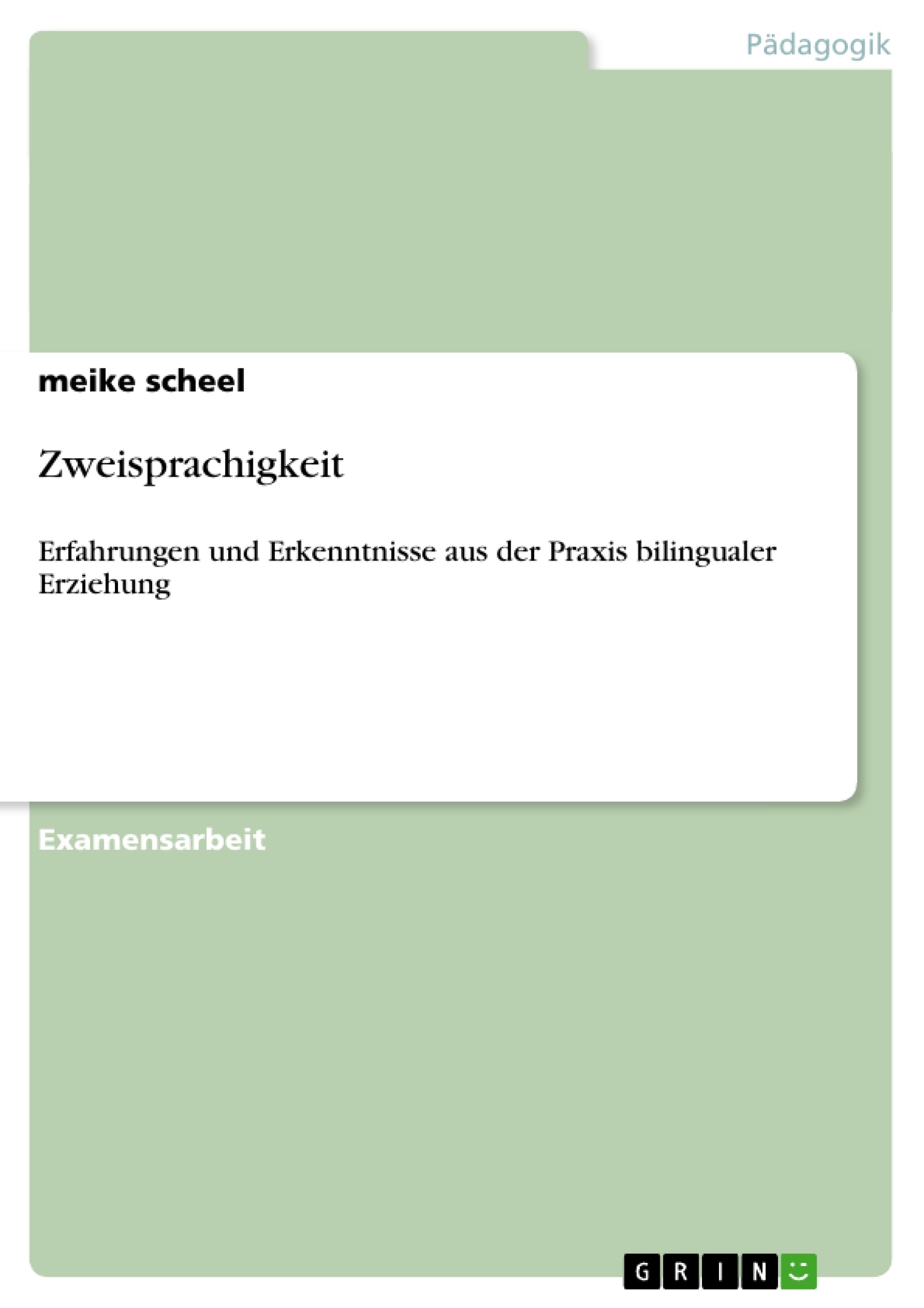Die Arbeit beginnt mit einer Aufführung von Begriffserklärungen, um das Thema „Zweisprachigkeit: Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis bilingualer Erziehung“ einzuleiten und eine theoretische Basis zu liefern. In Kapitel eins wird der Begriff der Zweisprachigkeit nach unterschiedlichen Kriterien eingeteilt und beschrieben: Der Zeitpunkt des Spracherwerbs, die erreichte Kompetenz in beiden Sprachen, das Verhältnis zwischen Sprache und Denken, Sprache und Kultur sowie Sprache und soziokulturellem Milieu nehmen bei dieser Betrachtung einen wichtigen Stellenwert ein. Die Bedeutung der „bilingualen Erziehung“ wird in den Definitionen der Zweisprachigkeit ebenfalls dargelegt; in Kapitel zwei wird jedoch ausführlicher auf die unterschiedlichen Arten der bilingualen Erziehungen eingegangen. Des Weiteren wird im ersten Kapitel die historische Entwicklung der Zweisprachigkeit behandelt.
Kapitel zwei orientiert sich an den Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Praxis bilingualer Erziehung und beschreibt anhand von Fallstudien, auf welche Art und Weise ein Kind zwei oder mehrere Sprachen gleichzeitig erwerben kann.
Dabei wird zwischen sechs verschiedenen Methoden unterschieden. Jede Methode wird mit linguistischen Beispielen aus der Praxis vorgestellt, und es werden die Vor- und Nachteile jeder Methode zusammengefasst.
Im dritten Kapitel werden die Störungen in den Sprachen, die so genannten bilingualen Erscheinungen, geklärt. Besonders erwähnenswert sind diesbezüglich die Sprachverspätungen, Sprachmischungen, Interferenzen und die Halbsprachigkeit.
Das letzte Kapitel stellt den Bezug zwischen der Zweisprachigkeit und kognitiven Entwicklung dar. Zahlreiche Wissenschaftler haben anhand von Tests mit ein- und zweisprachigen Kindern unterschiedliche Tests durchgeführt, um zu erfahren, ob ein Zusammenhang zwischen Zweisprachigkeit und Intelligenz bzw. Denkvermögen bestehe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Definitionen zur Zweisprachigkeit
- Zweisprachigkeit
- Die Entwicklung der Zweisprachigkeit
- Formen der Zweisprachigkeit
- Zweisprachigkeit in Bezug auf die Altersstufe
- Frühe Zweisprachigkeit
- Dominante und ausgewogene Zweisprachigkeit
- Kompakte und koordinierte Zweisprachigkeit
- Bi- und monokulurelle Zweisprachigkeit
- Additive und subtraktive Zweisprachigkeit
- Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis bilingualer Erziehung
- Die bilinguale Erziehung
- Die Typen des frühen Spracherwerbs
- Typ 1: Die Methode „Eine Person- eine Sprache“
- Typ 2: Die Methode „Familiensprache = Nichtumgebungssprache“
- Typ 3: Die Methode der „Nicht-dominante Familiensprache ohne Unterstützung der Umgebung“
- Typ 4: Die Methode der „Doppelten nicht dominanten Sprache in der Familie ohne Unterstützung der Umgebung“
- Typ 5: Die Methode „Nicht-muttersprachliche Eltern“
- Typ 6: Die Methode des „Gemischter Sprachgebrauch“
- Bilinguale Erscheinungen
- Semilingualismus/ Halbsprachigkeit
- Sprachverspätungen
- Sprachmischungen und Interferenzen
- Bewusstsein der Zweisprachigkeit in Abhängigkeit vom Alter
- Zweisprachigkeit und Kognition
- Zweisprachigkeit und Intelligenz
- Die Periode der negativen Auswirkungen
- Die Periode der neutralen Auswirkungen
- Die Periode der positiven Auswirkungen
- Zweisprachigkeit und kreatives/divergentes Denken
- Die Interdependenz- und Schwellenhypothese
- Zweisprachigkeit und metasprachliches Bewusstsein
- Schlussbetrachtung
- Definition und Formen der Zweisprachigkeit
- Methoden des frühen Spracherwerbs in bilingualen Familien
- Bilinguale Erscheinungen und ihre Auswirkungen
- Der Einfluss der Zweisprachigkeit auf die kognitive Entwicklung
- Die Relevanz der bilingualen Erziehung in der heutigen Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Zweisprachigkeit, insbesondere im Kontext der bilingualen Erziehung. Sie analysiert die verschiedenen Definitionen und Formen der Zweisprachigkeit sowie die unterschiedlichen Methoden des frühen Spracherwerbs. Zudem werden bilinguale Erscheinungen wie Semilingualismus und Sprachverspätungen untersucht, um die Herausforderungen und Chancen der zweisprachigen Entwicklung zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Betrachtung der Definitionen und Formen der Zweisprachigkeit. Dabei werden verschiedene Faktoren wie Alter, Sprachkompetenz und soziokultureller Kontext berücksichtigt. Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Methoden des frühen Spracherwerbs in bilingualen Familien vorgestellt und analysiert. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den typischen Erscheinungen, die bei zweisprachigen Kindern auftreten können, wie z.B. Semilingualismus und Sprachverspätungen. Das vierte Kapitel widmet sich dem Einfluss der Zweisprachigkeit auf die kognitive Entwicklung, insbesondere auf die Intelligenz und das kreative Denken.
Schlüsselwörter
Zweisprachigkeit, bilinguale Erziehung, frühe Zweisprachigkeit, Spracherwerb, Sprachentwicklung, Semilingualismus, Sprachverspätung, Sprachmischung, Interferenzen, Kognition, Intelligenz, kreatives Denken, metasprachliches Bewusstsein.
- Quote paper
- meike scheel (Author), 2007, Zweisprachigkeit , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94545