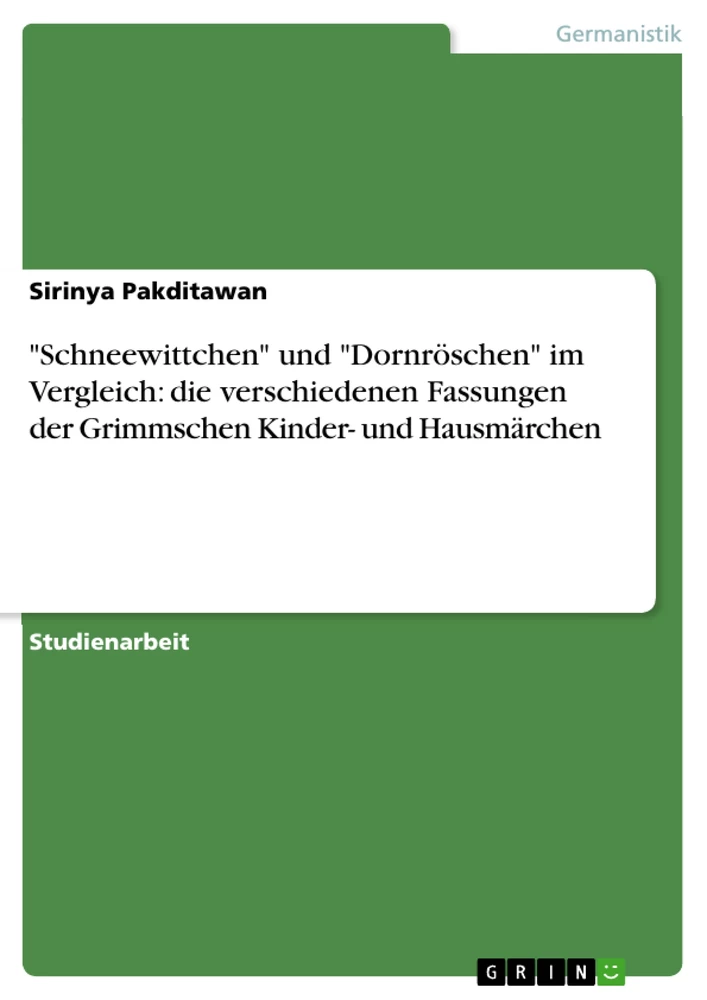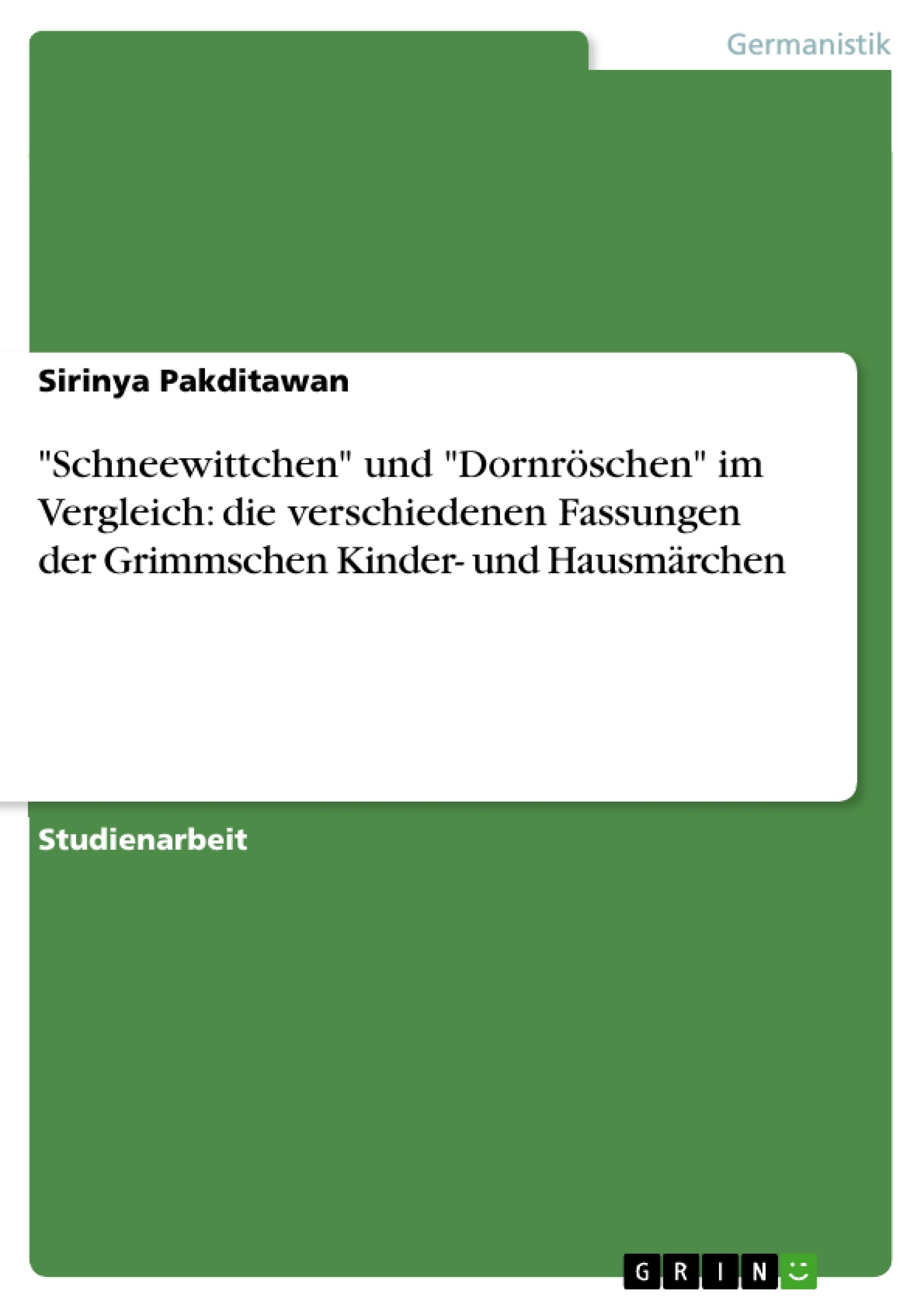In dieser Arbeit werden die bekannten Grimmschen Märchen "Schneewittchen" und "Dornröschen" von ihrer Entstehung bis zu ihrer jeweiligen 3. Fassung auf bedeutende sprachliche Unterschiede untersucht
mit Bezugnahme auf die Charakteristika der Volkstümlichkeit und Kindgemäßheit. Darüber hinaus werden signifikante Änderungen in der narrativen Struktur betrachtet. In diesem Abschnitt soll es zunächst um die inhaltlichen und sprachlichen Eigenheiten des
„Schneewittchen“- und „Dörnröschen“ – Märchens an sich gehen. Zunächst gehen wir
inhaltlich vor und betrachten das Motiv des Wunderbaren in diesen Märchen. Anschließend
wenden wir uns der Struktur und der sprachlichen Ausgestaltung dieser Märchen zu und
behandeln die Dreigliedrigkeit sowie die Formelhaftigkeit als übergreifende charakteristische
Merkmale dieser Märchen.
Das Wunderbare oder auch das Übernatürliche sind die konstitutiven Merkmale des
Märchens. Denn „Märchen“ bedeutet, „eine kurze, ausschließlich der Unterhaltung
dienende[n] Erzählung von phantastisch-wunderbaren Begebenheiten, die sich in Wahrheit
nicht ereignet haben und nie ereignen können, weil sie (…) Naturgesetzen widerstreiten“.
„Schneewittchen“ und „Dornröschen“ sind typische Märchen in diesem Sinne. Denn auch in
diesen Fällen stehen die Begebenheiten im Widerspruch zur Wirklichkeit. So wird bereits die Existenz der Heldinnen Schneewittchen und Dornröschen mit dem
Wunderbaren durchkreuzt. Dies wird schon an den Umständen ihrer Geburt beziehungsweise
Empfängnis sichtbar. So kündigt ein Frosch im „Dornröschen“ (in der ersten Version von
1812 ein Krebs) der Königin die Geburt einer Tochter an, und auch die Mutter des
Schneewittchens erhält eine Tochter, die im Ganzen ihren Wünschen entspricht. Aus diesem
Grund kann man sagen, dass sich um die Geburt dieser Märchenheldinnen durchaus das
Übernatürliche rankt. An dieser Stelle wird zudem ein weiteres Merkmal des Märchens
sichtbar, denn sowohl die Ausgangslage im „Schneewittchen“ als auch im „Dornröschen“ ist durch ein Bedürfnis gekennzeichnet, nämlich von dem Wunsch der Mutter (der Eltern) nach
einer Tochter.
Inhaltsverzeichnis
- „Schneewittchen“ und „Dornröschen“: die unterschiedlichen Fassungen von 1812 bis 1857 im Vergleich
- Die motivischen und sprachlichen Eigenheiten des „Schneewittchen“ – und „Dornröschen“ - Märchens
- Das Wunderbare in „Schneewittchen“ und „Dornröschen“
- Formelhaftigkeit und Dreigliedrigkeit
- Inhaltlich - motivische und sprachliche Differenzen in den „Schneewittchen“-Versionen
- Die Einführung der bösen Stiefmutter und der Farbmotivik
- Die Einführung von Redewendungen und Sprichwörtern
- Inhaltlich – motivische und sprachliche Unterschiede in den „Dornröschen“-Versionen
- Die Einführung des Frosches und der weisen Frauen
- Vom Subjekt zum Objekt: Dornröschen zwischen Aktivität und Passivität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verschiedenen Fassungen der Grimmschen Märchen „Schneewittchen“ und „Dornröschen“ von 1812 bis 1857. Die Zielsetzung besteht darin, die motivischen und sprachlichen Eigenheiten beider Märchen aufzuzeigen und die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf der Analyse der Entwicklung der Erzählungen im Laufe der Zeit.
- Das Wunderbare und Übernatürliche in den Märchen
- Formelhaftigkeit und Dreigliedrigkeit der Erzählstruktur
- Inhaltliche und sprachliche Unterschiede zwischen den Versionen von „Schneewittchen“
- Inhaltliche und sprachliche Unterschiede zwischen den Versionen von „Dornröschen“
- Entwicklung der Charaktere und deren Rollen
Zusammenfassung der Kapitel
„Schneewittchen“ und „Dornröschen“: die unterschiedlichen Fassungen von 1812 bis 1857 im Vergleich: Dieses Kapitel dient als Einleitung und Überblick über die verschiedenen Versionen der Märchen „Schneewittchen“ und „Dornröschen“, die von den Brüdern Grimm zwischen 1812 und 1857 veröffentlicht wurden. Es legt den Grundstein für die detailliertere Analyse der motivischen und sprachlichen Eigenheiten in den folgenden Kapiteln und weist auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen hin, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden.
Die motivischen und sprachlichen Eigenheiten des „Schneewittchen“ – und „Dornröschen“ - Märchens: Dieses Kapitel untersucht die grundlegenden Merkmale beider Märchen. Es analysiert das Motiv des Wunderbaren und Übernatürlichen, welches beide Geschichten durchzieht, von den übernatürlichen Geburten der Heldinnen bis hin zum Auftreten von fantastischen Wesen wie Zwergen und Feen. Weiterhin wird die Formelhaftigkeit und Dreigliedrigkeit der Erzählstruktur beleuchtet, die durch formelhafte Wendungen wie „Es war einmal“ und die häufige Verwendung der Dreizahl gekennzeichnet ist. Diese strukturellen Elemente tragen zur typischen Märchenästhetik bei und beeinflussen die Wahrnehmung der Erzählung.
Inhaltlich - motivische und sprachliche Differenzen in den „Schneewittchen“-Versionen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung der „Schneewittchen“-Versionen. Es analysiert die Einführung und Entwicklung der Figur der bösen Stiefmutter und die Rolle der Farbmotivik im Märchen. Der Vergleich der unterschiedlichen Versionen zeigt, wie sich die Erzählung im Laufe der Zeit verändert hat und welche sprachlichen und inhaltlichen Anpassungen vorgenommen wurden. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie diese Veränderungen die Bedeutung und Interpretation des Märchens beeinflussen.
Inhaltlich – motivische und sprachliche Unterschiede in den „Dornröschen“-Versionen: Ähnlich wie im vorherigen Kapitel, analysiert dieses Kapitel die verschiedenen Versionen des „Dornröschen“-Märchens. Hierbei stehen die Einführung des Frosches (bzw. Krebses in der ersten Version) und der weisen Frauen im Mittelpunkt, ebenso wie die Veränderung der Rolle von Dornröschen selbst, die zwischen Aktivität und Passivität changiert. Der Vergleich der verschiedenen Versionen verdeutlicht die Entwicklung der Handlung, der Charaktere und der sprachlichen Gestaltung im Laufe der Zeit und deren Einfluss auf die Gesamtinterpretation des Märchens.
Schlüsselwörter
Grimmsche Märchen, Schneewittchen, Dornröschen, Märchenanalyse, Motivforschung, Sprachvergleich, Versionenvergleich, Formelhaftigkeit, Dreigliedrigkeit, Wunderbares, Übernatürliches, Stiefmutter, Feen, Zwerge.
Häufig gestellte Fragen zu: Vergleich der Grimmschen Märchen "Schneewittchen" und "Dornröschen"
Welche Märchen werden in diesem Text verglichen?
Der Text vergleicht die verschiedenen Fassungen der Grimmschen Märchen "Schneewittchen" und "Dornröschen", die zwischen 1812 und 1857 veröffentlicht wurden.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Arbeit untersucht die motivischen und sprachlichen Eigenheiten beider Märchen und arbeitet die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen heraus. Der Fokus liegt auf der Analyse der Entwicklung der Erzählungen im Laufe der Zeit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Analyse umfasst das Wunderbare und Übernatürliche in den Märchen, die Formelhaftigkeit und Dreigliedrigkeit der Erzählstruktur, inhaltliche und sprachliche Unterschiede zwischen den Versionen von "Schneewittchen" und "Dornröschen", sowie die Entwicklung der Charaktere und deren Rollen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text beinhaltet Kapitel, die einen Überblick über die verschiedenen Versionen geben, die motivischen und sprachlichen Eigenheiten beider Märchen untersuchen, die inhaltlich-motivischen und sprachlichen Unterschiede in den "Schneewittchen"-Versionen analysieren und abschließend die Unterschiede in den "Dornröschen"-Versionen vergleichen.
Was wird in der Einleitung (Kapitel 1) behandelt?
Die Einleitung bietet einen Überblick über die verschiedenen Versionen der Märchen "Schneewittchen" und "Dornröschen" (1812-1857) und legt den Grundstein für die detailliertere Analyse in den folgenden Kapiteln.
Welche Aspekte werden in der Analyse der motivischen und sprachlichen Eigenheiten (Kapitel 2) untersucht?
Kapitel 2 analysiert das Motiv des Wunderbaren und Übernatürlichen, die Formelhaftigkeit und Dreigliedrigkeit der Erzählstruktur, sowie formelhafte Wendungen und die häufige Verwendung der Dreizahl.
Worauf konzentriert sich die Analyse der "Schneewittchen"-Versionen (Kapitel 3)?
Kapitel 3 konzentriert sich auf die Entwicklung der Figur der bösen Stiefmutter, die Rolle der Farbmotivik und die sprachlichen und inhaltlichen Anpassungen im Laufe der Zeit und deren Einfluss auf die Bedeutung des Märchens.
Was ist der Schwerpunkt der Analyse der "Dornröschen"-Versionen (Kapitel 4)?
Kapitel 4 analysiert die Einführung des Frosches (bzw. Krebses), der weisen Frauen, die Veränderung der Rolle von Dornröschen zwischen Aktivität und Passivität und deren Einfluss auf die Gesamtinterpretation des Märchens.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Relevante Schlüsselwörter sind: Grimmsche Märchen, Schneewittchen, Dornröschen, Märchenanalyse, Motivforschung, Sprachvergleich, Versionsvergleich, Formelhaftigkeit, Dreigliedrigkeit, Wunderbares, Übernatürliches, Stiefmutter, Feen, Zwerge.
- Quote paper
- Sirinya Pakditawan (Author), 2005, "Schneewittchen" und "Dornröschen" im Vergleich: die verschiedenen Fassungen der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94541