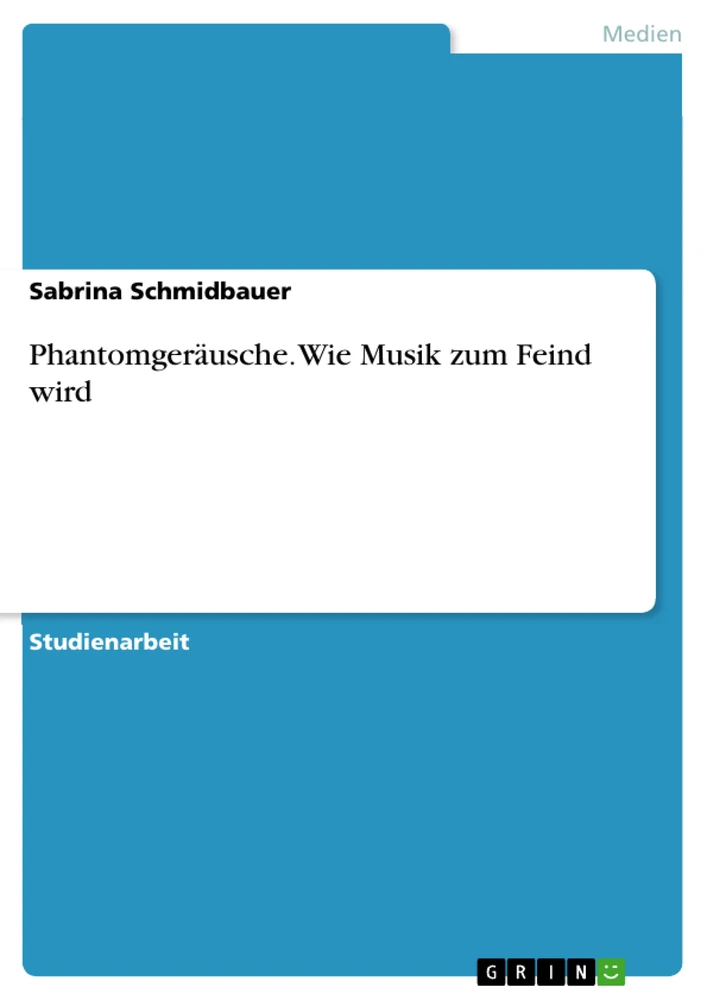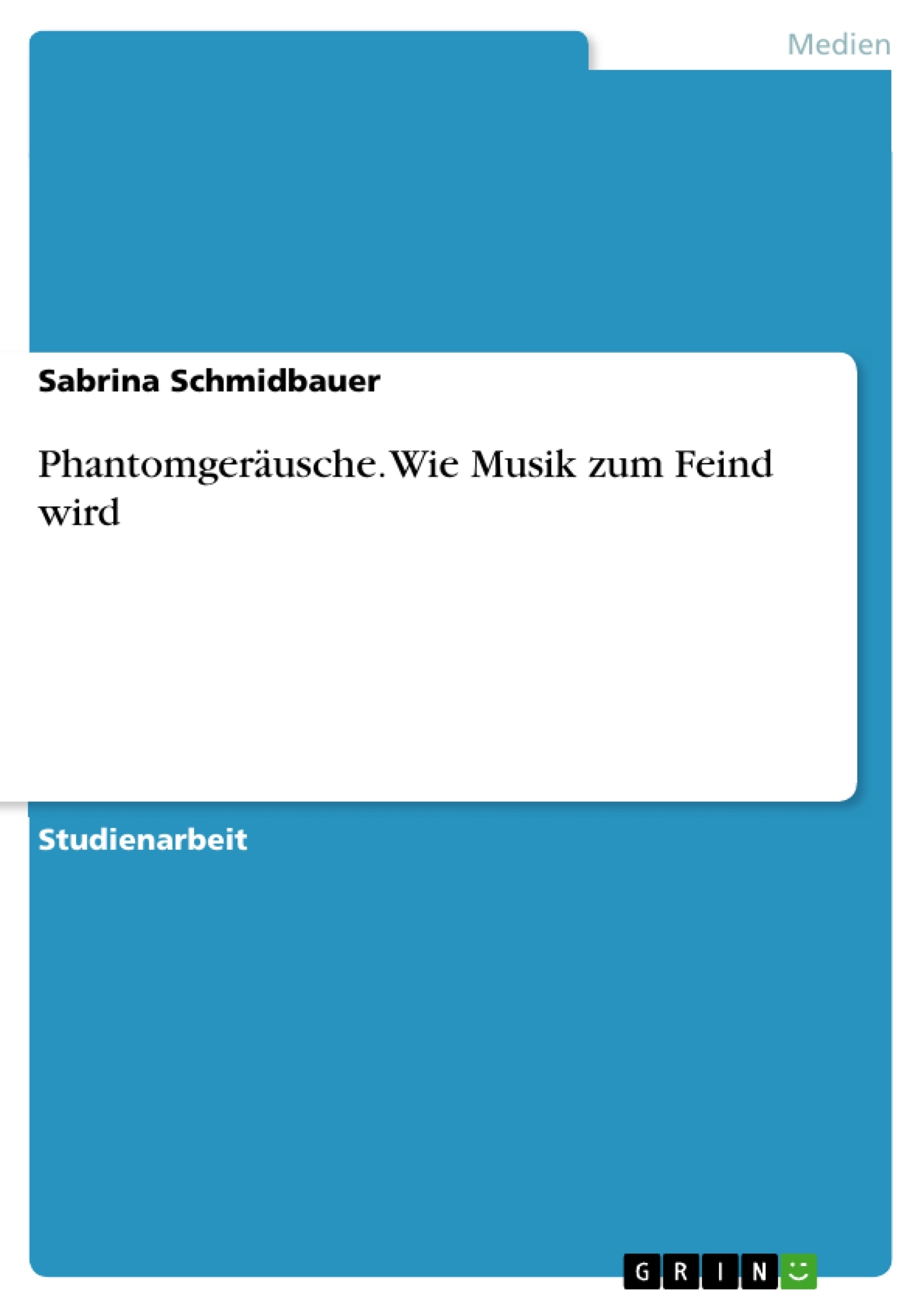Musik begleitet uns täglich und dient oftmals der Erholung vom stressigen Alltag, der gemeistert werden muss. Dann, wenn wir uns wieder den Pflichten und Aufgaben stellen müssen, drehen wir die Musik ab und wenden uns den Sachen zu, die unsere volle Konzentration abverlangen. Doch was, wenn sich die Musik auf einmal nicht mehr einfach abdrehen lässt? Was, wenn auch jeglicher Versuch diese leiser zu stellen scheitert und sie von nun an Tag für Tag kommt und geht wann sie will, bleibend für mehrere Stunden oder doch nur einige Minuten? Was, wenn die Musik auf einmal in unseren Köpfen ist? Vorbei ist es dann mit der beruhigenden Musik, die uns für einige Minuten aus dem anstrengendem Alltag holt, ist sie doch nun der größte Stressfaktor.
Schon früh hatte die Musik einen wichtigen Stellenwert in der Geschichte der Menschheit, welcher bis heute anhält. Musik wird oft als Spiegel der Seele betrachtet, als das Medium, das Gefühlen Ausdruck verleiht. Sei es die dröhnende elektronische Musik im Club, die die Menge zum Tanzen bringt oder die leise Klaviersonate, der mit einem Glas Rotwein in der Badewanne gelauscht wird. Sie begleitet uns zu jeder Sekunde und nun ist weder ein Gespräch führen noch einen klaren Gedanken fassen eine Option. Vor so einer Möglichkeit verschließen die meisten WissenschaftlerInnen ihre Augen, ist Musik doch oft ein Freund und Helfer bei Verhaltensstörungen, chronischen Schmerzen, depressiven Verstimmungen oder stressbedingten Beschwerden. Die Musik als Mittel zur Therapie soll körperliche Heilungsprozesse beschleunigen oder psychische Beschwerden lindern. Musik als Auslöser für all das, wird nur in wenigen wissenschaftlichen Studien hinterfragt. Wir alle erleben aber ein Phänomen selbst sehr häufig, das uns für Stunden oder manchmal Tage begleitet und meist als störend und ungewollt bekannt ist: der „Ohrwurm“.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Phantomgeräusche – Musikalische Plagegeister
- 2. Der „Ohrwurm“
- 2.1 Der „Ohrwurm“ im Sprachgebrauch
- 2.2 Ein Einblick in die Forschung zum „Ohrwurm“-Phänomen
- 2.2.1 Verbreitung und Häufigkeit des Phänomens
- 2.2.2 Eigenschaften des Ohrwurms
- 2.2.3 Auswirkung auf die Stimmung
- 3. Musikalische Halluzinationen
- 3.1 Ein Versuch der Abgrenzung vom „Ohrwurm“-Phänomen
- 3.2 Worte einer Betroffenen
- 3.3 Musikalische Halluzinationen bei Schizophrenie
- 3.3.1 Fallbeispiele Betroffener
- 3.3.2 Zusammenfassung
- 4. (Pseudo-) Halluzinationen
- 4.1 Das auditive „Charles-Bonnet-Syndrom“ (CBS)
- III. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des „Ohrwurms“ und dessen Abgrenzung zu musikalischen Halluzinationen. Ziel ist es, die Verbreitung, Häufigkeit und Charakteristika des „Ohrwurms“ anhand wissenschaftlicher Studien zu beleuchten sowie die Unterformen musikalischer Halluzinationen zu erläutern und zu unterscheiden. Darüber hinaus werden Fallbeispiele verschiedener Patientinnen aus wissenschaftlichen Studien herangezogen.
- Das Phänomen des „Ohrwurms“ und seine Verbreitung
- Unterschiede zwischen „Ohrwurm“ und musikalischen Halluzinationen
- Die verschiedenen Arten von musikalischen Halluzinationen
- Die Auswirkungen von „Ohrwürmern“ auf die Stimmung
- Fallbeispiele und wissenschaftliche Studien zu musikalischen Halluzinationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des „Ohrwurms“ ein und beschreibt dessen allgegenwärtige Präsenz im Alltag. Es wird erläutert, wie Musik sowohl zur Entspannung als auch zur Steigerung der Konzentration eingesetzt wird. Das Phänomen des „Ohrwurms“ wird als Störfaktor vorgestellt, der die Konzentration beeinträchtigen kann und im Gegensatz zur gewollten Musiktherapie als unerwünschtes Phänomen wahrgenommen wird.
Kapitel II befasst sich mit dem „Ohrwurm“ als kognitives Phänomen und beschreibt dessen Verbreitung und Häufigkeit anhand wissenschaftlicher Studien. Es werden die Charakteristika des „Ohrwurms“ beleuchtet, wie z.B. die Bekanntheit der Melodie, die Dauer der Episode und die Auswirkungen auf die Stimmung. Das Kapitel stellt auch die Herausforderung dar, das Phänomen des „Ohrwurms“ von musikalischen Halluzinationen abzugrenzen.
Kapitel III behandelt die verschiedenen Arten von musikalischen Halluzinationen und erläutert die Unterschiede zum „Ohrwurm“-Phänomen. Es werden Fallbeispiele aus wissenschaftlichen Studien vorgestellt und die Zusammenfassung der Erkenntnisse zum Thema musikalische Halluzinationen präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen „Ohrwurm“, „musikalische Halluzinationen“, „Involuntary Musical Imagery (INMI)“, „Verbreitung“, „Häufigkeit“, „Eigenschaften“, „Stimmungsbeeinflussung“, „Fallbeispiele“ und „wissenschaftliche Studien“. Darüber hinaus werden Begriffe wie „Charles-Bonnet-Syndrom“ und „Schizophrenie“ im Zusammenhang mit musikalischen Halluzinationen behandelt.
- Quote paper
- Sabrina Schmidbauer (Author), 2020, Phantomgeräusche. Wie Musik zum Feind wird, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/945055