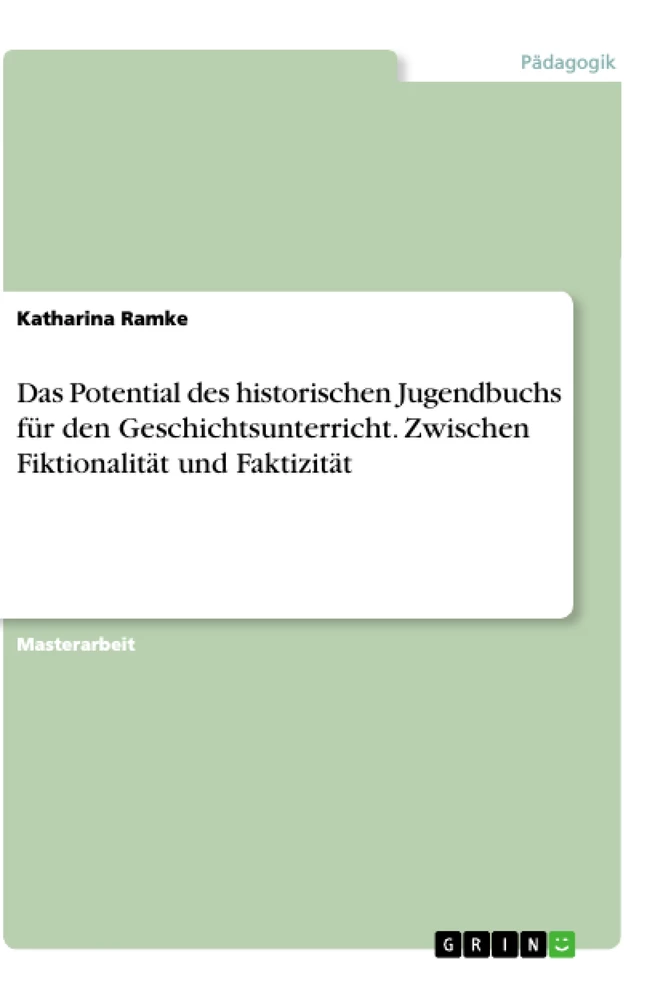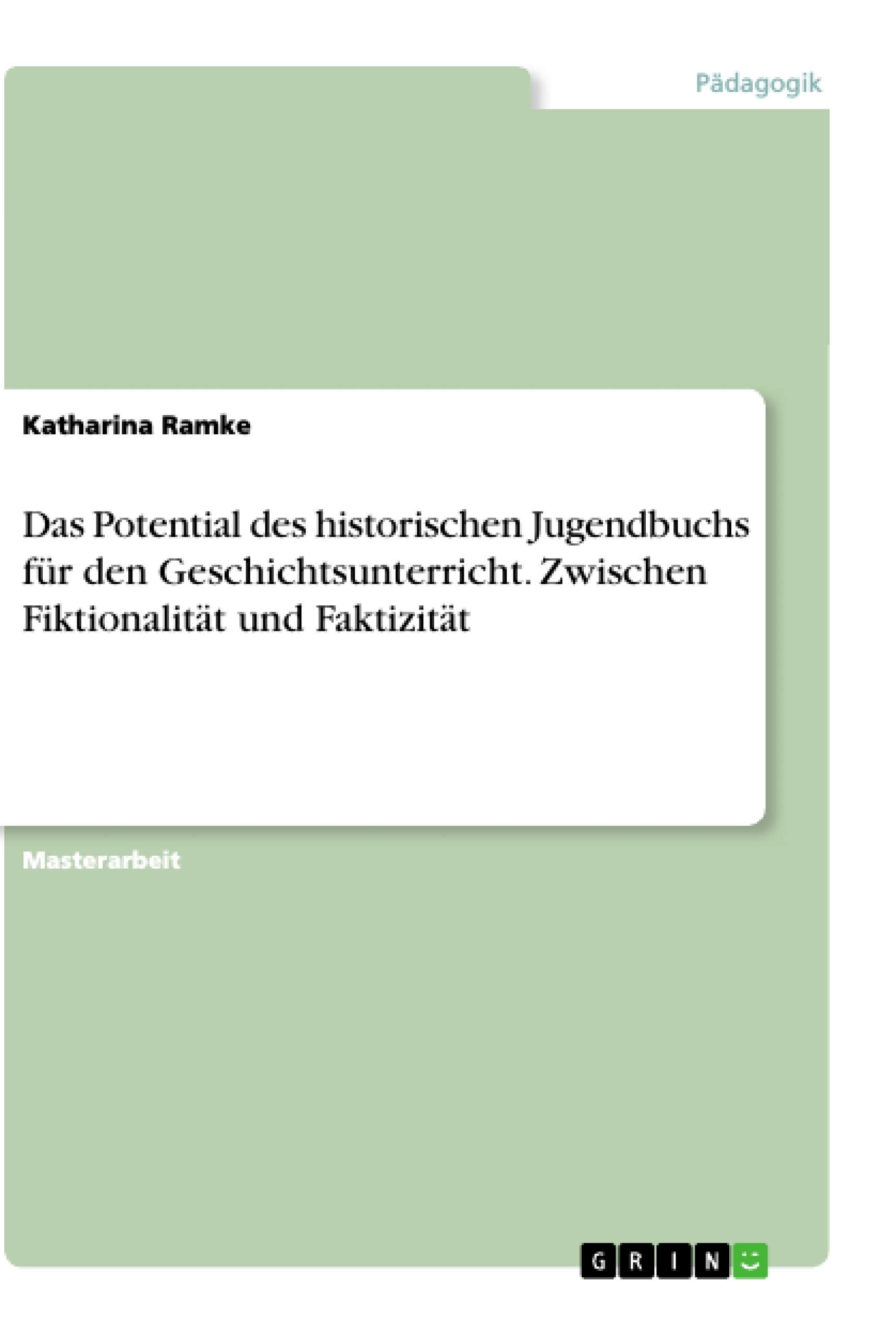In dieser Arbeit geht es um den Einsatz von Fiktionalität im Geschichtsunterricht. Hierbei wird das längst verlorene Medium - das historische Jugendbuch - analysiert. Es wird aufgezeigt, inwieweit dieses Medium ein Potential für den Geschichtsunterricht besitzt. Folgende Forschungsfragen werden gestellt: Welches Potential bietet die Arbeit mit historischen Jugendbüchern und welche Risiken und Schwierigkeiten treten möglicherweise auf? Inwieweit lässt sich das geschichtsdidaktische Prinzip der Multiperspektivität in ausgewählten Jugendbüchern fördern? Inwiefern können historische Jugendbücher als Gegenstand der Wissensvermittlung historischer Sachverhalte dienen?
Für die Durchführung einer qualitativen Analyse wurden zwei historische Jugendbücher herangezogen. Ausgewählt wurden die Bücher "Die Flaschenpost" und "Auf der Sonnenseite" von Klaus Kordon. Beide behandeln die Teilung Deutschlands in Ost und West. Anhand dieser Werke werden die Aspekte der Multiperspektivität und der historischen Triftigkeit analysiert.
Um die obig genannten Forschungsfragen beantworten zu können, wird wie folgt vorgegangen: Um einen Einblick in die wissenschaftliche Forschung der Themenbereiche zu erhalten, wird zunächst der Forschungsstand erläutert. Das Thema umfasst mehrere Aspekte, sodass sich der Stand der Forschung aufspaltet und alle wichtigen Erkenntnisse der bisherigen Forschung beleuchtet und entscheidende Autoren und Autorinnen sowie Veröffentlichungen herausstellt.
Nach der Darbietung des Forschungsstandes folgt der theoretische Teil der Arbeit. Hierbei wird deduktiv vorgegangen, also vom Allgemeinen zum Speziellen.
Den Anfang macht dabei das Kapitel zur Narrativität. In diesem wird der Begriff erläutert und in den Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit, genauer mit dem historischen Erzählen, gebracht. Des Weiteren wird ein kurzer Einblick in die Genese der Narrativität gewährt. Das Kapitel zur Narrativität im Geschichtsunterricht und zum belletristischen Erzählen setzt den Fokus zur Beantwortung der Forschungsfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Geschichtsunterricht und Romane – ein kompatibles Duett?
- Der Stand der Forschung
- Erzählbegriffe
- Das historische Jugendbuch
- Fiktion und Imagination
- Die Erzählbegriffe
- Narrativität und das historische Erzählen
- Genese der Geschichtserzählung
- Narrativität und das belletristische Erzählen im Geschichtsunterricht
- Wer erzählen will, muss zunächst eine Welt errichten
- Der Begriff „historisches Jugendbuch“
- Entwicklung des historischen Jugendbuches
- Fiktionalität und Imagination in der Geschichte
- Fiktion und Faktizität
- Die Fähigkeit der Imagination
- Der Einsatz historischer Jugendbücher im Geschichtsunterricht
- Ein Kriterienkatalog zur Ermittlung „guter“ historischer Jugendbücher
- Vorstellung ausgewählter Werke zur Teilung Deutschlands
- Auswahl der Werke
- Inhaltsangabe der beiden Werke
- „Die Flaschenpost“ von Klaus Kordon, 1999
- „Auf der Sonnenseite“ von Klaus Kordon, 2009
- Vorstellung der Analysekriterien
- Multiperspektivität
- Empirische Triftigkeit
- Sachanalyse zu den inhaltlichen Aspekten der Lektüre
- Sachanalyse zu „Die Flaschenpost“
- Sachanalyse zu „Auf der Sonnenseite“
- Analyse zweier ausgewählter Werke
- Analyse I „Die Flaschenpost“
- Multiperspektivität
- Empirische Triftigkeit
- Analyse II „Auf der Sonnenseite“
- Multiperspektivität
- Empirische Triftigkeit
- Vergleich der Analysen
- Auswertung
- Möglichkeiten und Kritik
- Analyse I „Die Flaschenpost“
- Fazit und Ausblick
- Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit analysiert das Potential des historischen Jugendbuchs für den Geschichtsunterricht. Dabei untersucht sie die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich aus der Verbindung von Fiktionalität und Faktizität im Kontext des Geschichtsunterrichts ergeben. Die Arbeit stellt zwei historische Jugendbücher über die Teilung Deutschlands vor und analysiert diese anhand von Kriterien wie Multiperspektivität und empirische Triftigkeit.
- Das Potential des historischen Jugendbuchs für den Geschichtsunterricht
- Die Verbindung von Fiktionalität und Faktizität im Geschichtsunterricht
- Multiperspektivität im historischen Jugendbuch
- Empirische Triftigkeit historischer Jugendbücher
- Die Rolle der Imagination im Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Relevanz von Romanen für den Geschichtsunterricht. Es werden aktuelle Studien und Forschungsarbeiten herangezogen, die belegen, dass Schülerinnen und Schüler oft über mangelndes historisches Wissen verfügen. Das zweite Kapitel widmet sich dem Stand der Forschung zu Erzählbegriffen, dem historischen Jugendbuch und der Rolle von Fiktion und Imagination. Kapitel drei beleuchtet die Bedeutung von Narrativität und das historische Erzählen. Kapitel vier befasst sich mit dem Begriff des „historischen Jugendbuchs“, seiner Entwicklung und der Frage, wie Fiktionalität und Imagination in der Geschichte eingesetzt werden können. Kapitel fünf stellt zwei ausgewählte Werke zur Teilung Deutschlands vor: „Die Flaschenpost“ und „Auf der Sonnenseite“ von Klaus Kordon. Es werden die Inhaltsangaben der Werke zusammengefasst und die Analysekriterien Multiperspektivität und empirische Triftigkeit vorgestellt. Kapitel sechs analysiert die beiden Werke anhand der zuvor genannten Kriterien.
Schlüsselwörter
Historisches Jugendbuch, Geschichtsunterricht, Fiktionalität, Faktizität, Narrativität, Multiperspektivität, Empirische Triftigkeit, Teilung Deutschlands, Imagination, Studien, Forschung, Erzählbegriffe.
- Quote paper
- Katharina Ramke (Author), 2020, Das Potential des historischen Jugendbuchs für den Geschichtsunterricht. Zwischen Fiktionalität und Faktizität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/944625