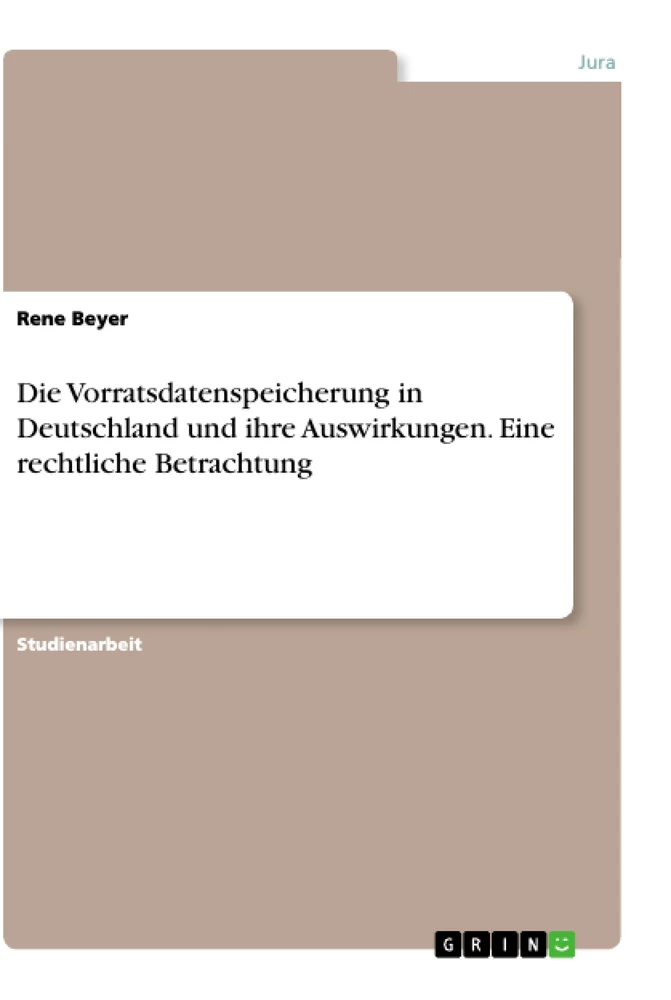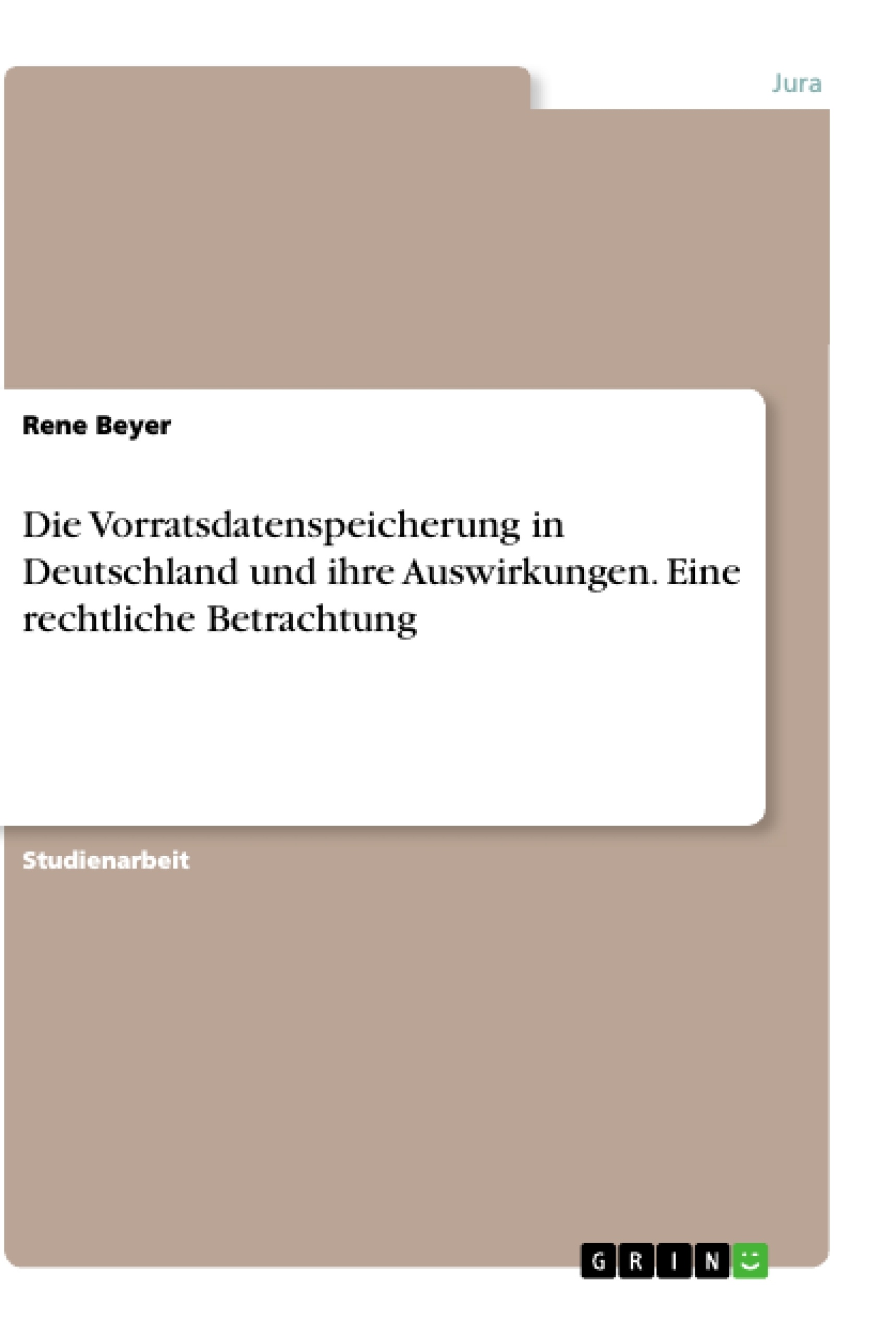Die Arbeit setzt sich damit auseinander, welche Möglichkeiten sich aus den auf Vorrat gespeicherten Telekommunikationsdaten für die Ermittlungsarbeit eröffnen und in welchen Bereichen bisher schon die VDS Anwendung findet. Die Einführung einer VDS steht mittlerweile seit knapp 20 Jahren zur Debatte.
In Kapitel 3 wird dieser Einführungsprozess im Hinblick auf die Gesetzgebungsvorhaben in Deutschland beleuchtet. Anschließend werden die Entscheidungen des BVerfG und des EuGH zur rechtlichen Umsetzung aufgegriffen und die Auswirkungen des EuGH Urteils auf die bestehende deutsche gesetzliche Regelung zur VDS erläutert.
In der DDR gehörte die flächendeckende Überwachung der Bürgerinnen und Bürger zum Alltag. Daraus resultieren folgende Fragen: Welche Auswirkungen hat die zunehmende Überwachung auf unsere Gesellschaft? Wieviel Freiheit darf im Hinblick auf den Datenschutz eingeschränkt werden für sicherheitsrelevante Aspekte? (Kapitel 4). Die Arbeit schließt mit einem Fazit (Kapitel 5) ab.
Seit 2015 haben terroristische Anschläge (Charlie Hebdo, Stade de France, Bataclan-Theater, Flughafen Brüssel-Zaventem, U-Bahnhof Maalbeek, Orlando sowie Promenade des Anglais in Nizza) in hohem Maße zugenommen. Die regierenden Politiker antworten darauf, indem sie die inneren Sicherheitsmaßnahmen verstärken und die Überwachung intensivieren. Die heutigen technischen Möglichkeiten der digitalen Datenerfassung bieten dazu vielfältige Möglichkeiten.
Vor diesem Hintergrund sorgt die vorsorgliche Speicherung der Telekommunikationsdaten aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und Europa für politische und gesellschaftliche Spannungen, da hier Sicherheits- mit Freiheitsinteressen kollidieren. Anlässlich einer Überprüfung der britischen und schwedischen Regelung zur Vorratsdatenspeicherung (VDS) haben die Richter des EuGH im Urteil vom 21.12.2016 die Speicherung ohne Anlass als Verstoß gegen das Europarecht angemahnt. Die kostspielige und von Bürgerrechtlern kritisierte Überwachungsmaßnahme steht nun wieder in der Kritik – mitten in einer Debatte um die öffentliche Sicherheit.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsbestimmung und Anwendungsmöglichkeiten der Vorrats datenspeicherung
2.1 Begriffsbestimmung
2.2 Anwendungsmöglichkeiten der Vorratsdatenspeicherung
3 Rechtliche Betrachtung der Vorratsdatenspeicherung
3.1 Einführung der VDS in der EU und Deutschland
3.2 Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 02.03.2010
3.3 Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 08.04.2014
3.4 Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 21.12.2016
4. Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung
4.1 Auswirkungen auf die aktuelle gesetzliche Regelung zur VDS
4.2 Auswirkungen auf den Datenschutz
4.3 Auswirkungen auf die Gesellschaft
5. Fazit
Literaturverzeichni
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Seit 2015 haben terroristische Anschläge (Charlie Hebdo, Stade de France, Bataclan-Theater, Flughafen Brüssel-Zaventem, U-Bahnhof Maalbeek, Orlando sowie Promenade des Anglais in Nizza) in hohem Maße zugenommen. Die regierenden Politiker antworten darauf, indem sie die inneren Sicherheitsmaßnahmen verstärken und die Überwachung intensivieren. Die heutigen technischen Möglichkeiten der digitalen Datenerfassung bieten dazu vielfältige Möglichkeiten.
Vor diesem Hintergrund sorgt die vorsorgliche Speicherung der Telekommunikationsdaten aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und Europa für politische und gesellschaftliche Spannungen, da hier Sicherheits- mit Freiheitsinteressen kollidieren.1
Anlässlich einer Überprüfung der britischen und schwedischen Regelung zur Vorratsdatenspeicherung (VDS) haben die Richter des EuGH im Urteil vom 21.12.20162 die Speicherung ohne Anlass als Verstoß gegen das Europarecht angemahnt. Die kostspielige und von Bürgerrechtlern kritisierte Überwachungsmaßnahme steht nun wieder in der Kritik - mitten in einer Debatte um die öffentliche Sicherheit.3
Die vorliegende Arbeit setzt sich damit auseinander, welche Möglichkeiten sich aus den auf Vorrat gespeicherten Telekommunikationsdaten für die Ermittlungsarbeit eröffnen und in welchen Bereichen bisher schon die VDS Anwendung findet. (Kapitel 2).
Die Einführung einer VDS steht mittlerweile seit knapp 20 Jahren zur Debatte.4 In Kapitel 3 wird dieser Einführungsprozess im Hinblick auf die Gesetzgebungsvorhaben in Deutschland beleuchtet. Anschließend werden die Entscheidungen des BVerfG und des EuGH zur rechtlichen Umsetzung aufgegriffen und die Auswirkungen des EuGH Urteils auf die bestehende deutsche gesetzliche Regelung zur VDS erläutert.
In der DDR gehörte die flächendeckende Überwachung der Bürgerinnen und Bürger zum Alltag. Diese Erfahrungen prägen Bürgerrechtler wie den Leiter der Stasiunterlagenbehörde (BStU) Roland Jahn noch heute, wenn er Kindern von dieser Zeit berichtet: „Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren“5 Daraus resultieren folgende Fragen: Welche Auswirkungen hat die zunehmende Überwachung auf unsere Gesellschaft? Wieviel Freiheit darf im Hinblick auf den Datenschutz eingeschränkt werden für sicherheitsrelevante Aspekte? (Kapitel 4). Die Arbeit schließt mit einem Fazit (Kapitel 5) ab.
2 Begriffsbestimmung und Anwendungsmöglichkeiten der Vorratsdatenspeicherung
Ausgehend vom Begriff der VDS werden im Folgenden die verschiedenen Einsatzbereiche und deren Umsetzungen erläutert.
2.1 Begriffsbestimmung
Das Voranschreiten der technischen Digitalisierung im 21. Jahrhundert ist der Auslöser für tiefgreifende Umwälzungsprozesse in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.6
Unter dem Begriff Digitalisierung wird vor diesem Hintergrund die Umwandlung von analogen Daten wie beispielsweise Text, Bilder, Musik und Sprache in digitale Werte verstanden. Dabei werden mittels moderner Computertechnik die Inhalte traditioneller Medien digital kodiert, d.h. diese werden basierend auf einem Binärsystem (0 und 1) verschlüsselt und dann gespeichert. Im nächsten Schritt lassen sich digitale Daten auf verschiedenen Datenträgern unabhängig vom Inhalt durch diverse Telekommunikationskanäle transportieren und speichern.7
In der Literatur existieren verschiedene Definitionen zur Sammlung und Speicherung dieser Daten. Demnach wird allgemein unter der VDS „das anlassunabhängige und nicht zweckbezogene Sammeln von personenbezogenen Daten zur späteren Verwendung “8 verstanden.
Aktuell ist in der politischen Diskussion die VDS als „anlassunabhängige Speicherung von Telekommunikationsdaten für Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrzwecke“ 9 definiert. Dabei sollen Telekommunikationsanbieter zur Speicherung von Kundendaten verpflichtet werden, die sie im Rahmen des Vertragsverhältnisses erheben oder verarbeiten (z.B. Standortdaten, gewählte Rufnummern usw.).10
In der Betrachtung dieser beiden Definitionen ist hervorzuheben, dass in der zuletzt aufgeführten Begriffsbestimmung durch den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages die Speicherung nicht mehr zweckfrei verstanden wird, sondern im gezielten Verwenden der gespeicherten Telekommunikationsdaten zur Verfolgung von Straftaten und zur Gefahrenabwehr.
2.2 Anwendungsmöglichkeiten der Vorratsdatenspeicherung
Die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung betrachten die Speicherung der Verkehrsdaten der Telekommunikationsanbieter auf Vorrat als unentbehrlich, um die Verfolgung von Internetkriminalität zu ermöglichen.11 Das Internet durchdringt im heutigen digitalen Zeitalter alle Bereiche des Lebens. Westliche Demokratien, allen voran die USA, welche die gesamte Entwicklung des Internets finanziert haben, hielten sich lange Zeit zurück und griffen kaum regulierend ein. Jedoch zeigt die Entwicklung des globalen Internets, beispielsweise in China mit seinen Sperren, Zensur-Einrichtungen und einem gewaltigen Heer von regierungstreuen Bloggern und Kommentatoren, oder in Russland mit subtileren Internet-Steuerungs- und Überwachungsmethoden, dass ein mehrheitlich freies und staatlich unzensiertes Internet keine Selbstverständlichkeit ist. Im Privatsektor beträgt der wirtschaftliche Schaden durch systematische Industriespionage, durch Ausspionieren unzähliger PCs mit Malware oder dem Verbreiten illegaler Inhalte beispielsweise im Jahr 2009 ca. eine Trillion US-Dollar weltweit. Unter dem Eindruck dieser wachsenden Bedrohungen ist ein Paradigmenwechsel in der Politik der Nichteinmischung der westlichen Staaten festzustellen, welcher zu Überwachungsmaßnahmen und zur VDS führte.12
In Deutschland ist die VDS und Speicherung der Verkehrsdaten im Telekommunikationsgesetz (TKG)13 geregelt. Unter dem Begriff Verkehrsdaten werden demnach alle Daten verstanden, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.14
Die ermittlungstechnischen Einsatzgebiete der gespeicherten Verkehrsdaten beziehen sich auf Bestandsdatenauskünfte und die Ermittlung von Kontaktdaten, die Funkzellenabfrage und das Erstellen von Kommunikations- und Organisationsprofilen.15
Eine Ermittlung der Kontaktdaten bzw. Bestandsdaten eines Anschlussinhabers erfolgt über Suchläufe durch den jeweiligen Telekommunikationsanbieter. Dieser ermittelt den Anschlussinhaber hinter der dynamischen IPAdresse. Diese Daten sind sowohl für die Verfolgung von Transaktionskriminalität, dazu zählt beispielsweise der Handel mit Betäubungsmitteln, bzw. Menschenhandel, als auch bei der Ahndung von Tötungs-, Raub- oder Erpressungsdelikten, relevant. Wurde der Anschluss nicht durch den vermeintlichen Anschlussinhaber genutzt, sondern missbräuchlich, dann führen die Ermittlungen meist ins Leere.16
Mit der Funkzellenabfrage wird die Telekommunikation in einem bestimmten räumlichen und zeitlichen Sektor ausgewertet. Es werden dabei alle Verkehrsdaten mit Tatzeit- und Tatortbeziehung beim Telekommunikationsanbieter abgerufen und mit vorliegenden Verkehrsdaten abgeglichen. Diese Daten werden für die Verfolgung von Serientaten als auch von Einzeltaten als wertvolles Ermittlungsinstrument erachtet, wobei zahlreiche Fälle von Funkzellenabfragen, wie etwa 2011 in Dresden zur Überführung vermeintlicher Straftäter bei einer Anti-Nazi Demonstration, die Wirksamkeit einer Funkzellenabfrage für die Ermittlungsarbeit in Frage stellt, denn das Abrufen dieser Datensätze führte nicht zum Erfolg.17
Das Erstellen von Kommunikations- und Organisationsprofilen mittels der auf Vorrat gespeicherten Verkehrsdaten ermöglicht Aussagen durch die Analyse des Kommunikationsverhaltens, wer wann mit wem wie oft und in welchen Abständen kommuniziert hat. Durch die Auswertung der Kommunikationsmuster ist es möglich die Organisationsstrukturen von terroristischen Vereinigungen zu ermitteln. Zudem kann mittels einer Analyse der Funkzelleninformationen festgestellt werden, wer alles zur gleichen Zeit gemeinsam in einer Funkzelle war. Von Kritikern wird jedoch bezweifelt ob terroristische Vereinigungen Handys für ihre Kommunikation nutzen und nicht andere Kommunikationswege wählen.18
Die gespeicherten Verkehrsdaten ermöglichen es, durch die Symmetrie eines Gesprächs und durch das Zusammenführen von Datensätzen genaue Profile zu erstellen. Diese sollen auch zukünftige Ereignisse vorhersagen. Deshalb sind die erhobenen Vorratsdaten auch für den Austausch und den Datenabgleich mit anderen Staaten im Rahmen der Strafverfolgung für Polizei, Nachrichtendienste oder den Verfassungsschutz interessant. Die Übermittlung dieser Daten ist durch die allgemeinen Datenschutzgesetze geregelt und somit davon abhängig, ob der Drittstaat ein angemessenes Datenschutzniveau aufweist oder eine entsprechend der Datenschutzrichtlinie der EU (EU-DSRL)19 aufgeführten Voraussetzungen für eine Datenübermittlung in einen anderen Staat erfüllt ist.20
Neben der eigentlichen VDS ist das vorbeugende Sammeln von weiteren Daten für die Kriminalitäts- und Terrorbekämpfung im Zeitalter von „Big Data“ von zentraler Bedeutung.
Das Bundeskabinett hat am 10.05.2017 einen Gesetzentwurf zur Erweiterung der VDS beschlossen. Demnach soll auf die gespeicherten Kommunikations- und Standortdaten von Verdächtigen zukünftig auch bei Wohnungseinbrüchen zurückgriffen werden, dazu wurde eine Erweiterung des Straftatenkatalogs im 100 g StPO21 beschlossen.22
Darüber hinaus hat der Bundestag am 22.06.2017 die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikationsdaten (Quellen-TKÜ) für Messenger- Dienste wie WhatsApp beschlossen. Durch eine Schad- und Spionagesoftware sollen die Ermittlungsbehörden Zugriff auf private Geräte, Handys, Laptops und Tablets von Verdächtigen erhalten.23
Zur VDS zählt im weitesten Sinne auch die Speicherung von Verkehrsdaten durch die Einführung der PKW-Maut und die Fluggastdatenspeicherung. Letztere wurde durch das EU-Parlament im April 2016 in der „PNR-RL“24 beschlossen und verpflichtet die europäischen Fluggesellschaften, ihre Fluggastdaten für Flüge von der EU in Drittländer und andersherum den nationalen Behörden zur Verfügung zu stellen. Die Bundesregierung hat am 27.04.2017 die Umsetzung der europäischen Richtlinie im Fluggastdatengesetz beschlossen. Um Sicherheitslücken zu schließen, werden nicht nur die Fluggastdaten für Flüge von der EU in Drittländer, sondern auch Flüge zwischen den Mitgliedstaaten einbezogen. Polizeibehörden sollen bei der Verhinderung geplanter Anschläge oder anderer schwerer Straftaten unterstützt werden, indem personenbezogene Daten von Flugpassagieren - wie Name, Adresse, Kreditkartennummer
Gepäckstücke oder Mitreisende - bis zu fünf Jahre lang gespeichert und bei Bedarf zwischen den EU-Staaten ausgetauscht werden.25
Für die Speicherung der Verkehrsdaten durch die Einführung der PKW-Maut haben sich die Innenpolitiker ausgesprochen. Im Zusammenhang mit der Mauterhebung sollen die gewonnenen Daten grundsätzlich für Ermittlungsund Fahndungszwecke genutzt werden.26 Derzeit werden auf Autobahnen an den Mautstellen des Systembetreibers „Toll Collect“ Nummernschilder, Größe, Achsenzahl und eine Schrägansicht aller vorbeifahrenden Fahrzeuge gescannt. Bei mautpflichtigen Lkw erfolgt ein zweiter Abgleich ob der Halter die Maut gezahlt hat. Die Daten werden bisher nur gespeichert, wenn keine Bezahlung erfolgte. Die Polizei darf derzeit nicht auf diese erhobenen Daten zugreifen, sondern nutzt eine Software zur Kennzeichenerfassung mittels aufgestellter Videokameras. Die systematische Speicherung und Verwendung aller Mautdaten für die polizeiliche Ermittlungsarbeit oder andere Zwecke ist insgesamt nur eine Softwarefrage, weshalb die Innenminister darauf drängen diese im Rahmen des neuen PKW-MautGesetzes auswerten zu dürfen.27 Die Befürworter der VDS sehen in der Speicherung der Verkehrsdaten ein notwendiges Kontroll- und Überwachungsinstrument, um schwere Kriminalität zu bekämpfen und dadurch die öffentliche Sicherheit aufrecht zu erhalten.28
Der Abgleich der verschiedenen Datenquellen und Wissensspeicher wie beispielsweise biometrische Identitätspapiere, DNA Verbunddateien, Fahndungsdatenbanken oder der Videoüberwachung mit den gesammelten Kommunikationsdaten der Vorratsdatenspeicherung macht die VDS so interessant in der Verbrechensbekämpfung.29
Spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 und der verstärkten Sensibilisierung für terroristische Bedrohung sind private, zivilöffentliche und militärische Aspekte der Überwachung kaum noch zu trennen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass auch die entsprechenden technischen Infrastrukturen zusammengelegt werden. Das gestiegene Sicherheitsbedürfnis und der sogenannte Krieg gegen den Terror sind seit dem 11. September 2001 die besten Vehikel für politische Maßnahmen, die in Friedenszeiten kaum Chancen auf Durchsetzung gehabt hätten. Das Interesse staatlicher Institutionen an diesen Daten der Bürgerinnen und Bürger kann über den Aspekt der Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung hinaus auch für den politischen Machterhalt missbraucht werden.30
Aufgrund der voranschreitenden technischen Entwicklungen ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren weitere Einsatzmöglichkeiten und neue technischen Möglichkeiten in der VDS hinzukommen.
3 Rechtliche Betrachtung der Vorratsdatenspeicherung
Im Fortlauf der Hausarbeit soll der Focus der Betrachtung auf der eigentlichen VDS liegen. Ausgehend vom Einführungsprozess des Gesetzgebungsverfahrens werden im Folgenden die jeweiligen rechtlichen Entscheidungen des BVerfG und des EuGH dargelegt.
3.1 Einführung der VDS in der EU und Deutschland
Die Diskussion in der Einführung der VDS geht auf das sogenannte Volkszählungsgesetz (VZG) aus dem Jahr 1983 zurück. Sämtliche Einwohner der Bundesrepublik Deutschland sollten statistisch erfasst werden. Das VZG enthielt Vorschriften darüber, wie und mit welchem Inhalt die Befragungen durchgeführt werden sollten, was nach den Befragungen mit den gewonnenen Informationen geschehen sollte und wie und wofür sie verwendet werden sollten. Dagegen wehrten sich zahlreiche Betroffene vor dem Bundesverfassungsgericht.31
Das BVerfG formulierte am 15.12.1983 im sogenannten „Volkszählungsurteil“32 das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auf Grundlage des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Menschenwürde. Dieses gibt grundsätzlich jedem Bürger das Recht, selbst zu entscheiden, welche Daten von ihm erhoben und verwertet werden.33
Von dort hat sich das Recht auf Privatsphäre rasant verbreitet und europäisiert, bis es ab dem Inkrafttreten der „Grundrechtecharta“ (GRCh)34 im Jahr 2009 als europäisches Grundrecht, sämtliche Organe der EU, insbesondere die europäische Gesetzgebung, ausdrücklich zu binden begann, und zwar in gleich zwei Ausformungen: als Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 7) und als Recht auf den Schutz personenbezogener Daten (Art. 8). Schon davor bildete die EU-DSRL35, welche durch die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation (ePrivacy-RL)36 im Jahr 2000 konkretisiert wurde, die europäischen Grundpfeiler des Datenschutzes. Die ePrivacy-RL stellt ein grundsätzliches Verbot auf, Verkehrs- und Standortdaten ohne Einwilligung zu speichern, solange der Eingriff nicht der Strafvereitelung und -verfolgung dient.37 Wenig später wurde die europaweite VDS angedacht.
Im Folgenden werde ich auf die Einführung der VDS in Deutschland eingehen, die seit Mitte der 1990er debattiert wird.
Im Jahr 1996 forderte der Bundesrat im Rahmen der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes die Einführung von Mindestspeicherfristen, was von der damaligen Bundesregierung abgelehnt wurde. Die Regierung war der Ansicht, dass Mindestspeicherpflichten gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und gegen die Grundsätze von Zweckbindung und Erforderlichkeit verstoßen würden.38
In einem weiteren Versuch forderte im Jahr 2000 die Innenministerkonferenz der Länder die Einführung der VDS, die jedoch von den Datenschutzbeauftragten als unverhältnismäßig kritisiert wurde. Aufgrund der Terroranschläge vom 11. September 2001 und der verschärften Sicherheitspolitik, wurde erneut ein Gesetzesentwurf zur Einführung von Mindestspeicherfristen in den Bundesrat eingebracht. Auch dieser wurde wegen verfassungsrechtlicher Bedenken abgelehnt.39
Im März 2002 verabschiedete der Bundesrat, zur Verbesserung der Ermittlungsmaßnahmen gegen Kinderpornographie einen Gesetzesentwurf zur Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten. Dieser wurde ebenfalls wegen datenschutzrechtlicher Bedenken vom Bundestag abgelehnt. In einer Stellungnahme zum Regierungsentwurf des neuen Telekommunikationsgesetzes forderte der Bundesrat dann 2003 die Telekommunikationsdienstanbieter zur Speicherung von Verkehrsdaten, soweit diese erhoben werden, zu verpflichten. Die Bundesregierung entsprach dem nicht. Das Gesetzgebungsvorhaben kam vor den Vermittlungsausschuss und konnte sich nicht durchsetzen.40
Beeinflusst von den terroristischen Anschlägen in Madrid 2004 und London 2005 wurde in Brüssel die „Vorratsdatenspeicherungs-Richtlinie“ (VDS-RL)41 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten verabschiedet, welche zum 3. Mai 2006 in Kraft trat. Die VDS-RL verpflichtete alle Mitgliedsstaaten, zur Umsetzung der VDS. Die Umsetzung der Speicherpflicht der Telefonie-Daten sollte bis 15. September 2007 und der Internet-Daten bis 15. März 2009 in nationalen Gesetze erfolgen.42
Bezüglich des Internets werden die privaten Internet Service Providers der EU-Länder verpflichtet, sämtliche Identitäten, E-Mail-Anschriften der Teilnehmer und IP-Adressen nach Art, Datum, Ort und Dauer jeder erfolgten Verbindung zum Zwecke der Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von schweren Straftaten zu speichern. Dabei sahen insbesondere Art. 3 und 5 der VDS-RL vor, dass bestimmte Daten, die eine Identifizierung oder Rückverfolgung der Quelle ermöglichen, nicht nach der notwendigen Generierung und Verarbeitung durch die Telekommunikationsdienste gelöscht werden dürfen. Inhaltsdaten waren gem. Art. 5 Abs. 2 der VDS-RL von der Speicherung ausgenommen. Juristen und Datenschützer bezweifeln allerdings die ausgenommene Speicherung der Inhaltsdaten, da sich in der Betrachtung der Historie besuchter Webseiten aussagekräftige Persönlichkeitsprofile erstellen lassen.43
Die VDS-RL ist für jeden Mitgliedstaat der EU verbindlich, dabei wird den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel zur Umsetzung überlassen (Art. 288).44 Daraus folgt, dass eine Richtlinie zur innerstaatlichen Wirksamkeit grundsätzlich der Umsetzung in nationales Recht bedarf. Dies geschieht in der Regel durch ein Umsetzungsgesetz, dass die Anpassung oder Neuschaffung nationaler Gesetzesregelungen bewirkt. Die Richtlinie kann somit als zweistufiges mittelbares Rechtsetzungsinstrument des Gemeinschaftsrechts bezeichnet werden.45
In Deutschland erfolgte die Durchführung der VDS-RL durch das „Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG vom 21.12.2007“46. Die Pflichten der Telekommunikationsanbieter, Telekommunikationsverkehrsdaten von allen Telekommunikationsteilnehmern in ganz Deutschland ohne Anlass für sechs Monate auf Vorrat zu speichern und auf Verlangen den zuständigen Behörden herauszugeben, wurden in §§ 113 a und 113 b TKG 2008 geregelt. Die Zulässigkeit des Datenabrufs durch die zuständigen Behörden regelte das jeweilige Fachrecht z.B. § 100 g StPO.47
Das BVerfG erklärte zwei Jahre nach dem Inkrafttreten die Regelungen zur Umsetzung der VDS-RL mit Urteil vom 2. März 201048 die Regelungen in §§ 113 a und 113b TKG 2008 sowie in § 100 g StPO 2008 für verfassungswidrig und nichtig (siehe Punkt 3.2 dieser Hausarbeit).49
Mit dem Urteil vom 8. April 201450 erklärte schließlich der EuGH die Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten für nichtig (siehe Punkt 3.3 dieser Hausarbeit), da diese gegen die in der GRCh verbrieften Rechte auf die „Achtung des Privatlebens" und den „Schutz personenbezogener Daten" verstoße und der Grundrechtseingriff nicht auf das Notwendigste beschränkt ist.51
Obwohl die Aussagen des EuGH klar dargelegt wurden, haben die Mitgliedstaaten infrage gestellt, ob diese auf die nationalen Gesetze zur VDS anzuwenden sind und dort die anlasslose und flächendeckende Speicherung aller relevanten Verkehrsdaten aller TK-Teilnehmer verbieten.52
Trotz der nunmehr entfallenen Verpflichtung wurde in Deutschland das „Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten“53 vom 10.12.2015 beschlossen. Das Gesetz trat am 18.12.2015 in Kraft. Danach sind Standortdaten von Mobilfunktelefonaten und mobiler Internetnutzung für vier Wochen zu speichern. Die Speicherfrist für Verkehrsdaten von Telefonaten, SMS und Internetnutzung beträgt 10 Wochen.54
Die Richter des EuGH in Luxemburg haben im Urteil vom 21.12.2016 (Az.: C-203/15, C-698/15)55 die aufgekommenen Zweifelsfragen zur Umsetzung der VDS in den nationalen Gesetzen bezogen auf die britischen und schwedischen Regelungen ausgeräumt. Das OVG Stockholm und das Berufungsgericht für England und Wales wollten durch die Überprüfung des EuGH wissen, ob die nationalen Regelungen zur VDS dem Unionsrecht unterliegen.56
Der EuGH stellt zunächst klar, dass nationale Vorratsdatenregelungen auch nach Ungültigkeitsklärung der VDS-RL dem Unionsrecht unterfallen. Schon die Speicherung dürfe nicht ohne Zusammenhang zu einer Straftat erfolgen, sondern müsse zielgenau eingesetzt werden und müsse hinsichtlich der Kategorien von zu speichernden Daten, der erfassten Kommunikationsmittel, der betroffenen Personen und der vorgesehenen Speicherungsdauer auf das absolut Notwendigste beschränkt sein. Bei Betroffenen entstünde sonst das Gefühl ständiger Überwachung. Dadurch werde gegen das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens verstoßen. Eine Regelung, die nicht auf Aspekte Bezug nimmt, die mit einer schweren Straftat zusammenhängen, ist in einer demokratischen Gesellschaft nicht zu rechtfertigen, wie es die Richtlinie in Bezug zur GRCh verlangt.57
Die Bundesregierung hält das geltende Gesetz in Deutschland zur VDS jedoch weiterhin für verfassungs- und europarechtskonform, insbesondere wegen der kurzen Speicherfristen im europäischen Vergleich.58
3.2 Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 02.03.2010
Im Dezember 2007 wurde die erste Verfassungsbeschwerde zum „Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG“59 beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht.
Die gesetzliche Umsetzung ging in einigen Punkten über die Anforderungen der VDS-RL60 hinaus. Die gespeicherten Verbindungsdaten durften auch zur Aufklärung von Verbrechen, die per Telekommunikation begangen wurden, herangezogen werden - und zwar unabhängig von deren Schwere. Diese konnten also auch zur Verfolgung von per Telekommunikation begangenen Bagatelldelikten herangezogen werden, z.B. beim unerlaubten Herunterladen von Musik. Zusätzlich wurde ferner eine Zugriffsmöglichkeit für die Geheimdienste verankert, während aber der Zugriff auf Strafverfolgungsbehörden durch die Richtlinie gleichzeitig beschränkt wurde. Für den Zugriff durch die Geheimdienste war kein Richtervorbehalt nötig. In der Entscheidung des BVerfG vom 28.10.2008 (1 BvR 256/08)61 - im Verfahren der einstweiligen Anordnung - wurden diese über die Richtlinie hinausgehenden Punkte ausgesetzt. Das Urteil in der Hauptsache erging am 2. März 2010.62
Das BVerfG hat in seinem Urteil (1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08)63 die gesetzliche Regelung zur VDS gekippt, jedoch die VDS- RL64 nicht angegriffen. Das Gericht hat die VDS nicht grundsätzlich als verfassungswidrig eingestuft. Der Senat sieht die sechsmonatige anlasslose Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten zu Zwecken der Strafverfolgung, Gefahrenabwehr und des Nachrichtendienstes nicht als schlechthin unvereinbar mit Art. 10 GG65 an, moniert jedoch, dass die Ausgestaltung der §§113 a und 113 b TKG66 sowie des § 100 g StPO67 nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Sicherung der gespeicherten Daten gegen Missbrauch die Beschränkung ihrer weiteren Verwendung dem Verhältnismäßigkeitsanforderungen sowie deren rechtliche Kontrolle genüge und der Zugang von Behörden zu den Daten keinem Richtervorbehalt unterliegt.68
Das Gericht stellt fest, dass die überprüften Vorschriften in das durch Art. 10Abs. 1 GG geschützte Telekommunikationsgeheimnis eingreifen. Zur verfassungsrechtlichen Identität der BRD gehört, dass die Freiheitswahrnehmung der Bürger nicht total erfasst und registriert werden darf. Den Eingriff wertete das Gericht daher als besonders intensiv aufgrund seiner Anlasslosigkeit, dem Risiko weiteren Ermittlungsmaßnahmen ausgesetzt zu werden, ohne dazu Anlass gegeben zu haben und durch Streubreite der Maßnahme „die auf eine möglichst flächendeckende vorsorgliche Speicherung aller für die Strafverfolgung oder Gefahrenprävention nützlichen Daten zielte. Eine solche Gesetzgebung wäre (...) von vornherein mit der Verfassung unvereinbar.“ 69 Darüber hinaus erlaube eine Auswertung der Daten, sowohl Rückschlüsse auf den Inhalt der Kommunikation zu ziehen als auch umfassende Bewegungs- und Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Die Daten dürfen beispielsweise nicht vom Staat gespeichert werden. Einer Speicherung durch private Dienstanbieter steht dem wiederum nicht entgegen, da diese allein als Hilfspersonen für die Aufgabenerfüllung durch staatliche Behörden in Anspruch genommen werden. Weiterhin soll dadurch verhindert werden, dass eine zentrale Datenbank und so eine zentrale Überwachungsbehörde entstehen kann.70
Das BVerfG legt dar, dass die Datensicherheit aufgrund des Umfangs und der potenziellen Aussagekraft der Datenbestände für die Verhältnismäßigkeit von großer Bedeutung sei. Das Gericht nennt verschiedene technische Maßnahmen, die bei der VDS umgesetzt werden sollten. Hierzu müssen die Provider beispielsweise Folgendes sicherstellen:
- eine getrennte Speicherung,
- Stand-Alone Systeme,
- asymmetrische Verschlüsselung der Daten unter getrennter Verwahrung der Schlüssel,
- Vier-Augen-Prinzip in Verbindung mit fortschrittlichen Authentifizierungsverfahren für den Zugriff auf die Daten,
- eine revisionssichere Protokollierung der Zugriffe und der Löschung und
- Einsatz automatisierter Fehlerkorrektur- und Plausibilitätsverfahren.
Diese detaillierten technischen Ausführungen zeigen, welche hohe Bedeutung das Gericht den Vorgaben für die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme beimisst.71
Das Urteil bedeutete bis zum Inkrafttreten eines neuen Gesetzes das einstweilige Ende der VDS in Deutschland. Bereits gespeicherte Kommunikationsdaten mussten unverzüglich gelöscht werden und durften nicht zur Strafverfolgung an die Behörden weitergeleitet werden. Weiter wurde dem Gesetzgeber detailliert vorgeschrieben, wie mögliche Neuregelungen gefasst werden sollen.72
Für Geheimdienste und den polizeilichen Staatsschutz werden neue Kriterien und Regelungen in den landesspezifischen Polizeigesetzen notwendig.
Diese Dienste dürften nur auf Telekommunikationsdaten zugreifen, wenn es zur Bedrohung der wichtigen Rechtsgüter kommt, kurzum: zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder zum Schutz des Bundes oder eines Bundeslandes. Vermutungen genügen demnach nicht. Vor dem Hintergrund, dass nach Maßgabe des Urteils die Verwendung der Daten von Seiten der Nachrichtendienste in vielen Fällen ausscheiden dürfte und eine völkerrechtliche Verpflichtung insoweit nicht besteht, der rechtsund sicherheitspolitische Diskurs andererseits auf ein Ausschöpfen möglicher Befugnisse zur Terrorismusbekämpfung nicht verzichten wird, dürfte in diesem Bereich eine Art symbolischer Gesetzgebung zu erwarten sein. Außerdem verlangen die Karlsruher Richter eine klare Begrenzung im Umfang. Nicht jede Ermittlung braucht alle verfügbaren Daten, heißt es im Urteil.73
Ausgeschlossen vom Ermittlungsinstrument der VDS wird nach Ansicht des Gerichts der Kreis der Berufsgeheimnisträger, aufgrund des bestehenden Vertrauensverhältnisses und der aus den Daten aufbereitenden weitreichenden Schlüsse auf Gesundheit und Geisteszustand, Religion oder finanzielle Verhältnisse. Das Gericht argumentiert, dass den negativen Auswirkungen durch die VDS kein messbares öffentliches Interesse gegenüberstehe. Angesichts der geringen Zahl von Verfahren, in denen es auf die Kommunikation von und mit Berufsgeheimnisträgern ankomme, seien die Belange des Rechtsgüterschutzes auch ohne VDS gewährleistet.74 Die EU-Kommission verfolgte aufgrund des Aussetzens der VDS ein Vertragsverletzungsverfahren, da Deutschland seit 2013 der letzte Mitgliedsstaat war, der die VDS-Richtlinie noch nicht umgesetzt hatte.
Im Urteil des EuGH vom 08.04.201475 wurde die VDS-RL76 mit allgemeiner Wirkung für von Anfang an ungültig erklärt. Damit ist die in der Richtlinie enthaltene Umsetzungspflicht entfallen und das Vertragsverletzungsverfahren seiner Grundlage beraubt.77
3.3 Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 08.04.2014
Einige Mitgliedsländer haben sich über das jeweilige Verfassungsgericht in einem Ersuchen an den EuGH gewandt. In Irland wurde die Klage gegen die „Richtlinie 2006/24/EG“78 von der Bürgerrechtsorganisation Digital Rights unterstützt. In Österreich gehörte die Kärntner Landesregierung zu den Klägern. Beide bezweifeln, dass die VDS mit der GRCh79 und dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten unvereinbar sei.80
In seinem Urteil „Digital Rights Ireland“ vom 08.04.2014 (C-293/12 und C-594/12)81 hat der EuGH die VDS-RL von Anfang an wegen Verstößen gegen Art. 7 und 8 der GRCh82 für ungültig und nichtig erklärt. Das Gericht stellte fest, dass die Bekämpfung des internationalen Terrorismus sowie die Bekämpfung schwerer Kriminalität dem Gemeinwohl der EU dient, aber dennoch eine VDS nicht zu rechtfertigen vermag, wenn der damit verbundene Grundrechtseingriff nicht auf das absolut Notwendige beschränkt ist. Diese Beschränkung habe die VDS-RL dadurch verfehlt, dass sie zu „einem Eingriff in die Grundrechte fast der gesamten europäischen Bevölkerung“ 83 führt, ohne Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Die flächendeckende und anlasslose VDS betreffe alle Personen, die elektronische Kommunikationsdienste nutzen, ohne dass sich jedoch die Betroffenen auch nur mittelbar in einer Lage befinden, die Anlass zur Strafverfolgung geben könnte. Sie gelte auch für Personen, bei denen keinerlei Anhaltspunkt dafür besteht, dass ihr Verhalten in einem auch nur mittelbaren oder entfernten Zusammenhang mit schweren Straftaten stehen könnte. Zum anderen stelle die VDS keinen Zusammenhang zwischen den VDS-Daten und einer Bedrohung der öffentlichen Sicherheit her. Insbesondere beschränke sich die VDS „weder auf die Daten eines bestimmten Zeitraums und/oder eines bestimmten geografischen Gebiets und/oder eines bestimmten Personenkreises, der in irgendeiner Weise in eine schwere Straftat verwickelt sein könnte, noch auf Personen, deren auf Vorrat gespeicherte Daten aus anderen Gründen zur Verhütung, Feststellung oder Verfolgung schwerer Straftaten beitragen könnten“84. Auch müsse es für eine VDS ein „objektives Kriterium“ geben, das den Zugang der Behörden zu den Daten auf einen Zweck beschränkt, der den schweren Grundrechtseingriff zu rechtfertigen vermag. Auch beruhe die jetzige Speicherzeit von mindestens sechs Monaten und maximal zwei Jahren auf keiner nachvollziehbaren Basis.85
Der EuGH hat damit die „Richtlinie 2006/24/EG“86 (VDS-RL) am 08.04.2014 für unwirksam erklärt. Für die Mitgliedsstaaten besteht damit keine Verpflichtung zur Einführung der VDS aufgrund dieser Richtlinie. Die Bundesregierung erklärte 2015 überraschend die VDS für notwendig. Der Gesetzgeber beschloss in der Folge das „Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten“87 vom 10.12.2015, welche am 18.12.2015 in Kraft trat. Hierzu sind mehrere Verfahren beim BVerfG anhängig.88
Einige Mitgliedstaaten haben infrage gestellt, ob das Urteil des EuGH vom 08.04.2014 (C-293/12 und C-594/12)89 auf die nationalen Gesetze zur VDS anzuwenden ist und damit die anlasslose und flächendeckende Speicherung aller relevanten Verkehrsdaten aller TK-Teilnehmer verbietet. Dabei wurde geltend gemacht, dass nationale Gesetze zur VDS nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fielen. Insbesondere wurde bestritten, dass für solche Regelungen Art. 15 der ePrivacy-RL90 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation einschlägig sei. Zum anderen wurde vorgetragen, dass das Urteil des EuGH nur eine Unions-Richtlinie betreffe und das Gericht keine Maßstäbe für nationale Regelungen der VDS aufstellen wollte. Für deren rechtliche Bewertung seien die besonderen Ziele, der jeweilige Regelungskontext und weitere, spezifische Umstände zu berücksichtigen. Außerdem habe der EuGH eine Reihe von Kriterien aufgestellt, die nicht alle erfüllt sein müssten, damit eine Regelung als verhältnismäßig angesehen werden könne.91 Alle Zweifelsfragen wurden durch das Urteil des EuGH vom 21.12.2016 ausgeräumt.92
3.4 Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 21.12.2016
Das Urteil des EuGH vom 21.12.2016 (C-203/15 und C-698/15)93 zur VDS lehnt sich eng an das Urteil „Digital Rights Ireland“ vom 08.04.2014 (C-293/12 und C-594/12)94 an, mit dem das Gericht die VDS-RL für ungültig erklärt hatte. Da sich der Unionsgesetzgeber zu keiner Reform der Regelungen zur VDS aufgrund des Urteils hat durchringen können, gelten nunmehr in den meisten Mitgliedstaaten unterschiedliche nationale Bestimmungen, die ursprünglich die EU-Richtlinie umsetzten und nur teilweise nach dem EuGH Urteil vom 08.04.2014 revidiert wurden.95
In diesem Zusammenhang richteten das OVG Stockholm (Rs. C-203/15) und das Berufungsgericht für England und Wales, Abteilung für Zivilsachen (Rs. C-698/15) ihre Vorlageersuchen an den EuGH. Die Vorlagefragen betrafen die nationalen Gesetze zur VDS in Schweden und im Vereinigten Königreich, welche zur Umsetzung der VDS-RL von 2006 erlassen und nach deren Nichtigerklärung als rein nationale Regelungen beibehalten wurden. Beide vorlegenden Gerichte wollten wissen, ob diese nationalen Regelungen dem Unionsrecht unterliegen und Art. 15 der EU-Datenschutzrichtlinie96 in seinem durch Art. 7 und Art. 8 der GRCh97 geprägtem Verständnis entsprechen. Neben Schweden und dem Vereinigten Königreich beteiligten sich dreizehn weitere Mitgliedstaaten an dem Verfahren, was die Bedeutung des Verfahrens unterstreicht.98
Der EuGH stellte im Urteil vom 21.12.2016 (C-203/15 und C-698/15)99 zuerst fest, dass nationale Vorratsdatenregelungen auch nach Ungültigkeitserklärung der VDS-RL dem Unionsrecht unterfallen. Insofern sei die ePrivacy-RL100 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation anwendbar.101 Der Artikel 1 der EU-Datenschutzrichtlinie102 ziele auf eine Harmonisierung von Vorschriften, um einen gleichwertigen Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten, insbesondere des Rechts auf Privatsphäre und Vertraulichkeit, in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich der elektronischen Kommunikation zu gewährleisten. Nach Art. 3 regele die EU-DSRL die Verarbeitung personenbezogener Daten in elektronischen Kommunikationsdiensten durch die Betreiber solcher Dienste. Der Art. 15 der EU-Datenschutzrichtlinie erlaube den Mitgliedstaaten, Rechtsvorschriften zu erlassen, die bestimmte Rechte und Pflichten zur Gewährleistung des Datenschutzes beschränken, insbesondere in der Aufbewahrung der Daten. Diese Vorschrift könne - so der EuGH - diese Erlaubnis nur aussprechen, wenn sie für die Mitgliedstaaten beim Erlass von Regelungen zur VDS gilt.103 Dies gelte insbesondere für Rechtsvorschriften, die den Betreibern elektronischer Kommunikationsdienste vorschreiben, Verkehrs- und Standortdaten auf Vorrat zu speichern, aber auch für Rechtsvorschriften, die den Zugang der nationalen Behörden zu den von den Betreibern elektronischer Kommunikationsdienste auf Vorrat gespeicherten Daten betreffen,104 weil diese Rechte der Nutzer und Pflichten der Betreiber modifizieren.105
Da die nationalen Regelungen unter das Unionsrecht fallen, gelten nach Ansicht des EuGH für diese auch die Grundrechte aus Art. 7, 8, 11 und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach Art. 52 Grundrechtecharta106. Die nationalen Beschränkungen dieser Grundrechte müssen, so der EuGH, nach Art. 15 der EU-DRSL für die öffentliche Sicherheit sowie die Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig, angemessen und verhältnismäßig 1“ 107 sein. Außerdem müssen Ausnahmen für Kommunikationsvorgänge bestehen, die einem Berufsgeheimnis unterliegen. Die Regelungen zur VDS müssen stets objektiven Kriterien genügen, die einen Zusammenhang zwischen den zu speichernden Daten und dem verfolgten Ziel herstellen. Diese Voraussetzungen müssten insbesondere in der Praxis geeignet sein, den Umfang der Maßnahme und infolgedessen die betroffenen Personenkreise wirksam zu begrenzen.108
Die nationalen Regelungen müssen laut EuGH außerdem vorsehen, dass auch der Zugang von Behörden zu den Daten der VDS nur innerhalb des absolut Notwendigsten stattfindet. Insofern dürfe im Zusammenhang mit dem Zweck der Bekämpfung von Straftaten der Zugang grundsätzlich nur zu den Daten von Personen gewährt werden, die im Verdacht stehen, eine schwere Straftat zu planen, zu begehen oder begangen zu haben oder auf irgendeine Weise in eine solche Straftat verwickelt zu sein. Dies müsse durch eine vorherige Kontrolle entweder durch ein Gericht oder eine unabhängige Verwaltungsstelle abgesichert sein.109
4 Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung
Das Urteil des EuGH vom 21.12.2016 hat insbesondere Auswirkungen auf die geltende gesetzliche Regelung in Deutschland zur VDS und den Datenschutz. Im letzten Punkt dieses Kapitels wird auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der VDS im Kontext der Digitalisierung eingegangen.
4.1 Auswirkungen auf die aktuelle gesetzliche Regelung zur VDS in Deutschland
Mit seinen Urteilen vom 08.04.2014 (C-293/12 und C-594/12)110 und vom 21.12.2016 (C-203/15 und C-698/15)111 hat der EuGH entschieden, dass eine dauerhafte, anlasslose, flächendeckende und verhaltensunabhängige VDS gegen Art. 7 und 8 der GRCh112 verstößt. Dies gilt unabhängig davon, ob sie auf der Ebene der Union oder der der Nationalstaaten normiert wird.113
Der deutsche Gesetzgeber hat im „Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten“114 vom 10. Dezember 2015, die Pflichten zur VDS im §§ 113 a-113 g TKG115 geändert. Die Anforderungen des EuGH aus dem Urteil „Digital Rights Ireland“116 vom 08. April 2014 wurden in vielen Detailregelungen umgesetzt. Den Hauptkritikpunkt, den nun der EuGH am 21.12.2016117 ausdrücklich für die nationalen VDS-Gesetze bestätigt, wurde ignoriert, nämlich die Begrenzung der VDS auf das jeweils absolut Notwendige. Bisher werden alle relevanten TK-Verkehrsdaten, anlasslos, flächendeckend, personell, zeitlich und geografisch undifferenziert erfasst und gespeichert.118
Die Abfrage der Telekommunikationsdaten ist bisher ohne einen Richtervorbehalt möglich. Nach dem Urteil des EuGH ist im Einzelfall eine VDS nur vorzunehmen, wenn ein ausreichender Anlass besteht. Personen dürfen nur erfasst sein, die einen Anhaltspunkt für einen Bezug zu schweren Straftaten bieten. Die VDS muss auf die Region begrenzt sein, für die der Anlass gilt, und darf nur für einen bestimmten Zeitraum gelten, in dem der Anlass besteht, und darf nur die TK-Medien betreffen, die für den Anlass zur Bekämpfung schwerer Straftaten relevant sind. Ebenfalls darf die VDS nur die Daten erfassen, die für die Aufklärung der Straftat unerlässlich sind. Diese Anforderungen erfüllen die §§ 113 a-113 g TKG119 nicht.120
Daher sind die Gesetzgeber in Bund und Ländern theoretisch aufgefordert, ihr bestehendes Recht an die neue Rechtslage anzupassen. Die aktuelle deutsche Rechtslage verstößt gegen die vom EuGH aufgestellten Anforderungen und damit gegen europäische Grundrechte. Aufgrund des grundsätzlichen Anwendungsvorrangs des Unionsrechts dürfen die deutschen Vorschriften über die VDS, insbesondere §§ 113a ff. TKG, nicht angewandt werden.121
Daher muss die letzte Runde des Streits um die VDS darin bestehen, die §§ 113 a-113 g TKG122 sowie §§ 100 g und 100 j StPO123 aufzuheben. Ab dem 1. Juli 2017 sind die Speicherpflichten gem. § 150 XIII TKG124 zu erfüllen. Die Aufhebung der unionsrechtswidrigen Regelungen sollte durch den Gesetzgeber daher vor diesem Zeitpunkt erfolgen.125
Die Bundesregierung hat auf Anfrage verschiedener Abgeordneter erklärt, dass die Prüfung der Schlussfolgerungen aus dem EuGH-Urteil vom 21.12.2016 (C-203/15 und C-698/15)126 noch nicht abgeschlossen ist. Die Europäische Kommission habe angekündigt, eine Analyse des Urteils durchzuführen und dann konkretere Hinweise zu geben, welche Kriterien nationale Gesetze der Mitgliedstaaten erfüllen müssen, um den Anforderungen des Urteils gerecht zu werden. Zudem sei auf Vorschlag der Ratspräsidentschaft eine Arbeitsgruppe zu der Thematik eingesetzt worden, welche am 10.04.2017 erstmals getagt hat.127
Letztlich gibt es gute Gründe, die VDS als spezifisches Sicherheitsinstrument auf Unionsebene neu zu regeln, anstatt diese Materie den Mitgliedstaaten zu überlassen. Insbesondere wenn die gegenwärtigen Sicherheitserfordernisse, aber auch das Bemühen der Union, Datenschutz im Interesse einheitlicher und hoher Standards zu harmonisieren, für eine Unionsregelung sprechen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass es dazu in absehbarer Zeit kommen wird.128
Beim BVerfG wurden seit 2015 mehrere Verfassungsbeschwerden gegen das „Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten“129 eingereicht. Die Karlsruher Richter hatten am 26.03.2017 wiederholt Eilanträge (1 BvR 3156/15, 1 BvR 141/16)130 gegen das Gesetz abgelehnt, da die verfassungsrechtlichen Fragen, nicht zur Klärung im Eilrechtschutzverfahren geeignet sind.131 Es ist nicht davon auszugehen, dass die Prüfung der Verfassungsbeschwerden im Jahresverlauf 2017 erfolgt, da dies nicht in der Übersicht der angestrebten Entscheidungen auf der Homepage des BVerfG angekündigt ist.132
Im Zusammenhang mit der geplanten Einführung der VDS haben auch Telekommunikationsunternehmen wie die Deutsche Telekom, welche hohe Kosten für die VDS befürchten, gegen die Bundesnetzagentur (BNetzA) geklagt. Da diese als zuständige Behörde für die Überwachung der Anforderungen nach §§ 113 a-113 g TKG133 verantwortlich ist. Ein IT- Unternehmen aus München, das u.a. Internetzugangsleistungen für Geschäftskunden in Deutschland und in anderen EU-Mitgliedstaaten erbringt, hatte sich mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung an das Verwaltungsgericht Köln gewandt, um der Verpflichtung zur VDS vorläufig bis zur Entscheidung über die gleichzeitig erhobene Klage nicht nachkommen zu müssen. Diesen Antrag hatte das Verwaltungsgericht abgelehnt. Der gegen diese Entscheidung erhobenen Beschwerde der Antragstellerin hat am 22. Juni 2017 das Oberverwaltungsgericht Münster nunmehr stattgegeben. Somit hat das OVG (Az. 13 B 238/17) die VDS kurz vor der geplanten Einführung am 1. Juli 2017 für unzulässig erklärt. Das Gericht verwies zur Begründung auf das Urteil des EuGH vom 21.12.2016 (C-203/15 und C-698/15)134. Danach ist die im Telekommunikationsgesetz §§113 a-113 g TKG135 vorgesehene Vorratsdatenspeicherung nicht mit Art. 15Abs. 1 der ePrivacy-RL136 vereinbar. Die Speicherpflicht erfasse pauschal die Verkehrs- und Standortdaten nahezu aller Nutzer von Telefon- und Internetdiensten. Erforderlich seien aber nach Maßgabe des OVG jedenfalls Regelungen, die den von der Speicherung betroffenen Personenkreis von vornherein auf Fälle beschränkten, bei denen ein zumindest mittelbarer Zusammenhang mit der durch das Gesetz bezweckten Verfolgung schwerer Straftaten bzw. der Abwehr schwerwiegender Gefahren für die öffentliche Sicherheit bestehe. Solche Beschränkungen könnten etwa durch personelle, zeitliche oder geografische Kriterien geschehen. Der Beschluss des OVG Münster gilt allerdings nur für den Kläger. Das Unternehmen bleibt somit bis zu einer Entscheidung über eine Klage am Verwaltungsgericht Köln gegen die BNetzA vorerst von der Pflicht der VDS befreit.137
Als Reaktion auf die Entscheidung des OVG (Az. 13 B 238/17) hat die Bundesnetzagentur, wenige Tage vor der geplanten Einführung der VDS, am 28.06.2017 die Pflicht zur VDS für Internet-Provider und TK-Anbieter entsprechend § 113b TKG138 ausgesetzt. Bis zum Urteil im Hauptverfahren am Verwaltungsgericht Köln wird die Speicherpflicht durch die BNetzA vorerst nicht durchgesetzt.139
4.2 Auswirkungen auf den Datenschutz
Der EuGH führt im Urteil „Digital Rights Ireland“ vom 08.04.2014 (C-293/12 und C-594/12)140 aus, dass die VDS-RL keine hinreichenden Garantien dafür biete, dass die auf Vorrat gespeicherten Daten wirksam vor Missbrauchsrisiken sowie vor jedem unberechtigten Zugang zu ihnen und jeder unberechtigten Nutzung geschützt sind.141
Das Gericht bemängelte, dass die VDS-RL142 keine speziellen Regelungen enthalte, die entsprechend der Datenmenge, dem sensiblen Charakter dieser Informationen und der Gefahr eines unberechtigten Datenzugangs angepasst sind. Ebenso gewährleiste die VDS-RL auch nicht, dass die Telekommunikationsanbieter durch technische oder organisatorische Maßnahmen für ein besonders hohes Schutz- und Sicherheitsniveau sorgen, sondern gestatte es ihnen, bei der Bestimmung des Sicherheitsniveaus wirtschaftliche Erwägungen zu berücksichtigen.143
Die Speicherung der Vorratsdaten erfolgt durch private Dienstleister. Hier besteht die Gefahr der mangelnden Datensicherheit. In der Geschichte der elektronischen Informationsverarbeitung hat es bisher noch kein hundertprozentig sicheres System gegeben. Selbst große Telekommunikationsanbieter wie die Deutsche Telekom können nicht sicherstellen, dass die riesige anfallende Menge der Vorratsdaten sicher verwahrt ist. Im Oktober 2008 wurden beispielsweise dreißig Millionen Kundendaten der Telekom im Internet veröffentlicht, nachdem diese dem Unternehmen entwendet wurden. Die Möglichkeiten, wie sensitive Informationen ein System zur Datenspeicherung auf Vorrat verlassen - oder noch schlimmer: wie manipulierte Daten den Weg in dieses System finden - sind weit gefächert. Kleinere Anbieter in Deutschland haben erst recht eingeschränkte Möglichkeiten, ihre Daten sicher zu verwahren. Sie können sich entsprechende Maßnahmen nicht oder nur sehr schwer leisten.144 Weiterhin führte der EuGH an, dass die VDS-RL keine Datenvernichtung nach Ablauf der Speicherungsfrist gewährleiste. Zum anderen moniert das Gericht, dass die Richtlinie nicht die Speicherung der Daten auf Unionsgebiet vorsehe. So sei nicht vollumfänglich gewährleistet, dass die Einhaltung der Erfordernisse des Datenschutzes und der Datensicherheit durch eine unabhängige Stelle überwacht werde.145
Im aktuellen Urteil des EuGH vom 21.12.2016 (C-203/15 und C-698/15)146 21.12.2016147 zur VDS hat das Gericht jedoch nicht ausdrücklich auf das Recht auf Sicherheit entsprechend der GRCh hingewiesen. Letztlich gilt es ein Gleichgewicht zwischen
- der Pflicht der Mitgliedstaaten in der Gewährleistung der Sicherheit,
- der sich in ihrem Hoheitsgebiet aufhaltenden Personen,
- der Wahrung der Grundrechte auf Achtung der Privatsphäre und
- dem Schutz personenbezogener Daten sicherzustellen.148 Vor diesem Hintergrund ist die Stärkung und Vereinheitlichung der europäischen Standards im Datenschutz von zentraler Bedeutung.
Die neue Datenschutz-Grundverordnung (2016/679)149 vom 27. April 2016, welche bis zum 25.05.2018 von den Mitgliedsländern anzuwenden ist, möchte das Datenschutzrecht europaweit vereinheitlichen und ersetzt die aus dem Jahre 1995 stammende EU-DSRL150. Ziel ist es, für gleiche wirtschaftliche Bedingungen in der EU zu sorgen, den Binnenmarkt zu stärken und letztlich den Datenschutz angesichts der technischen Entwicklungen zu modernisieren und damit die Grundrechte besser zu schützen.151
Das derzeit geltende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)152 beruht auf der EU-DSRL153, welche zur innerstaatlichen Wirksamkeit grundsätzlich per Umsetzungsgesetz in nationales Recht überführt wurde. Die neue europäische „Datenschutz-Grundverordnung“154 gilt im Gegensatz zu einer Richtlinie unmittelbar und bedarf keiner Umsetzung in nationales Recht.155
Jedoch enthält die europäische Datenschutz-Verordnung mehr als 70 Öffnungsklauseln, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, bestehende Datenschutzregeln beizubehalten oder neue zu erlassen, sodass zu diesen Fragen in allen Mitgliedstaaten unterschiedliche Regelungen gelten werden. Sie enthält teilweise nur sehr abstrakte Antworten, die in jedem Mitgliedstaat von Wirtschaft, Behörden und Gerichten entsprechend der bisherigen - sehr unterschiedlichen - Datenschutzkultur angewendet werden. Schließlich sind die Regelungen so technikneutral, dass die Risiken, die von der Informationstechnik ausgehen, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht in Einklang gebracht werden.156
Der Bundesrat hat am 12. Mai 2017 den Gesetzentwurf zum DSAnpUG- EU157 und dem darin in Artikel 1 enthaltenen neuem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) zugestimmt. Damit tritt das BDSG-neu am 25. Mai 2018 - gleichzeitig mit dem Gültigwerden der europäischen DatenschutzGrundverordnung (2016/679)158 - in Kraft.159
Kritiker werfen dem Gesetz vor, dass es die von der Datenschutz- Grundverordnung160 gesetzten Grenzen mit ihren Öffnungsklauseln teilweise weit überschreitet und die Rechte Betroffener einschränkt, wenn es etwa um Auskunftsrechte darüber geht, was mit den eigenen Daten geschieht.161
4.3 Auswirkungen auf die Gesellschaft
Ob die VDS ein geeignetes Mittel zur Verbrechensbekämpfung ist, ist umstritten, da motivierte Täter meist über genügend Fachwissen verfügen, sich der Datenüberwachung zu entziehen. Dazu gehört das Nutzen von anonymen bzw. gebrauchten Mobiltelefonen, Prepaid-Karten, außereuropäischen Internetanbietern oder Satellitentelefonen. Für den Durchschnittsbürger ist es meist zu umständlich, diese Techniken einzusetzen, jedoch stellen diese für einen Kriminellen kein Hindernis dar.162 In einem vom Bundesamt für Justiz in Auftrag gegebenen Gutachten „Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdatenspeicherung?“163 des Max- Planck Instituts (MPI) für ausländisches und internationales Strafrecht wurde 2011 deutlich, dass bisher die Bedeutung von auf Vorrat gespeicherten Verkehrsdaten für die Sicherheit verhältnismäßig gering ist.164 Fast alle Behauptungen über die prognostischen Fähigkeiten von Datensammlungen kommen aus der Internetwirtschaft und halten einer wissenschaftlichen Prüfung in der Regel nicht stand.165
Die Privatsphäre, der Schutz des Einzelnen, ist heute von Ausforschung so gefährdet wie nie zuvor. Es ist nicht nur der Staat, der mit Sicherheitsgesetzen und großen Datensammlungen die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger zurückdrängt. Personenbezogene Daten stellen auch einen großen wirtschaftlichen Wert dar. Unternehmen sehen im Zeitalter von „Big Data“ in ihnen eine frei verfügbare Ressource und nutzen sie so weit wie möglich. Dabei bleiben die Interessen der Betroffenen häufig auf der Strecke.166
Nach den Enthüllungen durch Edward Snowden wurde außerdem deutlich, dass die Bekämpfung des Terrorismus nur ein Vorwand für die Rechtfertigung der Datensammlung der Bevölkerung ist. Mit der Beschwörung der Bedrohung und Angst vor dem Terror wurden radikale Maßnahmen gerechtfertigt, welche auf eine gesamtgesellschaftliche und wirtschaftliche Kontrolle abzielen.167
Die Effektivität von datengestützten Überwachungsmaßnahmen bei der Kontrolle menschlichen Verhaltens beruht auf dem Wissen jedes Einzelnen, dass die eigenen Worte und Handlungen jederzeit erfasst werden können. Der Sinn und Zweck der staatlichen Überwachung ist die Kontrolle größtmöglicher Datenaustauschprozesse, um kriminelle Handlungen schneller vorzubeugen und aufklären zu können. Jedoch gilt es zu bedenken, dass eine Regierung, die ihre Bevölkerung unter eine Beobachtung dieser Art stellt, ein Klima erzeugt, welches Vertrauen zwischen den Bürgern und Behörden zerstört und in welchem sich die Menschen dazu gezwungen fühlen, mit den Behörden zu kooperieren.168
Der britische Philosoph Jeremy Bentham entwarf im Zusammenhang mit seinen Überlegungen zur Reform des Strafrechts und mit seiner Idee von einem idealen Gefängnisbau, das Prinzip des „Panoptikums“. Das Panopticon steht für den Gedanken, dass in Gesellschaften mit allgegenwärtiger Medienpräsenz ein hohes Potential für eine gegenseitige Überwachung besteht. Das Wissen jedes Einzelnen, dass das Kommunikationsverhalten jederzeit erfasst werden kann, soll kriminelle Handlungen einschränken in Form von Selbstdisziplinierung des Verhaltens.169 Im digitalen Zeitalter hat dieses Konzept der Machtausübung eine neue Form der Selbstkontrolle erschaffen; wir zensieren uns, bevor andere das tun. Die Kontrolle liegt nicht mehr nur außen, sondern ist bereits in der inneren Welt der Gesellschaft wirksam.170
Die Algorithmen, die unsere Klicks auswerten, unsere Kontakte registrieren und daraus Karten unserer sozialen Existenz erstellen, wissen mehr über uns als wir über uns selbst wissen. Dies bedeutet: Macht in Gestalt von Verfügungswissen hat sich erheblich verschoben. Derzeit erleben wir eine Erosion der Demokratie durch die Folgen der Digitalisierung. Die politische Kommunikation verändert sich u.a. durch die Trivialisierung auf das Herausstellen von Verfehlungen und Skandalen oder durch die Konjunktur des Gerüchts und der Lüge. Die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit verschwinden in der digitalen Welt. Demokratie setzt voraus, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die für ihre Angelegenheiten und das Gemeinwesen eintreten und es gestalten. Das können sie aber nur, wenn es eine Trennung von öffentlich und privat gibt.171
Darum gilt es vordringlich alle staatlichen Institutionen und privaten Wirtschaftsakteure darauf zu verpflichten, dass die Grundrechte auch in der digitalen Welt gelten. Auch die UN haben sich in ihrer Vollversammlung am 23.11.2016 einstimmig und zum dritten Mal nach 2013 und 2014 auf eine Grundsatzerklärung zum „Schutz der Privatheit im digitalen Zeitalter“ verständigt. Die Staaten der UN konstatieren die Entwicklung eines weltweiten Überwachungssystems. Sie fordern, dass niemand eigenmächtiger und ungesetzlicher Einmischung in seine Privatheit, Familie, Wohnung oder Kommunikation unterworfen werden darf. Die UN haben deshalb, eine „Magna Charta des Schutzes der Privatheit im digitalen Zeitalter“ entwickelt- ein universell geltendes Menschenrecht.172
Im Dezember 2016 hat sich in Deutschland eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern einen Entwurf zur „Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union“173 entworfen. Dieser wurde am 05.12.2016 dem Europäischen Parlament in Brüssel und der Öffentlichkeit zur weiteren Diskussion übergeben. Zu den Initiatoren der Charta gehörten u.a. der Soziologe Heinz Bude, der ehemalige Bundesverfassungsrichter Wolfgang Hoffmann-Riem, die Unternehmerin Yvonne Hofstetter und die Journalistin Rebecca Casati. Entsprechend formuliert diese Charta Grundrechte, welche die Souveränität und Freiheit des Einzelnen in der digitalen Welt schützen soll - gegen die befürchtete Totalüberwachung durch den Staat, aber auch gegen den Zugriff mächtiger Konzerne. Im Grunde reformiert diese Charta die Grundrechte im Licht des digitalen Zeitalters.174
Aber mit dieser Charta verhält es sich ebenso wie mit allen bisherigen Initiativen, die Grundrechtsverletzungen durch Datensammlungen wie der VDS und die Folgen der Digitalisierung zum Thema machen: Sie muss die Politik überhaupt erst mal erreichen.175
5 Fazit
Die vorliegende Arbeit hat aufgezeigt, in welchem politischen und rechtlichen Spannungsfeld sich die Einführung der VDS bewegt.
Die Digitalisierung ermöglicht es heute große Datenmengen unserer gesamtgesellschaftlichen Aktivitäten für die Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung zu nutzen. Dabei werden nicht nur Verkehrsdaten der TK- Anbieter gespeichert und ausgewertet.
In der vorliegenden Arbeit wurde der gesetzliche Einführungsprozess der VDS seit dem Volkszählungsgesetz aus dem Jahr 1983 aufgezeigt. Beeinflusst von terroristischen Anschlägen wurde in Brüssel die VDS-RL verabschiedet, welche zum 3. Mai 2006 in Kraft trat. Sämtliche Mitgliedsstaaten haben daraufhin, wenn auch nur zögerlich Gesetze zur Umsetzung der Richtlinie erlassen. Diese wurden teilweise von den jeweiligen Verfassungsgerichten der Mitgliedstaaten aufgehoben. In der Entscheidung des BVerfG vom 02.03.2010 erklärt das Gericht die gesetzliche Regelung zur VDS im Hinblick auf das im Grundgesetz verankerte Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) für verfassungswidrig und gab Hinweise, für eine verfassungskonforme Ausgestaltung.
Der EuGH erklärte in seinem Urteil vom 08.04.2014 die VDS-RL für ungültig und nichtig. Im aktuellen Urteil des EuGH vom 21.12.2016 machte das Gericht deutlich, dass nationale Vorratsdatenregelungen auch nach Ungültigkeitsklärung der VDS-RL dem Unionsrecht unterliegen. Insofern sei die ePrivacy-RL auf die nationalen Gesetzgebungen anwendbar. Das Gericht erläuterte weiter, dass die EU-Staaten die Überwachung auf das absolut Notwendige beschränken müssten und entschieden, dass Behörden in der Regel nur dann Zugang zu den auf Vorrat gespeicherten Daten erhalten dürfen, wenn dies zuvor von einem Gericht oder einer anderen unabhängigen Stelle erlaubt wurde.
Die Auswirkungen des Urteils auf die derzeitige gesetzliche Regelung in Deutschland, auf den Datenschutz und die Gesellschaft sind Gegenstand des vorletzten Kapitels dieser Arbeit.
Im Bereich des Datenschutzes vollzieht sich ein Paradigmenwechsel weg von gezielten Eingriffen hin zu einer Registrierung ohne Anlass. Die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung schafft keine einheitlichen hohen Standards und bleibt hinter den Erwartungen zurück. Dabei hätte das DSAnpUG-EU die Möglichkeit geboten das Datenschutzniveau in Deutschland zu wahren und gleichzeitig den Datenschutz zukunftsweisend an die Risiken der modernen Informationstechnik anzupassen.
Die Auswirkungen des EuGH Urteils zur VDS vom 21.12.2016 werden aktuell noch durch das deutsche Justizministerium geprüft, da es nicht Gegenstand des EuGH Verfahrens war. In der aktuellen Entscheidung des OVG Münster vom 22. Juni 2017 erklärte das Gericht die VDS für unzulässig und bezog sich auf das EuGH Urteil. Aufgrund dieses Urteils und der über den Einzelfall hinausgehenden Begründung des Gerichts hat die BNetzA am 28. Juni 2017 die Pflicht zur VDS für Internetprovider und Telefonanbieter bis zum Urteil im Hauptverfahren ausgesetzt. Der Gesetzgeber hat es versäumt im 1.Halbjahr die gesetzliche Ausgestaltung der VDS nachzubessern und die Rechtslage an die vom EuGH aufgestellten Anforderungen anzupassen. Daher ist es notwendig, dass das BVerfG hier schnell eine Entscheidung trifft, um eine Rechtssicherheit für die TK-Unternehmen und die Bürger zu schaffen.
Die VDS und der Ausbau der staatlichen Überwachung sind nicht - wie uns die Politik verdeutlichen will - ein Allheilmittel um die innere Sicherheit zu gewährleiten. Der Staat muss seine Sicherheitsaufgaben angemessen erfüllen. Datenschutz und Grundrechte haben einen hohen Stellenwert in Deutschland. Alle gesetzlichen Anpassungen in der VDS und TK- Überwachung sollten von einer öffentlichen Debatte begleitet und nicht überstürzt noch vor Ende der Legislaturperiode durch die Parlamente gebracht werden. Das Vertrauen in die demokratische Rechtsordnung ist vor dem Hintergrund möglicher Grundrechtseingriffe von entscheidender Bedeutung. In welchem Umfang ist die Bevölkerung bereit diese aufzugeben, um dadurch eine vermeintliche Sicherheit mittels Datenkontrolle zu erhalten? Eine künftige überarbeitete gesetzliche Regelung sollte daher neben den Sicherheitsinteressen, die Grundrechtswahrung und die Aspekte des Datenschutzes ausreichend berücksichtigen.
Literaturverzeichnis
Albrecht, Hans-Jörg/ Brunst, Phillip/ Busser, Els De/ Grundies, Volker/ Kilchling, Michael/ Rinceanu, Johanna/ Kenzel, Brigitte/ Nikolova, Nina/ Rotino, Sophie/ Tauschwitz, Moritz, Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdatenspeicherung?, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i.Br., Juli 2011, S. 1-229, unter: https://www.mpg.de/5000721/vorratsdatenspeicherung.pdf (besucht am: 29.06.2017).
Beuth, Patrick, Biermann, Kai, Dein trojanischer Freund und Helfer, in: Zeit Online, 22.06.2017, Zeitverlag, Hamburg, unter: http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-06/staatstrojaner-gesetz- bundestag-beschluss (besucht am 29.06.2017).
Baum, Gerhart, Vereinte digitale Nation, Die Völkergemeinschaft ist aufgewacht: Der Schutz der Privatheit ist neuer Schwerpunkt des Menschenrechtsschutzes in: Die Zeit, No. 22, 24 Mai 2017, Zeitverlag, Hamburg S. 11.
Brönnimann, Gabriel, Die umkämpfte Einführung der Vorratsdatenspeicherung in der EU, in: Gaycken, Sandro (Hrsg.), Jenseits von 1984: Datenschutz und Überwachung in der fortgeschrittenen Informationsgesellschaft. Eine Versachlichung, transcript, Bielefeld, 2013, S. 47-48.
Beukelmann, Stephan, Vorratsdatenspeicherung so nicht verfassungsgemäß, NJW Spezial, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2010, S. 184.
Dehmel, Susanne, Einmal Europa, Deutschland und zurück!, ZD, C.H. Beck, München, 2017, S. 249, unter: https://rsw.beck.de/cms/?toc=ZD.20 (besucht am: 29.06.2017).
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Dokumentation der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder aus Anlass des 25. Jahrestages der Verkündung des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts am 15.12.2008, Karlsruhe, 1. Auflage, Mai 2009, unter: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/Ta gungsbaende/Dokumentation25JahreVolkszaehlungsurteil.html?cms_s ubmit=Senden&cms_templateQueryString=Recht+auf+informationelle+ Selbstbestimmung (besucht am: 29.06.2017).
Bundesministerium des Innern, Kabinett beschließt Fluggastdatengesetz, Bundesministerium des Innern - Referat Presse; Öffentlichkeitsarbeit; Internet, Berlin, unter: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/02/ka binettbeschluss-pnr.html 3314802 (besucht am: 29.06.2017).
Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V., Verabschiedung des künftigen Datenschutzgesetz verstärkt Planungssicherheit, unter: https://www.pressebox.de/pressemitteilung/berufsverband-der- datenschutzbeauftragten-deutschlands-bvd-ev/Verabschiedung-des- kuenftigen-Datenschutzgesetz-verstaerkt- Planungssicherheit/boxid/849797 (besucht am: 29.06.2017).
Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe 29.06.2017, unter: http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Jahresvoraussc hau/jahresvorausschau_node.html (besucht am 29.06.2017).
Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg, Stand: 01.12.2016, unter: http://www.buceriuslab.de/2014/wp-content/uploads/2014/04/charta- email-versand.pdf (besucht am: 29.06.2017).
Engling, Dirk, Vorratsdatenspeicherung, in: Gaycken/ Sandro, Kurz/ Constanze (Hrsg.); 1984.exe, transcript, Bielefeld, 2008, S. 67-78.
Foucault, Michel, Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses, Übers. von Walter Seitter, Suhrkamp, 1. Aufl. Frankfurt am Main, 1977.
Frieling, Jens, Zielgruppe Digital Natives: wie das Internet die Lebensweise von Jugendlichen verändert: neue Herausforderungen an die Medienbranche, Diplomica, Hamburg, 2010.
Gaycken, Sandro (Hrsg.), Jenseits von 1984, Datenschutz und Überwachung in der fortgeschrittenen Informationsgesellschaft. Eine Versachlichung, transcript, Bielefeld, 2013.
Greis, Friedhelm, Vorratsdatenspeicherung wird jetzt schon ausgeweitet, in: Zeit Online, 10.05.2017, Zeitverlag, Hamburg, unter: http://www.zeit.de/digital/internet/2017-05/gesetzentwurf- vorratsdatenspeicherung-ausweitung-einbruch (besucht am: 29.06.2017).
Greven, Ludwig, AFP Agence-France Presse, Vorratsdatenspeicherung ist nicht mit EU-Recht vereinbar, in: Zeit Online, 22.06.2017, Zeitverlag, Hamburg, unter: http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017- 06/vorratsdatenspeicherung-oberverwaltungsgericht-muenster-eu-recht- urteil?page=3#comments (besucht am: 29.06.2017).
Greenwald, Glenn, Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen, Knaur, München, 2014, S. 251-304.
Heesen, Jessica, Keine Freiheit ohne Privatsphäre. Wandel und Wahrung des Privaten in informationstechnisch bestimmten Lebenswelten in: Gaycken/ Sandro, Kurz/ Constanze (Hrsg.); 1984.exe, transcript, Bielefeld, 2008, S. 231-248.
Hornung, Gerrit, Datenschutz im Gefüge der Grundrechte und ihrem gesellschaftlichen Wandel, in Gaycken/ Sandro, Kurz/ Constanze (Hrsg.); 1984.exe, transcript, Bielefeld, 2008, S. 249-264.
Janisch, Wolfgang, EuGH beendet die maßlose Vorratsdatenspeicherung: Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München, 21.12.2016, unter: http://www.sueddeutsche.de/digital/urteil-des-europaeischen- gerichtshofs-eugh-beendet-die-masslose-vorratsdatenspeicherung- 1.3304474 (besucht am: 29.06.2017).
Jahn, Roland, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, gibt Jugendreportern Interview, Berlin, 04.05.2013 unter: http://www.bstu.bund.de/DE/BundesbeauftragterUndBehoerde/Bundesb eauftragter/Interviews/2013_05_6_mopo.html (besucht am: 29.06.2017).
Koshan, Mansoor, Vorratsdatenspeicherung: verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen und rechtspolitische Verortung, Zeitschrift für Datenschutz und Datensicherheit, 3/2016, Beck, München, 2016.
Moser-Knierim, Antonie, Vorratsdatenspeicherung: zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr, Springer, Wiesbaden 2014.
Precht, Manfred/ Meier, Nikolaus/ Tremel, Dieter, EDV-Grundwissen, Eine Einführung in Theorie und Praxis der modernen EDV, Addison-Wesley, München, 2004.
Priebe, Reinhard, Vorratsdatenspeicherung und kein Ende - Strenge Anforderungen des EuGH an nationale Regelungen, EuZW, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 136-139.
Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet) an der Universität Kassel und des Instituts für Europäisches Medienrecht e. V. (EMR), Interessensausgleich im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung (iNVODAS), Saarbrücken, Brüssel, 15.02.2012, unter: https://www.emr- sb.de/gutachten-leser/items/analyse-zum-thema- invodas.html?file=tl_files/EMR- SB/content/PDF/Gutachten%20Abgeschlossene/EMR- Gutachten_INVODAS_Schlussbericht_EMR-Teile.pdf (besucht am: 29.06.2017).
Reinbold, Fabian, DPA, Die Vorratsdatenspeicherung kommt erst einmal nicht, in: SPIEGEL Online, 28.06.2017, Spiegelnet Hamburg unter: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/vorratsdatenspeicherung-von- bundesnetzagentur-ausgesetzt-a-1154860.html (besucht am 29.06.2017).
Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus?, NJW, 10/2017, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 696-698.
Roßnagel, Alexander, Die neue Vorratsdatenspeicherung, NJW, No. 8/2016, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2016, S. 533-539.
Sierck, G. M./Schöning, F./ Pöhl, M., Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung nach europäischem und deutschem Recht, WD 3 - 282/06, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 03.08.2006, S. 4 unter: http://www.bundestag.de/blob/413200/f5536b8536ef1 e1 d78716cf91248 fac5Md-3-282-06-pdf-data.pdf (besucht am: 29.06.2017).
Spies, Axel, Umsetzung der EU-Datenschutz-GVO: DSAnpUG-EU vom Bundestag beschlossen, aber Kritik regt sich weiter, C.H.Beck, München, 2017, unter https://community.beck.de/2017/04/28/umsetzung-der-eu-datenschutz- gvo-dsanpug-eu-vom-bundestag-beschlossen-aber-kritik-regt-sich- weiter (besucht am: 29.06.2017).
Szent-Ivanyi, Timot/ Vates, Daniela, Strafverfolgung: CDU will Mautdaten für die Polizei freigeben, Berliner Zeitung, Berliner Verlag, Berlin, 27.03.2017 unter: http://www.berliner-zeitung.de/26267040 (besucht am: 29.06.2017).
Stanley, Jay/ Steinhardt, Barry, Even Bigger, Even Weaker: The Emerging Surveillance Society, Where Are We Now? The American Civil Liberties Union, 16.09.2007 unter: www.aclu.org/pdfs/privacy/bigger_weaker.pdf (besucht am: 03.05.2017) in: Gottschalk-Mazouz, Niels, Die Spezifik technisierter Überwachung. Überlegungen zu Überwachung und Macht aus technikphilosophischer Sicht in: Gaycken/ Sandro, Kurz/ Constanze (Hrsg.); 1984.exe, transcript, Bielefeld, 2008, S. 219.
Taz Redaktion, Mautplan der Bundesregierung: Im Vorbeifahren überwacht, Taz Verlag Berlin, 30.10.2014, unter: http://www.taz.de/!5029671 (besucht am: 29.06.2017).
Löffelmann, Markus, BVerfG v. 02.03.2010 - 1 BvR 256/08; 1 BvR 263/08; 1 BvR 586/08. Gesetzliche Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung ist verfassungswidrig, in: Entscheidungen - Straf- und Strafprozessrecht, JR Heft 5/2010, Walter de Gruyter, 2010, Berlin, S. 225-228.
Tilman, Steffen/ Beuth, Patrick, Gerichtshof kippt Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, in: Zeit Online, 08.04.2014, Zeitverlag, Hamburg, unter: http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2014- 04/vorratsdatenspeicherung-europaeischer-gerichtshof-eugh (besucht am: 29.06.2017).
Welzer, Harald, Schluss mit der Euphorie! Wir kommunizieren inzwischen vor allem digital. Das wächst sich zu einer Bedrohung für die Demokratie aus - und die Politik hält still, Die Zeit, No. 18, 27. April 2017, Zeitverlag, Hamburg, S. 6.
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Zulässigkeit einer Vorratsdatenspeicherung in Deutschland nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs, WD 3 - 3000 - 088/15, 27.03.2015, S. 8-9 unter: https://www.bundestag.de/blob/405504/f41cc6549db983d08de3ed61d8 cb670e/wd-3-088-15-pdf-data.pdf (besucht am: 29.06.2017).
Wieduwilt, Hendrik, Wird jetzt die deutsche Vorratsdatenspeicherung gekippt?, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt, 21.12.2016, unter: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eugh-will- vorratsdatenspeicherung-und-ueberwachung-verringern-14586452.html (besucht am: 29.06.2017).
Ziebarth, Wolfgang, Die Vorratsdatenspeicherung im Wandel der EuGHRechtsprechung, ZUM, Heft 5/2017, Baden-Baden, 2017, S. 398-405.
[...]
1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Hausarbeit nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche Form gleichberechtigt ein.
2 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris
3 Vgl. Wieduwilt, Hendrik, Wird jetzt die deutsche Vorratsdatenspeicherung gekippt?, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt, 21.12.2016, unter: http://www.faz.net. (Im Interesse einer besseren Lesbarkeit werden die URLs in der Hausarbeit in den Fußnoten in Kurzform und im Quellenverzeichnis ausführlich angegeben.)
4 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, Vorratsdatenspeicherung: zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr, Springer, Wiesbaden 2014, S. 148 ff.
5 Jahn, Roland, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, gibt Jugendreportern Interview, Berlin, 04.05.2013 unter: http://www.bstu.bund.de.
6 Vgl. Frieling, Jens, Zielgruppe Digital Natives: wie das Internet die Lebensweise von Jugendlichen verändert: neue Herausforderungen an die Medienbranche, Diplomica, Hamburg, 2010, S. 13.
7 Vgl. Precht, Manfred/ Meier, Nikolaus/ Tremel, Dieter, EDV-Grundwissen, Eine Einführung in Theorie und Praxis der modernen EDV, Addison-Wesley, München, 2004, S. 25-27.
8 Engling, Dirk, Vorratsdatenspeicherung, in: Gaycken/ Sandro, Kurz/ Constanze (Hrsg.), 1984.exe, transcript, Bielefeld, 2008, S. 67.
9 Sierck, G. M./Schöning, F./ Pöhl, M., Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung nach europäischem und deutschem Recht, WD 3 - 282/06, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 03.08.2006, S. 4 unter: http://www.bundestag.de.
10 Vgl. Sierck, G. M./Schöning, F./ Pöhl, M., 2006, S. 4 ff.
11 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, Vorratsdatenspeicherung: zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr, Springer, Wiesbaden 2014, S. 168 in: Beukelmann, Stephan, Vorratsdatenspeicherung so nicht verfassungsgemäß, NJW Spezial, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2010, S. 206-208.
12 Vgl. Brönnimann, Gabriel, Die umkämpfte Einführung der Vorratsdatenspeicherung in der EU, in: Gaycken, Sandro (Hrsg.), Jenseits von 1984: Datenschutz und Überwachung in der fortgeschrittenen Informationsgesellschaft. Eine Versachlichung, transcript, Bielefeld, 2013, S. 47-48.
13 Vgl. Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das durch Artikel 6 Absatz 41 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist.
14 Vgl. Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2218).
15 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, Vorratsdatenspeicherung: zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr, Springer, Wiesbaden 2014, S. 168, in: Beukelmann, Stephan, Vorratsdatenspeicherung so nicht verfassungsgemäß, NJW Spezial, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2010, S. 206-208.
16 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, 2014, S. 168 ff.
17 Vgl. Moser-Knierim, Antonie (2014), S. 168 ff.
18 Vgl. Moser-Knierim, Antonie (2014), S. 188 ff.
19 Vgl. Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.Oktober 1995, zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, Amtsblatt der Europäischen Union, Nr. L 281/31,23.11.1995.
20 Vgl. Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet) an der Universität Kassel und des Instituts für Europäisches Medienrecht e. V. (EMR), Interessensausgleich im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung (INVODAS), Saarbrücken, Brüssel, 15.02.2012, unter: https://www.emr-sb.de.
21 Vgl. Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist, § 100 g.
22 Vgl. Greis, Friedhelm, Vorratsdatenspeicherung wird jetzt schon ausgeweitet, in: Zeit Online, 10.05.2017, Zeitverlag, Hamburg, unter: http://www.zeit.de.
23 Vgl. Beuth, Patrick, Biermann, Kai, Dein trojanischer Freund und Helfer, in: Zeit Online, 22.06.2017, Zeitverlag, Hamburg, unter: http://www.zeit.de.
24 Vgl. Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität, Amtsblatt der Europäischen Union, L119/132, 04.05.2016.
25 Vgl. Bundesministerium des Innern, Kabinett beschließt Fluggastdatengesetz, Bundesministerium des Innern - Referat Presse; Öffentlichkeitsarbeit; Internet, Berlin, unter: http://www.bmi.bund.de.
26 Vgl. Szent-Ivanyi, Timot/ Vates, Daniela, Strafverfolgung: CDU will Mautdaten für die Polizei freigeben, Berliner Zeitung, Berliner Verlag, Berlin, 27.03.2017 unter: http://www.berliner-zeitung.de.
27 Vgl. Taz Redaktion, Mautplan der Bundesregierung: Im Vorbeifahren überwacht, Taz Verlag Berlin, 30.10.2014, unter: http://www.taz.de.
28 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, Vorratsdatenspeicherung: zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr, Springer, Wiesbaden 2014, S. 168, in: Beukelmann, Stephan, Vorratsdatenspeicherung so nicht verfassungsgemäß, NJW Spezial, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2010, S. 267 ff.
29 Vgl. Hornung, Gerrit, Datenschutz im Gefüge der Grundrechte und ihrem gesellschaftlichen Wandel, in Gaycken/ Sandro, Kurz/ Constanze (Hrsg.); 1984.exe, transcript, Bielefeld, 2008, S. 250.
30 Vgl. Stanley, Jay/ Steinhardt, Barry, Even Bigger, Even Weaker: The Emerging Surveillance Society, Where Are We Now? The American Civil Liberties Union, 16.09.2007 unter: www.aclu.org/pdfs/privacy/bigger_weaker.pdf (besucht am: 03.05.2017) in: Gottschalk-Mazouz, Niels, Die Spezifik technisierter Überwachung. Überlegungen zu Überwachung und Macht aus technikphilosophischer Sicht in: Gaycken/ Sandro, Kurz/ Constanze (Hrsg.); 1984.exe, transcript, Bielefeld, 2008, S. 219.
31 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, Vorratsdatenspeicherung: zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr, Springer, Wiesbaden 2014, S. 139 ff.
32 Vgl. BVerfG, Urteil vom 15.12.1983 - 1 BvR 209/83, 1 BvR 484/83, 1 BvR 440/83, 1 BvR 420/83, 1 BvR 362/83, 1 BvR 269/83 (Volkszählungsurteill) -, openJur 2012, 616.
33 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, 2014, S. 81-82.
34 Vgl. Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2010/C 83/389), Amtsblatt der Europäischen Union, C 83/389, 30.03.2010.
35 Vgl. Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, Amtsblatt der Europäischen Union, Nr. L 281/31,23.11.1995.
36 Vgl. Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, L 201/37, 31.07.2002.
37 Vgl. Brönnimann, Gabriel, Die umkämpfte Einführung der Vorratsdatenspeicherung in der EU, in: Gaycken, Sandro (Hrsg.), Jenseits von 1984: Datenschutz und Überwachung in der fortgeschrittenen Informationsgesellschaft. Eine Versachlichung, transcript, Bielefeld, 2013, S. 49.
38 Vgl. Orantek, Kerstin: Die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, Zeitschrift Neue Justiz, Nomos, Freiberg. 2010, S. 193 ff. in: Moser-Knierim, Antonie, Vorratsdatenspeicherung: zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr, Springer, Wiesbaden 2014, S. 150 ff.
39 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, 2014, S. 150 ff.
40 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, 2014, S. 150 ff.
41 Vgl. Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG, Amtsblatt der Europäischen Union, L 105/54, 13.04.2006.
42 Vgl. Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006.
43 Vgl. Brönnimann, Gabriel, Die umkämpfte Einführung der Vorratsdatenspeicherung in der EU, in: Gaycken, Sandro (Hrsg.), Jenseits von 1984: Datenschutz und Überwachung in der fortgeschrittenen Informationsgesellschaft. Eine Versachlichung, transcript, Bielefeld, 2013, S. 50 ff.
44 Vgl. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Konsolidierte Fassung), Amtsblatt der Europäischen Union C 326/47, 26.10.2012.
45 Vgl. Sierck, G. M./Schöning, F./ Pöhl, M., Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung nach europäischem und deutschem Recht, WD 3 - 282/06, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 03.08.2006, S. 4 unter: http://www.bundestag.de.
46 Vgl. Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG vom 21.Dezember 2007, Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2007, Teil I Nr. 70, Bundesanzeiger Verlag, Bonn 31.12.2007, S.3198 ff.
47 Vgl. Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus?, NJW, 10/2017, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 696.
48 Vgl. BVerfG, Urteil vom 02. März 2010 -1 BvR 256/08 -, juris.
49 Vgl. Koshan, Mansoor, Vorratsdatenspeicherung: verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen u. rechtspolitische Verortung, Zeitschrift für Datenschutz und Datensicherheit, 3/2016, Beck, München, 2016, S. 167-171.
50 Vgl. EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12 -, juris.
51 Vgl. Roßnagel, Alexander, Die neue Vorratsdatenspeicherung, NJW, No. 8/2016, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2016, S. 533-539.
52 Vgl. Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus?, NJW, 10/2017, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 696 ff.
53 Vgl. Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2218).
54 Vgl. Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2218), § 113b.
55 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris.
56 Vgl. Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus?, NJW, 10/2017, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 696-698.
57 Vgl. Priebe, Reinhard, Vorratsdatenspeicherung und kein Ende - Strenge Anforderungen des EuGH an nationale Regelungen, EuZW, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 136-139.
58 Vgl. Janisch, Wolfgang, EuGH beendet die maßlose Vorratsdatenspeicherung: Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München, 21.12.2016, unter: http://www.sueddeutsche.de.
59 Vgl. Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG v. 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3198).
60 Vgl. Richtlinie 2006/24/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006.
61 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 28.10.2008, Az.: 1 BvR 256/08 -, juris.
62 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, Vorratsdatenspeicherung: zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr, Springer, Wiesbaden 2014, S. 168 in: Beukelmann, Stephan, Vorratsdatenspeicherung so nicht verfassungsgemäß, NJW Spezial, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2010.S. 155-158.
63 Vgl. BVerfG, Urteil vom 02. März 2010 -1 BvR 256/08 -, juris.
64 Vgl. Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006.
65 Vgl. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl.I S. 2438) geändert worden ist, Art. 10.
66 Vgl. Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG v. 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3198).
67 Vgl. Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist, § 100 g.
68 Vgl. Löffelmann, Markus, BVerfG vom 02.03.2010 - 1 BvR 256/08; 1 BvR 263/08; 1 BvR 586/08. Gesetzliche Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung ist verfassungswidrig, in: Entscheidungen - Straf- und Strafprozessrecht, JR Heft 5/2010, Walter de Gruyter, 2010, Berlin, S. 225-228.
69 Löffelmann, Markus, JR 5/2010, S. 228.
70 Vgl. Moser-Knierim, Antonie: Vorratsdatenspeicherung: zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr, Springer, Wiesbaden 2014, S. 168 in: Beukelmann, Stephan: Vorratsdatenspeicherung so nicht verfassungsgemäß, NJW Spezial, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2010, S. 155-158.
71 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, 2014, S. 155-158.
72 Vgl. Vgl. Löffelmann, Markus, JR 5/2010, S. 225-228.
73 Vgl. Vgl. Löffelmann, Markus, JR 5/2010, S. 225-228.
74 Vgl. BVerfG, Urteil vom 02. März 2010 -1 BvR 256/08 -, juris, Rn. 218.
75 Vgl. EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12 -, juris.
76 Vgl. Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006.
77 Vgl. Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus?, NJW, 10/2017, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 696-698.
78 Vgl. Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006.
79 Vgl. Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2010/C 83/389), Amtsblatt der Europäischen Union, C 83/389, 30.03.2010.
80 Vgl. Tilman, Steffen/ Beuth, Patrick, Gerichtshof kippt Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, in: Zeit Online, 08.04.2014, Zeitverlag, Hamburg, unter: http://www.zeit.de.
81 Vgl. EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12-, juris.
82 Vgl. Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2010/C 83/389), Amtsblatt der Europäischen Union, C 83/389, 30.03.2010.
83 EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12 -, juris, Rn. 56.
84 EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12 -, juris, Rn. 56-60.
85 Vgl. Roßnagel, Alexander, Die neue Vorratsdatenspeicherung, NJW, No. 8/2016, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2016, S. 696-698.
86 Vgl. Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006.
87 Vgl. Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2218).
88 Vgl. Tilman, Steffen/ Beuth, Patrick, Gerichtshof kippt Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, in: Zeit Online, 08.04.2014, Zeitverlag, Hamburg, unter: http://www.zeit.de.
89 Vgl. EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12 -, juris.
90 Vgl. Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002.
91 Vgl. EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12 -, juris, Rn. 46, 57.
92 Vgl. Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus?, NJW, 10/2017, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 696-698.
93 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris.
94 Vgl. EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12 -, juris.
95 Vgl. Priebe, Reinhard, Vorratsdatenspeicherung und kein Ende - Strenge Anforderungen des EuGH an nationale Regelungen, EuZW, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 136-139.
96 Vgl. Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom. 24. Oktober 1995.
97 Vgl. Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2010/C 83/389), Amtsblatt der Europäischen Union, C 83/389, 30.03.2010.
98 Vgl. Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus?, NJW, 10/2017, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 696-698.
99 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris.
100 Vgl. Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002.
101 Vgl. Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus?, NJW, 10/2017, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 696-698.
102 Vgl. Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.Oktober 1995.
103 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris, Rn. 73.
104 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris, Rn. 76, 78.
105 Vgl. Priebe, Reinhard, Vorratsdatenspeicherung und kein Ende - Strenge Anforderungen des EuGH an nationale Regelungen, EuZW, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 136-139.
106 Vgl. Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2010/C 83/389), Amtsblatt der Europäischen Union, C 83/389, 30.03.2010.
107 EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris, Rn. 96 ff.
108 Vgl. Priebe, Reinhard, Vorratsdatenspeicherung und kein Ende - Strenge Anforderungen des EuGH an nationale Regelungen, EuZW, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 136-139.
109 Vgl. Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus?, NJW, 10/2017, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 696-698.
110 Vgl. EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12 -, juris.
111 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris.
112 Vgl. Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2010/C 83/389), Amtsblatt der Europäischen Union, C 83/389, 30.03.2010.
113 Vgl. Ziebarth, Wolfgang, Die Vorratsdatenspeicherung im Wandel der EuGH-Rechtsprechung, ZUM, 2017, Baden-Baden, S. 398-405.
114 Vgl. Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2218).
115 Vgl. Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das durch Artikel 6 Absatz 41 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist.
116 Vgl. EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12 -, juris.
117 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris.
118 Vgl. Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus?, NJW, 10/2017, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 696-698.
119 Vgl. Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das durch Artikel 6 Absatz 41 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist.
120 Vgl. Priebe, Reinhard, Vorratsdatenspeicherung und kein Ende - Strenge Anforderungen des EuGH an nationale Regelungen, EuZW, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 136-139.
121 Vgl. Ziebarth, Wolfgang, Die Vorratsdatenspeicherung im Wandel der EuGH-Rechtsprechung, ZUM, 2017, Baden-Baden, S. 398-405.
122 Vgl. Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das durch Artikel 6 Absatz 41 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist.
123 Vgl. Strafprozeßordnung (StPO) vom 07.April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), zuletzt geändert am 03.April 2017 (BGBl. I S. 872): Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz unter: https://www.gesetze-im- internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf (Stand: 26.04.2017).
124 Vgl. Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das durch Artikel 6 Absatz 41 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist.
125 Vgl. Roßnagel, Alexander, Vorratsdatenspeicherung rechtlich vor dem Aus?, NJW, 10/2017, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 696-698.
126 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris.
127 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jan Korte, Dr. André Hahn, Ulla Jelpke sowie weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 18/11862, Deutscher Bundestag, 04.05.2017.
128 Vgl. Priebe, Reinhard, Vorratsdatenspeicherung und kein Ende - Strenge Anforderungen des EuGH an nationale Regelungen, EuZW, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 136-139.
129 Vgl. Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2218).
130 Vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 26. März 2017 -1 BvR 3156/15 - Rn. (1 -3) und 1 BvR 3156/15 - Rn. (1-3), unter: http://www.bverfg.de.
131 Vgl. Greis, Friedhelm, Vorratsdatenspeicherung wird jetzt schon ausgeweitet, in: Zeit Online, 10.05.2017, Zeitverlag, Hamburg, unter: http://www.zeit.de.
132 Vgl. Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe 29.06.2017 unter: http://www.bundesverfassungsgericht.de.
133 Vgl. Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das durch Artikel 6 Absatz 41 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist.
134 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris.
135 Vgl. Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das durch Artikel 6 Absatz 41 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist.
136 Vgl. Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002.
137 Vgl. Greven, Ludwig, AFP Agence-France Presse, Vorratsdatenspeicherung ist nicht mit EU-Recht vereinbar, in: Zeit Online, 22.06.2017, Zeitverlag, Hamburg, unter: http://www.zeit.de.
138 Vgl. Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das durch Artikel 6 Absatz 41 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist.
139 Vgl. Reinbold, Fabian, DPA, Die Vorratsdatenspeicherung kommt erst einmal nicht, in: SPIEGEL Online, 28.06.2017, Spiegelnet Hamburg unter: http://www.spiegel.de.
140 Vgl. EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12 -, juris.
141 Vgl. EuGH, Urteil vom 08. April 2014 -C-293/12 und C-594/12-, juris, Rn. 66 ff.
142 Vgl. Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006.
143 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Zulässigkeit einer Vorratsdatenspeicherung in Deutschland nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs, WD 33000 - 088/15, 27.03.2015, S. 8-9, unter: https://www.bundestag.de.
144 Vgl. Engling, Dirk, Vorratsdatenspeicherung, in: Gaycken/ Sandro, Kurz/ Constanze (Hrsg.); 1984.exe, transcript, Bielefeld, 2008, S. 72-73.
145 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Zulässigkeit einer Vorratsdatenspeicherung in Deutschland nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs, WD 33000 - 088/15, 27.03.2015, S. 8-9, unter: https://www.bundestag.de.
146 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris.
147 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2016, C-203/15 und C-698/15 -, juris.
148 Vgl. Priebe, Reinhard, Vorratsdatenspeicherung und kein Ende - Strenge Anforderungen des EuGH an nationale Regelungen, EuZW, C. H. Beck, Frankfurt am Main, 2017, S. 136-139.
149 Vgl. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung): Amtsblatt der Europäischen Union, 04.05.2016, L119, 59. Jahrgang.
150 Vgl. Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.Oktober 1995.
151 Vgl. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).
152 Vgl. Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66), das durch Artikel 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 410) geändert worden ist.
153 Vgl. Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.Oktober 1995.
154 Vgl. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).
155 Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680, Drucksache des Deutschen Bundestages 18/11325, 24.02.2017.
156 Vgl. Roßnagel, Alexander: Europäische Datenschutz-Grundverordnung - Vorrang des Unionsrechts - Anwendbarkeit des nationalen Rechts, Nomos, Baden-Baden 2016, S. 342 ff.
157 Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680, Drucksache des Deutschen Bundestages 18/11325, 24.02.2017.
158 Vgl. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung): Amtsblatt der Europäischen Union, 04.05.2016, L119, 59. Jahrgang.
159 Vgl. Dehmel, Susanne, Einmal Europa, Deutschland und zurück!, ZD, C.H. Beck, München, 2017, S. 249, unter: http://www.beck.de.
160 Vgl. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung): Amtsblatt der Europäischen Union, 04.05.2016, L119, 59. Jahrgang.
161 Vgl. Spies, Axel, Umsetzung der EU-Datenschutz-GVO: DSAnpUG-EU vom Bundestag beschlossen, aber Kritik regt sich weiter, C.H.Beck, München, 2017, unter: https://community.beck.de.
162 Vgl. Engling, Dirk, Vorratsdatenspeicherung, in: Gaycken/ Sandro, Kurz/ Constanze (Hrsg.); 1984.exe, transcript, Bielefeld, 2008, S. 67-78.
163 Vgl. Albrecht, Hans-Jörg/ Brunst, Phillip/ Busser, Els De/ Grundies, Volker/ Kilchling, Michael/ Rinceanu, Johanna/ Kenzel, Brigitte/ Nikolova, Nina/ Rotino, Sophie/ Tauschwitz, Moritz, Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdatenspeicherung?, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i.Br., Juli 2011, S. 1-229, unter: https://www.mpg.de.
164 Vgl. Moser-Knierim, Antonie, Vorratsdatenspeicherung: zwischen Überwachungsstaat und Terrorabwehr, Springer, Wiesbaden 2014.
165 Vgl. Welzer, Harald, Schluss mit der Euphorie! Wir kommunizieren inzwischen vor allem digital. Das wächst sich zu einer Bedrohung für die Demokratie aus - und die Politik hält still, Die Zeit, No. 18, 27. April 2017, Zeitverlag, Hamburg, S. 6.
166 Vgl. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Dokumentation der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder aus Anlass des 25. Jahrestages der Verkündung des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts am 15.12.2008, Karlsruhe, 1. Auflage, Mai 2009, unter: https://www.bfdi.bund.de.
167 Vgl. Greenwald, Glenn, Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen, Knaur, München, 2014, S. 251-304.
168 Vgl. Greenwald, Glenn, Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen, Knaur, München, 2014, S. 251-304.
169 Vgl. Heesen, Jessica, Keine Freiheit ohne Privatsphäre. Wandel und Wahrung des Privaten in informationstechnisch bestimmten Lebenswelten in: Gaycken/ Sandro, Kurz/ Constanze (Hrsg.); 1984.exe, transcript, Bielefeld, 2008.S. 236.
170 Vgl. Foucault, Michel, Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses, Übers. von Walter Seitter, Suhrkamp, 1. Aufl. Frankfurt am Main, 1977, S. 220-222.
171 Vgl. Welzer, Harald, Schluss mit der Euphorie! Wir kommunizieren inzwischen vor allem digital. Das wächst sich zu einer Bedrohung für die Demokratie aus - und die Politik hält still, Die Zeit, No. 18, 27. April 2017, Zeitverlag, Hamburg, S. 6.
172 Vgl. Baum, Gerhart, Vereinte digitale Nation, in: Die Zeit, No. 22, 24 Mai 2017, Zeitverlag, Hamburg S. 11.
173 Vgl. Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union: ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg, Stand: 01.12.2016, unter: http://www.buceriuslab.de.
174 Vgl. Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union: ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg, Stand: 01.12.2016, unter: https://digitalcharta.eu.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele, Schlüsselthemen, Kapitelsusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt das Thema Vorratsdatenspeicherung.
Was sind die Hauptkapitel des Dokuments?
Die Hauptkapitel umfassen Einleitung, Begriffsbestimmung und Anwendungsmöglichkeiten der Vorratsdatenspeicherung, rechtliche Betrachtung der Vorratsdatenspeicherung, Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung und Fazit.
Wie wird Vorratsdatenspeicherung definiert?
Vorratsdatenspeicherung wird allgemein als "das anlassunabhängige und nicht zweckbezogene Sammeln von personenbezogenen Daten zur späteren Verwendung" verstanden. Eine aktuelle Definition bezieht sich auf "anlassunabhängige Speicherung von Telekommunikationsdaten für Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrzwecke".
Welche Anwendungsmöglichkeiten hat die Vorratsdatenspeicherung?
Die Vorratsdatenspeicherung soll die Verfolgung von Internetkriminalität ermöglichen und wird zur Ermittlung von Kontaktdaten, Funkzellenabfragen und Erstellung von Kommunikations- und Organisationsprofilen genutzt.
Was sagt das Bundesverfassungsgericht zur Vorratsdatenspeicherung?
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Urteil vom 02.03.2010 die damaligen Regelungen zur Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Es sah jedoch die anlasslose Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten nicht grundsätzlich als verfassungswidrig an, monierte aber die Ausgestaltung der Gesetze.
Was sagt der Europäische Gerichtshof (EuGH) zur Vorratsdatenspeicherung?
Der EuGH hat am 08.04.2014 die Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung für nichtig erklärt, da sie gegen Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und Schutz personenbezogener Daten verstößt. Mit Urteil vom 21.12.2016 hat der EuGH präzisiert, dass nationale Vorratsdatenregelungen auch nach Ungültigkeitserklärung der EU-Richtlinie dem Unionsrecht unterfallen.
Welche Auswirkungen hat das EuGH-Urteil auf die deutsche Gesetzgebung zur Vorratsdatenspeicherung?
Das EuGH-Urteil hat Auswirkungen auf die aktuelle gesetzliche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Das Urteil besagt, dass eine dauerhafte, anlasslose, flächendeckende und verhaltensunabhängige VDS gegen Art. 7 und 8 der GRCh verstößt.
Welche Auswirkungen hat die Vorratsdatenspeicherung auf den Datenschutz?
Die Vorratsdatenspeicherung birgt Risiken für den Datenschutz, da die gespeicherten Daten vor Missbrauch und unberechtigtem Zugriff geschützt werden müssen. Das EuGH-Urteil vom 08.04.2014 führt aus, dass die VDS-RL keine hinreichenden Garantien dafür biete, dass die auf Vorrat gespeicherten Daten wirksam vor Missbrauchsrisiken sowie vor jedem unberechtigten Zugang zu ihnen und jeder unberechtigten Nutzung geschützt sind.
Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat die Vorratsdatenspeicherung?
Es ist umstritten, ob die VDS ein geeignetes Mittel zur Verbrechensbekämpfung ist, da motivierte Täter meist über genügend Fachwissen verfügen, sich der Datenüberwachung zu entziehen. Der Effekt von allgegenwärtiger Überwachung auf das Verhalten der Gesellschaft wird ebenfalls diskutiert.
Was ist die Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union?
Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern hat einen Entwurf zur "Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union" entworfen, um die Souveränität und Freiheit des Einzelnen in der digitalen Welt zu schützen - gegen die befürchtete Totalüberwachung durch den Staat, aber auch gegen den Zugriff mächtiger Konzerne.
- Quote paper
- Rene Beyer (Author), 2017, Die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland und ihre Auswirkungen. Eine rechtliche Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/944592