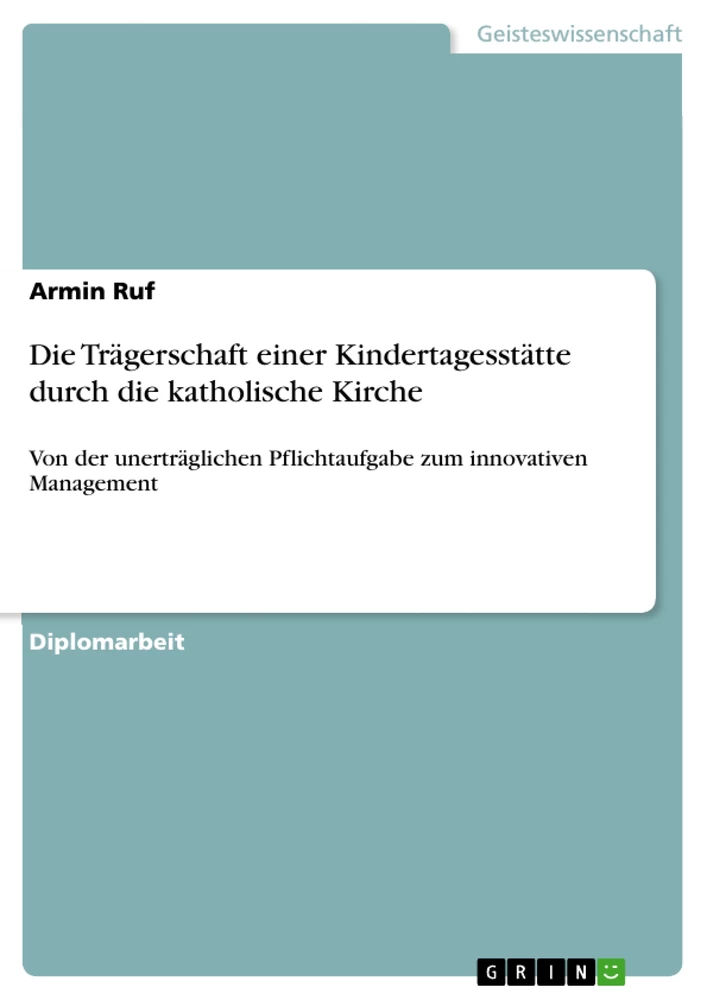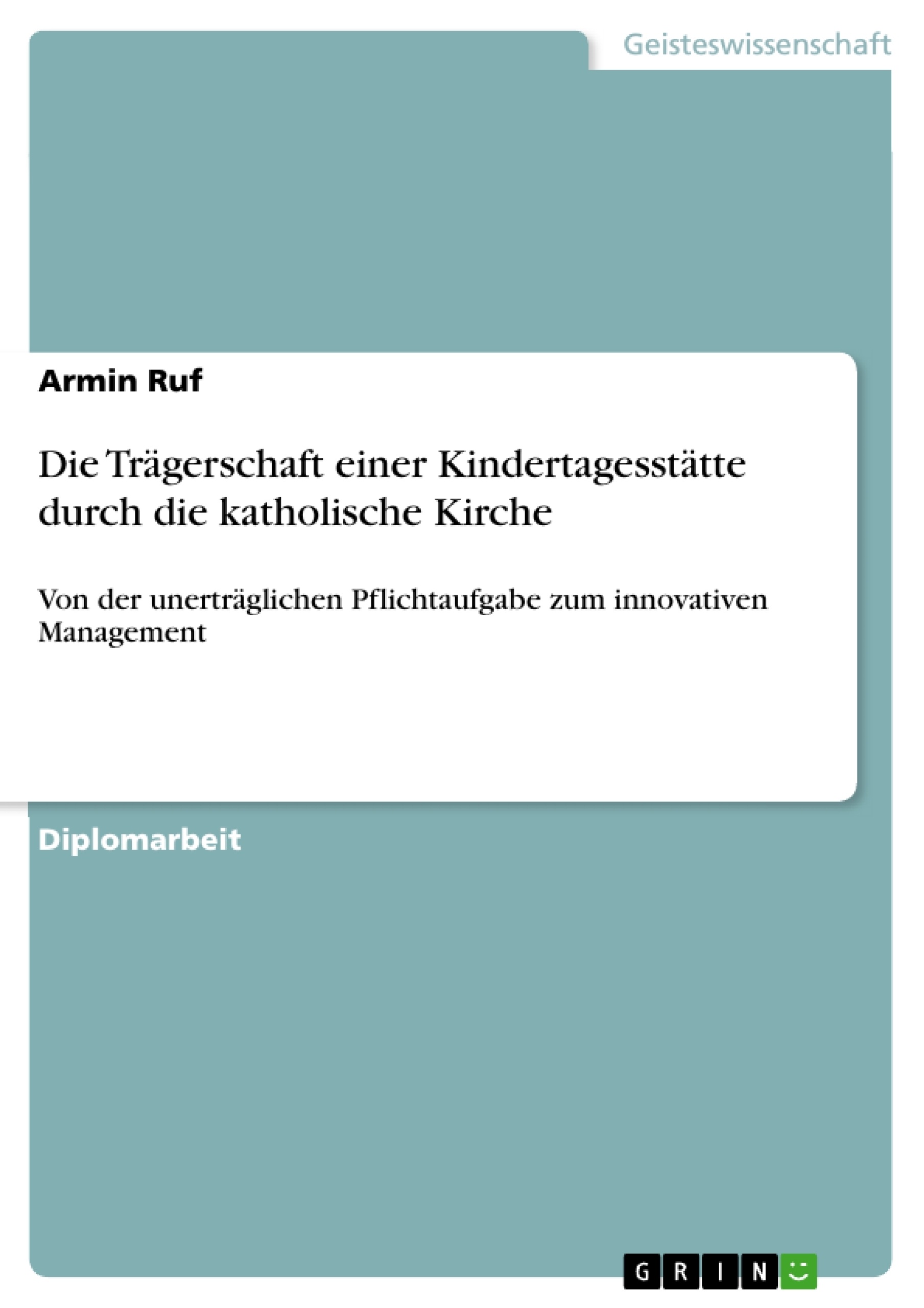Kindergärten sind eine gesellschaftlich akzeptierte Selbstverständlichkeit. Kirchlich und gesellschaftlich anerkannt ist heute, dass Kinder in unserer Gesellschaft in einem geteilten Sozialisationsfeld, als privat-familiales und öffentlich-institutionelles aufwachsen. Unter den Tageseinrichtungen nehmen die unter konfessioneller Trägerschaft geführten Tagesstätten eine bedeutende Stellung ein:
„So befanden sich Ende 2002 64% aller Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft…Von den insgesamt 23 610 Einrichtung in freier Trägerschaft waren 38 % in Trägerschaft des Deutschen Caritasverbands und anderer katholischer Träger (vor allem katholischer Kirchengemeinden).
Trotz der gesellschaftlich anerkannten Position und der Akzeptanz der Familien wird binnenkirchlich sehr wohl die Frage nach der Bedeutung der konfessionell geführten Kindertagesstätte gestellt. Relevante Diskussionspunkte sind dabei: Ist das katholische Profil überhaupt noch gefragt? Und wie kann ein katholisches Profil in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft umgesetzt werden? Können es sich die Diözesen und Kirchenstiftungen in Zukunft finanziell leisten, als Träger von Kindergärten aufzutreten? Mit diesen Fragen wurde ich in meiner Tätigkeit als Gemeindereferent in einer Pfarreiengemeinschaft (PG) konfrontiert.
Auf Grund der hohen Belastung durch die Leitungs- und Seelsorgeaufgaben in vier Pfarreien erwog der verantwortliche Priester der PG, die Trägerschaft der zwei kirchlichen Kindergärten abzugeben. Neben den finanziellen Belastungen für die Kirchenstiftung (bei zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen und Spendengeldern) war ein wichtiger Grund für diese Überlegungen des derzeitigen Umbaus, in welchem sich die Kirche befindet, und welcher einen Großteil der pastoralen Kräfte zu binden droht. Die darauf hin folgenden Diskussionen drehten sich immer wieder um die gleiche Punkte:
•Sind wir in unseren pastoralen Bemühungen nicht vorwiegend für katholische Kinder da oder auch für Kinder, die – gleich welcher Konfession – in unseren Kindergarten gehen?
•Leistet der Kindergarten denn wirklich einen Gemeindeaufbau, oder ist er nicht allein ein bloßes Dienstleistungsangebot, das nur kostet und nichts bringt?
•Sind die ‚Laienfrauen’ tatsächlich so gut geeignet wie früher die Ordensschwestern und wie lässt sich deren Kirchlichkeit überprüfen?
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Die aktuelle Lebenssituation von Familien in Deutschland
- Ökonomie
- Rollenkomplexität
- Multilokalität
- Mobilität
- Flexibilität
- Kinderbetreuungsangebot
- Anforderungen an katholische Kindertageseinrichtungen im 21. Jahrhundert
- Marktorientierung
- Kundenorientierung
- Rückgang der Kirchensteuer
- Finanzierungsmodelle
- Pisa und Bayerischer Erziehungs- und Bildungsplan
- Profil und Glaubensbezeugung
- Die Position der katholischen Kirche in Deutschland
- Weichenstellung des Konzils
- Mitverantwortung für das Leben der Menschen und die Zukunft der Gesellschaft (Die Deutschen Bischöfe)
- Innovation aus Tradition (KTK: Bundesverband katholischer Tageseinrichtungen für Kinder)
- Ein klares Profil (KTK - Bayern)
- Wo kleines Gross werden kann (Der Bischof von Augsburg)
- Die Situation kirchlicher Träger von Kindertagesstätten
- Kirche im Umbau
- Drei Gespräche mit Priestern als Träger katholischer Kindertagesstätten
- „Mitspracherecht ohne Verantwortung“
- „Trägerschaft im Vorübergehen“
- „Trägerschaft als Auftrag“
- Die theologische Präferenztheorie für eine Trägerschaft
- Primat der Diakonie
- Auftrag der katholischen Tageseinrichtungen
- „Caritas Dei“: Grundlage einer theologische Präferenztheorie
- Communio und Charismen
- Abbild und Vergänglichkeit
- Freiheit, Gerechtigkeit, Mitschöpferschaft
- Spiritualität und Barmherzigkeit
- Solidarität und Subsidiarität
- Leid und Not, Gut und Böse
- Sünde und Beziehungswirklichkeit
- Leben teilen
- Adressaten
- Theologische Kriterien für die Bestimmung der Qualität katholischer Träger von Kindertageseinrichtungen
- Trägerschaft als Dienstleistungsfunktion
- Trägerschaft als partizipative Wahrnehmung von Leitungsfunktionen
- Trägerschaft als anwaltliches Handeln
- Innovationsschub durch Qualitätsentwicklungsprozesse
- Leitbildformulierung im Rahmen des QM - Projekt (Caritasverband Augsburg)
- Leitbild
- Handbuch
- Selbstevaluation (IFP Handbuch)
- Elternbefragung
- Auswertung
- KTK- Gütesiegel
- Bewertungsfläche
- Qualitätsdimensionen
- Qualitätsanforderungen
- Nachweismöglichkeiten
- Reflexion und Rückbesinnung
- Der Kindergarten: „Auge der Pfarrei“
- Die Tageseinrichtung: „Geschenk für die Familie“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Trägerschaft von Kindertagesstätten durch die katholische Kirche in Deutschland. Sie untersucht die Herausforderungen, denen sich diese Form der Trägerschaft im 21. Jahrhundert gegenübersieht, sowie die theologischen und pädagogischen Grundlagen, die eine katholische Trägerschaft auszeichnen.
- Die aktuelle Lebenssituation von Familien in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die Kinderbetreuung
- Die Rolle der katholischen Kirche im Bereich der Kindertagesstätten
- Die Bedeutung der „Caritas Dei“ als Grundlage einer theologischen Präferenztheorie für die Trägerschaft von Kindertagesstätten
- Die Entwicklung und Bedeutung von Qualitätskriterien für katholische Träger von Kindertagesstätten
- Die Herausforderungen und Chancen der Trägerschaft von Kindertagesstätten im Kontext des gesellschaftlichen und kirchlichen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die aktuelle Lebenssituation von Familien in Deutschland, einschließlich der Veränderungen in der Ökonomie, der Rollenkomplexität, der Multilokalität, der Mobilität, der Flexibilität und des Kinderbetreuungsangebots. Das zweite Kapitel analysiert die Anforderungen an katholische Kindertageseinrichtungen im 21. Jahrhundert, wobei Themen wie Marktorientierung, Kundenorientierung, Rückgang der Kirchensteuer, Finanzierungsmodelle, Pisa-Studie und der Bayerische Erziehungs- und Bildungsplan betrachtet werden.
Im dritten Kapitel wird die Position der katholischen Kirche in Deutschland hinsichtlich der Trägerschaft von Tageseinrichtungen beleuchtet. Dabei werden die Weichenstellung des Konzils, die Mitverantwortung für das Leben der Menschen und die Zukunft der Gesellschaft sowie die Innovation aus Tradition und ein klares Profil der Kirche im Bereich der Kindertagesbetreuung erörtert. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Situation kirchlicher Träger von Kindertagesstätten, wobei die Kirche im Umbau und die Herausforderungen für Priester als Träger katholischer Kindertagesstätten im Zentrum stehen. Es werden drei Gespräche mit Priestern geführt, die Einblicke in die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen der Trägerschaft geben.
Das fünfte Kapitel entwickelt eine theologische Präferenztheorie für eine Trägerschaft von Kindertagesstätten. Dabei wird der Primat der Diakonie und der Auftrag der katholischen Tageseinrichtungen im Kontext der „Caritas Dei“ erläutert. Es werden verschiedene Aspekte der „Caritas Dei“ wie Communio und Charismen, Abbild und Vergänglichkeit, Freiheit, Gerechtigkeit und Mitschöpferschaft, Spiritualität und Barmherzigkeit, Solidarität und Subsidiarität, Leid und Not, Gut und Böse, Sünde und Beziehungswirklichkeit, Leben teilen sowie die Adressaten der Diakonie dargestellt. Das sechste Kapitel legt theologische Kriterien für die Bestimmung der Qualität von katholischen Trägern von Kindertagesstätten dar. Die Trägerschaft wird als Dienstleistungsfunktion, als partizipative Wahrnehmung von Leitungsfunktionen und als anwaltliches Handeln betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die katholische Kirche in Deutschland, die Trägerschaft von Kindertagesstätten, die „Caritas Dei“, die theologische Präferenztheorie, die Qualitätsentwicklungsprozesse, die Herausforderungen im 21. Jahrhundert und die Bedeutung des kirchlichen Profils in einem multikulturellen und multireligiösen Kontext.
- Quote paper
- Armin Ruf (Author), 2004, Die Trägerschaft einer Kindertagesstätte durch die katholische Kirche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94446