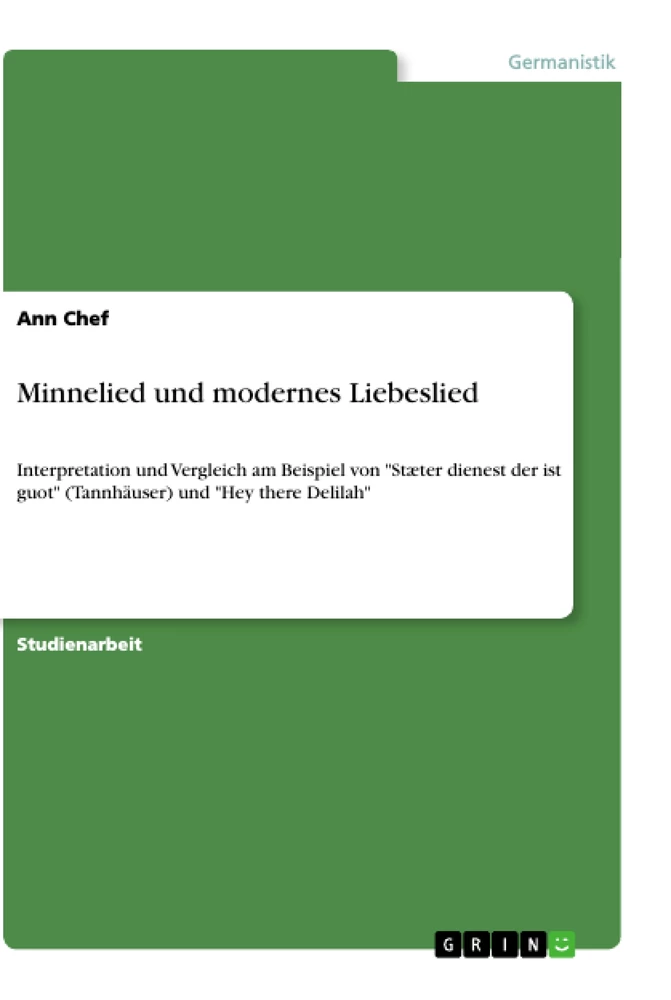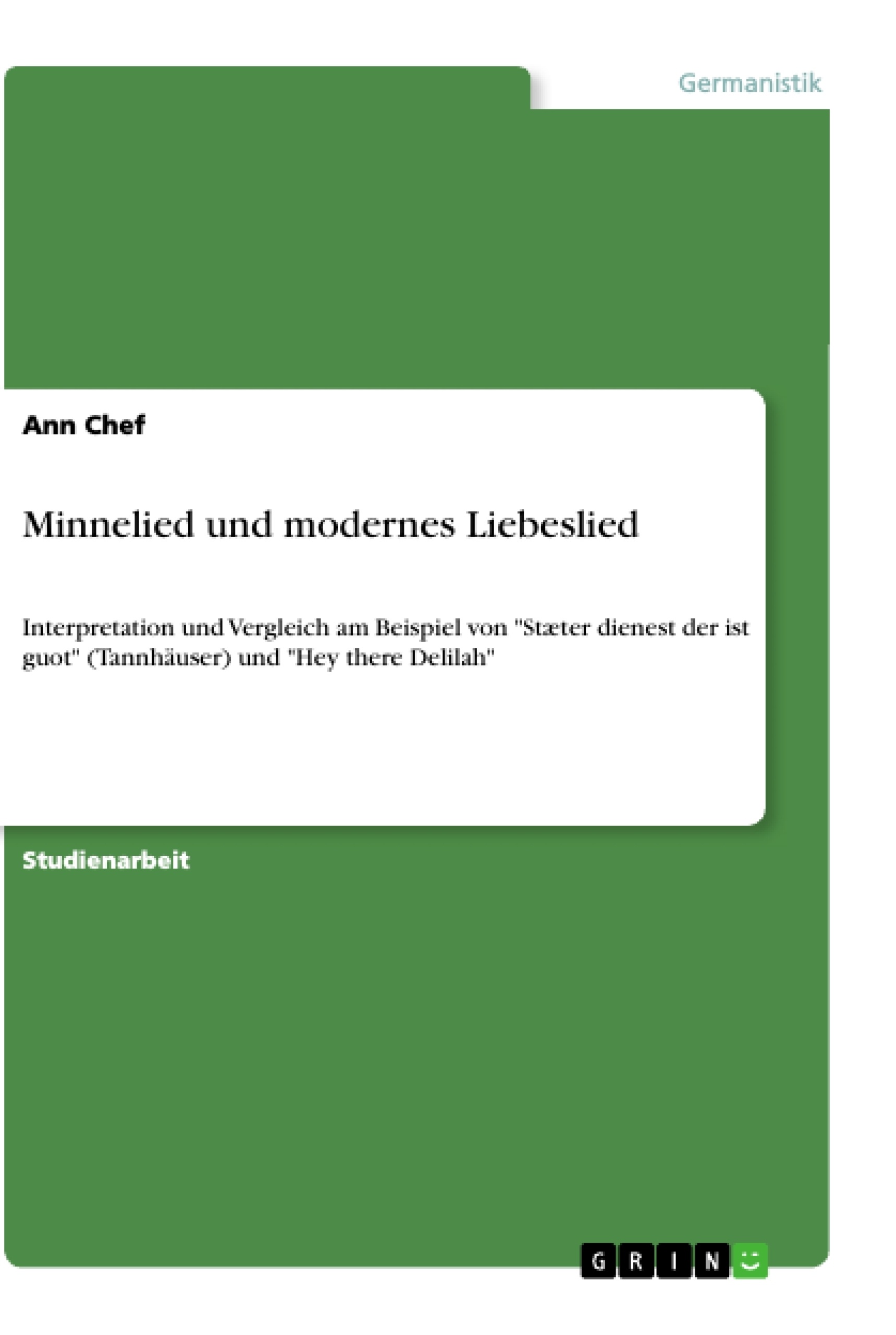In der Arbeit soll "Stæter dienest, der ist guot "von Tannhäuser interpretiert werden und anschließend mit dem modernen Liebeslied „Hey there Delilah“ von der US- amerikanischen Band Plain White T’s verglichen werden.
Im ersten Teil der Arbeit soll untersucht werden, wie das Verhältnis zwischen dem lyrischen Ich und dessen Angebeteten definiert ist und ob eine klassische Rollenverteilung vorherrscht. Auch die Darstellung der Minnedame wird untersucht. Darauf aufbauend soll im zweiten Teil der Arbeit das moderne Liebeslied bezüglich dieser Vergleichspunkte zur Gegenüberstellung herangezogen werden.
Im Vergleich soll dargelegt werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich bezüglich der Gesichtspunkte feststellen lassen.
Die Arbeit konzentriert sich daher auf diese Schwerpunkte. Auf die Frage nach der Minnekritik in Tannhäusers Minnelied wird im Folgenden nicht eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 2.1. Interpretation des Minnelieds
- 2.2. Vergleich
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Tannhäusers Minnelied „Stæter dienest, der ist guot“ und vergleicht es mit dem modernen Liebeslied „Hey there Delilah“. Ziel ist es, die Darstellung des Verhältnisses zwischen dem lyrischen Ich und der Minnedame im mittelalterlichen Kontext zu untersuchen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zu einem modernen Liebeslied herauszuarbeiten.
- Interpretation des Minnedienstes im Minnelied von Tannhäuser
- Analyse der Rollenverteilung zwischen dem lyrischen Ich und der Minnedame
- Untersuchung der Darstellung der Minnedame
- Vergleich der traditionellen Minnekonstellation mit modernen Liebesliedern
- Analyse der rhetorischen Mittel (Adynaton)
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Minneliedes im Mittelalter ein und stellt das zentrale Objekt der Analyse, Tannhäusers „Stæter dienest, der ist guot“, vor. Sie erläutert den Vergleich mit dem modernen Lied „Hey there Delilah“ und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Rollenverteilung und der Darstellung der Minnedame, wobei die Minnekritik ausgeblendet wird.
II. Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in die Interpretation von Tannhäusers Minnelied und den Vergleich mit einem modernen Liebeslied. Die Interpretation konzentriert sich auf die Analyse des Minnedienstes, die Darstellung der Minnedame und die Analyse der rhetorischen Mittel, insbesondere des Adynatons, um die Unmöglichkeit der Forderungen der Minnedame zu verdeutlichen und die hierarchische Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und der Minnedame zu beleuchten. Dabei werden die einzelnen Strophen und der Refrain analysiert und in Bezug zu traditionellen Elementen der Minnekonstellation gesetzt. Die Analyse beleuchtet die unerfüllbaren Forderungen der Minnedame und die daraus resultierende emotionale Diskrepanz.
Schlüsselwörter
Minnelied, Tannhäuser, Minnedienst, Minnedame, lyrisches Ich, Adynaton, Rollenverteilung, hierarchisches Verhältnis, höfische Liebe, modernes Liebeslied, Vergleich, rhetorische Figuren.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Tannhäusers „Stæter dienest, der ist guot“ im Vergleich zu „Hey there Delilah“
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Arbeit analysiert das mittelalterliche Minnelied „Stæter dienest, der ist guot“ von Tannhäuser und vergleicht es mit dem modernen Liebeslied „Hey there Delilah“. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Darstellung des Verhältnisses zwischen dem lyrischen Ich und der Minnedame in beiden Liedern und den Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Darstellung des Minnedienstes im Minnelied Tannhäusers zu interpretieren, die Rollenverteilung zwischen lyrischem Ich und Minnedame zu analysieren, die Darstellung der Minnedame zu untersuchen und schließlich einen Vergleich zwischen der traditionellen Minnekonstellation und modernen Liebesliedern zu ziehen. Die Analyse rhetorischer Mittel, insbesondere des Adynatons, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Interpretation des Minnedienstes, die Analyse der Rollenverteilung zwischen dem lyrischen Ich und der Minnedame, die Untersuchung der Darstellung der Minnedame, der Vergleich der traditionellen Minnekonstellation mit modernen Liebesliedern und die Analyse rhetorischer Mittel wie des Adynatons. Die Minnekritik wird dabei ausgeblendet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die beiden Lieder vor. Der Hauptteil interpretiert Tannhäusers Minnelied und vergleicht es mit „Hey there Delilah“. Der Vergleich konzentriert sich auf die Analyse des Minnedienstes, die Darstellung der Minnedame und die verwendeten rhetorischen Mittel.
Welche Aspekte werden im Hauptteil detailliert untersucht?
Der Hauptteil analysiert den Minnedienst im Minnelied Tannhäusers, die Darstellung der Minnedame (ihre unerfüllbaren Forderungen und die daraus resultierende emotionale Diskrepanz), die Rollenverteilung und die rhetorischen Mittel (insbesondere das Adynaton) um die hierarchische Beziehung und die Unmöglichkeit der Forderungen der Minnedame zu beleuchten. Die Analyse bezieht sich auf einzelne Strophen und den Refrain und setzt diese in den Kontext traditioneller Elemente der Minnekonstellation.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Minnelied, Tannhäuser, Minnedienst, Minnedame, lyrisches Ich, Adynaton, Rollenverteilung, hierarchisches Verhältnis, höfische Liebe, modernes Liebeslied, Vergleich, rhetorische Figuren.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die Zusammenfassung enthält kein explizites Fazit. Um diese Frage zu beantworten, müsste der abschließende Teil der Arbeit, der im HTML-Code fehlt, hinzugezogen werden.)
- Quote paper
- Ann Chef (Author), 2016, Minnelied und modernes Liebeslied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/944072