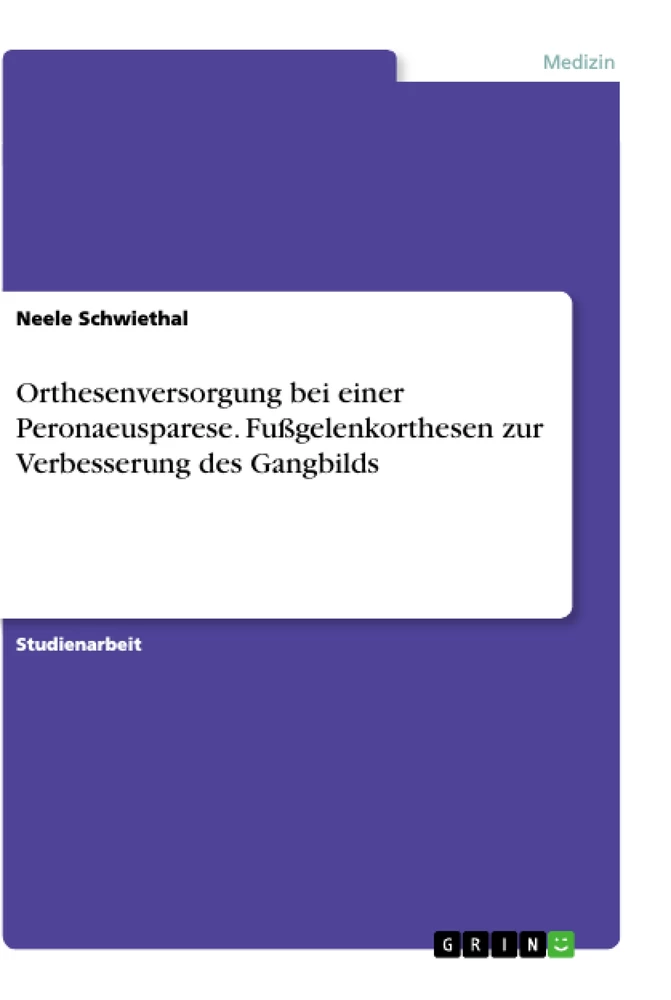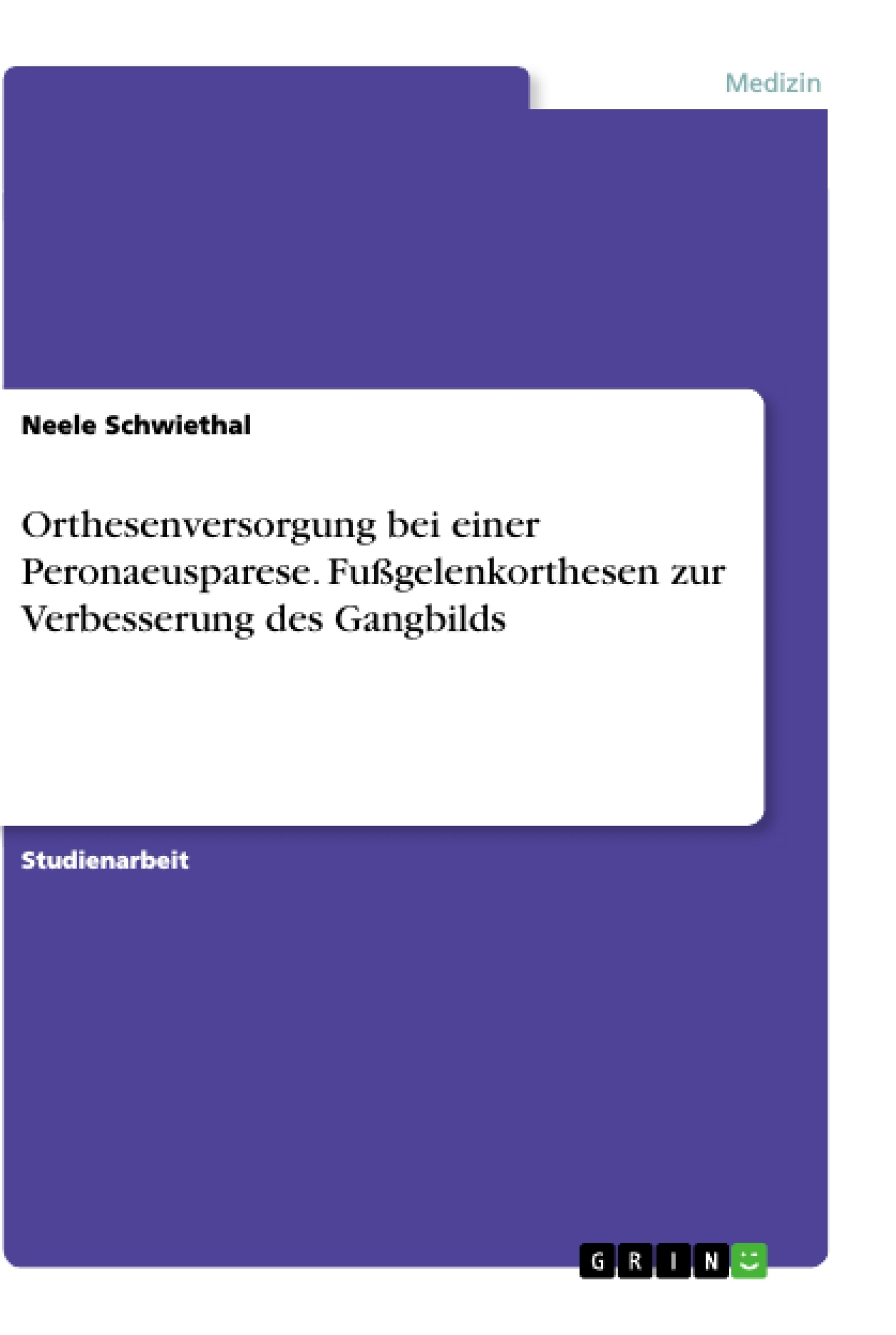In der Arbeit wird untersucht, inwiefern das Tragen von Fußgelenkorthesen das Gangbild von Klienten*innen mit einer Fußheberschwäche bezogen auf die Gehgeschwindigkeit und das Gleichgewicht im Vergleich zu dem Wickeln des Fußes verbessert. Zur Beantwortung der Fragestellung wurde eine Literaturrecherche durchgeführt.
Hierbei wurden Studien und Werke berücksichtigt, die Personen mit einer Fußheberschwäche verschiedener Ätiologien untersuchten und die einen chronischen Verlauf zeigten. Zudem wurde auf den klinischen Fall einer 77 jährigen Klientin mit einer Fußheberschwäche Bezug genommen, die zeitweise eine Orthese getragen hatte und einen entsprechenden Erfolg erzielen konnte, nun aber auf dieses Hilfsmittel verzichtet. Das Tragen von Fußgelenksorthesen verbessert nachweislich die Gehgeschwindigkeit und das Gleichgewicht bei Klienten*innen mit einseitiger Fußheberschwäche.
Auch auf die Neuroplastizität haben vor allem FES-Modelle einen positiven Einfluss. Im Vergleich zu dem Wickeln des Fußes mit Hilfe eines Peronaeuswickels oder -zugs gestaltet sich das Verwenden einer Orthese vor allem im Alltag praktisch auf Grund des leichten Handlings beim An- und Ausziehen. Einige Modelle, wie das invasive FES-Modell, bedürfen sogar keine weiteren eigenständigen Handlingmaßnahmen. Das Wickeln des Fußes lässt sich kurzfristig und temporär in die Therapieeinheiten eingliedern und gibt hier einen sinnvollen Reiz bei der Gangschule, jedoch etabliert sich diese Technik nicht im Alltag. Auf Grund der mittlerweile großen Auswahl an vorhandenen Orthesenmodellen und einer adäquaten Anpassung ist für nahezu jede individuelle Problematik eine Lösung zu finden. Ob sich das dauerhafte Tragen von Orthesen bei einer Fußheberschwäche auch negativ äußert, sprich ob es zu einer Hypotrophie des m. tibialis anterior führen kann, wird zwar teilweise belegt, jedoch sollten hier noch weitere tiefgreifende Untersuchungen durchgeführt und entsprechende Handlungsempfehlungen gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Darstellung klinischer Fall
- Theoretischer Hintergrund und Fragestellung
- Methodik
- Ergebnisse
- Diskussion
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Wirksamkeit von Fußgelenkorthesen im Vergleich zu Fußwickeltechniken bei der Behandlung einer Fußheberschwäche. Ziel ist es, die Auswirkungen auf Gehgeschwindigkeit und Gleichgewicht zu evaluieren und die praktische Anwendbarkeit beider Methoden im Alltag zu bewerten. Die Arbeit bezieht sich auf einen klinischen Fall und stützt sich auf eine Literaturrecherche.
- Wirksamkeit von Fußgelenkorthesen bei Fußheberschwäche
- Vergleich von Orthesen und Fußwickeltechniken
- Einfluss auf Gehgeschwindigkeit und Gleichgewicht
- Praktische Anwendbarkeit im Alltag
- Neuroplastizität und FES-Modelle
Zusammenfassung der Kapitel
Zusammenfassung: Diese Zusammenfassung fasst die gesamte Arbeit zusammen und gibt einen Überblick über die Forschungsfrage, die Methodik, die Ergebnisse und die Schlussfolgerungen. Es wird die Verbesserung von Gehgeschwindigkeit und Gleichgewicht durch Orthesen bei einseitiger Fußheberschwäche hervorgehoben und der positive Einfluss von FES-Modellen auf die Neuroplastizität betont. Der Vergleich mit Fußwickeltechniken zeigt die praktische Überlegenheit von Orthesen im Alltag, während Fußwickel eher für therapeutische Zwecke geeignet sind. Die Arbeit weist auf den Bedarf weiterer Forschung bezüglich möglicher negativer Langzeitwirkungen des Orthesen-Tragens hin.
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Problem der Fußheberschwäche und deren Auswirkungen auf den Alltag Betroffener. Es wird die Notwendigkeit von Hilfsmitteln wie Orthesen und Fußwickeltechniken angesprochen und die Forschungsfrage nach deren Wirksamkeit und praktischer Anwendbarkeit formuliert. Der klinische Fall einer 77-jährigen Patientin mit Fußheberschwäche wird als Grundlage der Untersuchung vorgestellt.
Darstellung klinischer Fall: Dieses Kapitel präsentiert den detaillierten Fall einer 77-jährigen Patientin mit einer durch Spondylolisthesis verursachten Fußheberschwäche. Es schildert den Krankheitsverlauf, die durchgeführten Behandlungen (einschließlich temporärer Orthesen-Anwendung), sowie die aktuelle Therapie und Rehabilitation der Patientin. Die Einordnung des Falls in das ICF-Modell wird erläutert, um ein ganzheitliches Bild der Situation zu geben. Die Beschreibung der Behandlung und des Fortschritts der Patientin illustriert die praktische Relevanz der Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Fußheberschwäche, Peronaeusparese, Fußgelenkorthese, Wickeltechniken, FES, Gehgeschwindigkeit, Gleichgewicht, Neuroplastizität, ICF-Modell, Spondylolisthesis.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Wirksamkeit von Fußgelenkorthesen bei Fußheberschwäche
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit von Fußgelenkorthesen im Vergleich zu Fußwickeltechniken bei der Behandlung einer Fußheberschwäche. Der Fokus liegt auf der Evaluierung der Auswirkungen auf Gehgeschwindigkeit und Gleichgewicht sowie der praktischen Anwendbarkeit beider Methoden im Alltag. Ein klinischer Fall einer 77-jährigen Patientin dient als Grundlage der Untersuchung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Wirksamkeit von Fußgelenkorthesen und Fußwickeltechniken bei Fußheberschwäche zu vergleichen und deren Einfluss auf Gehgeschwindigkeit und Gleichgewicht zu analysieren. Die praktische Anwendbarkeit beider Methoden im Alltag soll ebenfalls bewertet werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Wirksamkeit von Fußgelenkorthesen bei Fußheberschwäche, Vergleich von Orthesen und Fußwickeltechniken, Einfluss auf Gehgeschwindigkeit und Gleichgewicht, praktische Anwendbarkeit im Alltag, Neuroplastizität und FES-Modelle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Zusammenfassung, Einleitung, Darstellung eines klinischen Falls, einen Abschnitt zum theoretischen Hintergrund und zur Fragestellung, Methodik, Ergebnisse, Diskussion, Fazit und Ausblick sowie ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschungsfrage.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse zeigen die Verbesserung von Gehgeschwindigkeit und Gleichgewicht durch Orthesen bei einseitiger Fußheberschwäche. Der positive Einfluss von FES-Modellen auf die Neuroplastizität wird betont. Der Vergleich mit Fußwickeltechniken verdeutlicht die praktische Überlegenheit von Orthesen im Alltag, während Fußwickel eher für therapeutische Zwecke geeignet erscheinen. Die Arbeit weist auf den Bedarf weiterer Forschung bezüglich möglicher negativer Langzeitwirkungen des Orthesen-Tragens hin.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit schlussfolgert, dass Fußgelenkorthesen im Vergleich zu Fußwickeltechniken eine höhere praktische Anwendbarkeit im Alltag bei der Behandlung von Fußheberschwäche aufweisen. Allerdings wird weiterer Forschungsbedarf bezüglich möglicher Langzeitwirkungen des Orthesen-Tragens betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fußheberschwäche, Peronaeusparese, Fußgelenkorthese, Wickeltechniken, FES, Gehgeschwindigkeit, Gleichgewicht, Neuroplastizität, ICF-Modell, Spondylolisthesis.
Welcher klinische Fall wird beschrieben?
Die Arbeit beschreibt den detaillierten Fall einer 77-jährigen Patientin mit einer durch Spondylolisthesis verursachten Fußheberschwäche, inklusive Krankheitsverlauf, Behandlungen und Rehabilitation. Der Fall wird im Kontext des ICF-Modells eingeordnet.
- Quote paper
- Neele Schwiethal (Author), 2019, Orthesenversorgung bei einer Peronaeusparese. Fußgelenkorthesen zur Verbesserung des Gangbilds, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/943188