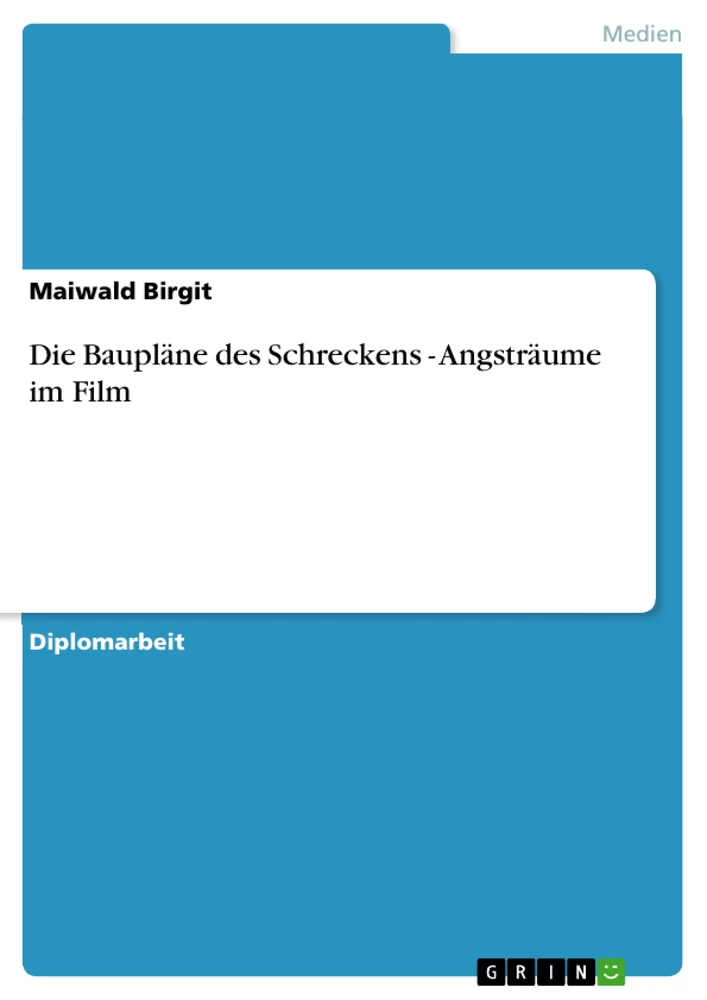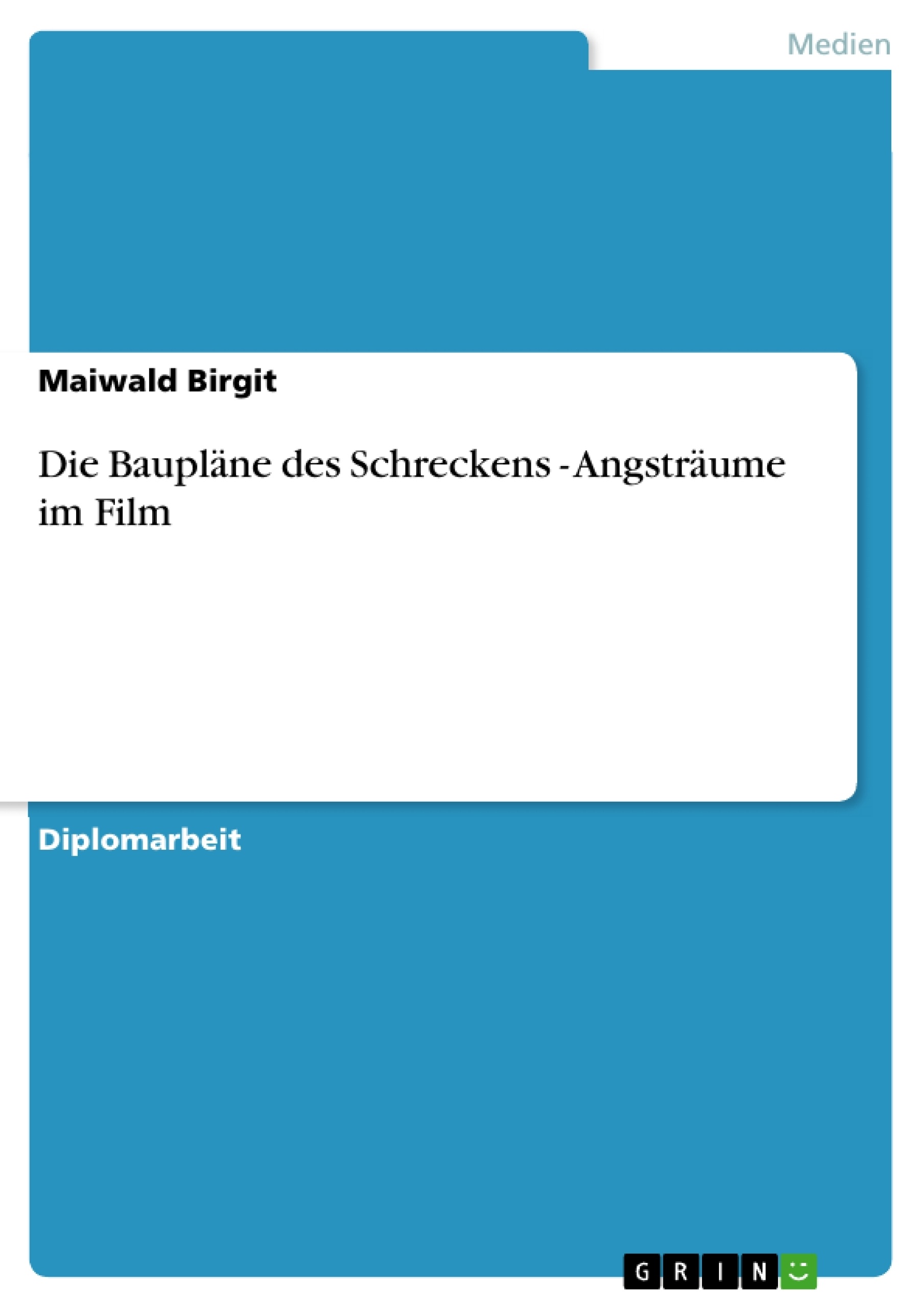Angst wird in der Psychologie als ein mit Beengung und Verzweiflung verknüpftes Lebensgefühl beschrieben, dessen besonderes Kennzeichen die Aufhebung der willens- und verstandesmäßigen Steuerung der Persönlichkeit ist. „Man sieht in der Angst auch einen aus dem Gefahrenschutzinstinkt erwachsenden Affekt, der, teils in schleichend–quälender Form eine elementare Erschütterung bewirkt.“ Dieser Definition nach erscheint die Angst als unangenehmer Zustand, der nach Möglichkeit zu vermeiden sei. Zahlreiche Erfindungen, Gesetze und soziale Konventionen regeln das Zusammenleben der Menschen, um die Angst immer weiter aus dem täglichen Leben zu verbannen. Umso verwunderlicher erscheint vor diesem Hintergrund die gleichbleibende Popularität von Institutionen, die mit furchteinflößenden Attraktionen einen Ausbruch aus dieser Sicherheit ermöglichen wollen. So sind die Vergnügungen des Jahrmarkts, die schwindelerregenden Fahrgeschäfte, Free Fall Tower, Alkoholexzesse, Geisterbahnen und schauderhaft verzerrende Spiegel nicht denkbar ohne das bewusste Erleben von Angst und der Hoffnung, nach überstandener Prüfung mit beiden Beinen auf festem Boden in die Sicherheit des Alltags zurückzukehren.
Ein ähnlicher Masochismus lässt sich bei den Rezipienten Angst einflößender Filme beobachten. Es kostet Überwindung, die Einsamkeit im dunklen Kinosaal oder Wohnzimmer zu ertragen, hinzusehen, wenn mordlüsterne Monster, undurchschaubare Wesen aus einer anderen Welt oder die eigenen Nachbarn und Freunde dem Protagonisten zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. Es ist zu spät, um den Blick abzuwenden von der abstoßenden Gestalt der Halbwesen und ihren blutigen Taten, denn das lustvolle Stöhnen der Täter und die Schreie ihrer panischen Opfer erfüllen in bester Klangqualität den Raum und verhelfen dem Schrecken zur vollen Präsenz. Angst erfüllt den Zuschauer und wenn es ihm nicht gelingt, den Film bis zum Ende zu ertragen, dann werden die unaufgelösten Schreckensbilder ihn bis ins Unterbewusstsein verfolgen. Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Angstlust des Publikums und unternimmt den Versuch einer Ursachenforschung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Genre- und thementypische Aspekte des Angstfilms
- 2.1. Gewalt und Lust in der Filmrezeption
- 2.2. Vom Bedürfnis nach Konfrontation mit der Angst – Eine Ursachenforschung
- 2.3. Die Ursprünge des Angstfilms
- 2.3.1 Horrorfilm
- 2.3.2 Thriller
- 2.3.3 Science Fiction Film
- 2.3.4 Der Angstfilm – Eine Kombination aus Horror-, Thriller und Science Fiction Film
- 2.4. Suspense und Surprise – Die konstitutive dramaturgische Struktur des Angstfilms
- 3. Von der Locus – Einstellung zum Masterspace – Zur Geschichte und Entwicklung der filmischen Raumdarstellung
- 3.1. Die Raummechanismen der starren Bildmedien
- 3.2. Die Raummechanismen des frühen Films
- 3.3. Die Raummechanismen der ersten narrativen Filme
- 3.4. Die Raummechanismen des klassischen Erzählkinos
- 3.5. Integration der Raummechanismen zum szenischen Masterspace
- 4. Angsträume im Film
- 4.1. Die Bedeutung des filmischen Raums für den Realitätseindruck des Phantastischen am Beispiel von The Haunting
- 4.1.1 Spezifische halluzinatorische Raummechanismen in The Haunting
- 4.1.2 The Haunting – Ein Thriller in einem verwunschenen Haus
- 4.2. Prozessuale Angsträume – Zur sukzessiven Entstehung von Raum und Bedrohung
- 4.2.1 Off Screen - Blicke und Zeigegesten in Aliens - Die Rückkehr
- 4.2.2 Mechanismen am Punkt des Schnitts - Shock Cuts bei Psycho
- 4.2.3 Der Terror des subjektiven Blicks in The Blair Witch Project
- 4.3. Die Semantisierung des Raumes im Angstfilm
- 4.3.1 Metapher und Wahnvorstellung – Brücken zwischen den Lebenden und den Toten in Wenn die Gondeln Trauer tragen
- 4.3.2 Das Eindringen von Dämonen in den weiblichen Körper als Sinnbild bedrohlicher Sexualität in Rosemary's Baby und Der Exorzist
- 4.3.3 Das Alien und die Bedrohung des bekannten Raumes durch die Invasion
- 4.3.3.1 Die kulturelle Dimension der Invasionsbewegung
- 4.3.3.2 Die sexuelle Dimension der Invasionsbewegung
- 4.3.3.3 Die biologische Dimension der Invasionsbewegung
- 4.4. Reflexive Räume im postmodernen Angstfilm
- 4.4.1 Die Krise der Vernunft – Labyrinthstrukturen aus Raum und Zeit in The Shining
- 4.4.2 Ringu - Mediale Realitätsverdopplung als Horrorszenario
- 4.4.3 Von der Auflösung der Grenzen zwischen Spielräumen, medialen Räumen und Wirklichkeit in Funny Games
- 4.1. Die Bedeutung des filmischen Raums für den Realitätseindruck des Phantastischen am Beispiel von The Haunting
- 5. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Angsträumen im Film. Ziel ist es, die genre- und thematischen Aspekte des Angstfilms zu analysieren und die Entwicklung der filmischen Raumdarstellung im Kontext der Angst ins Zentrum zu rücken. Dabei werden verschiedene Techniken der Angstinszenierung und deren Wirkung auf den Zuschauer beleuchtet.
- Die Genese und Entwicklung des Angstfilms
- Die Rolle des Raumes in der Erzeugung von Angst und Spannung
- Die filmischen Mittel zur Inszenierung von Angsträumen
- Die Beziehung zwischen Angst und Lust beim Rezipienten
- Die Entwicklung der Raumdarstellung im Horrorfilm von frühen Stummfilmen bis zum postmodernen Horror
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt Angst als ein Lebensgefühl, das durch die Aufhebung willentlicher Steuerung gekennzeichnet ist. Sie stellt die scheinbar paradoxe Popularität von Angsterfahrungen im Kontext von Alltagssicherheit heraus und kündigt die Untersuchung der Angstlust des Publikums und deren Ursachen an.
2. Genre- und thementypische Aspekte des Angstfilms: Dieses Kapitel analysiert die genre-spezifischen Eigenschaften des Angstfilms, darunter die Kombination von Horror, Thriller und Science Fiction. Es untersucht die psychologischen Aspekte der Gewalt und Lust in der Filmrezeption und erforscht die Gründe für das Bedürfnis der Menschen nach Konfrontation mit der Angst durch Medien wie Filme. Die Kapitel befassen sich mit der dramaturgischen Struktur, der bewussten Einsetzung von Suspense und Überraschungsmomenten.
3. Von der Locus – Einstellung zum Masterspace – Zur Geschichte und Entwicklung der filmischen Raumdarstellung: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung der filmischen Raumdarstellung von den starren Bildmedien bis zum klassischen Erzählkino. Es analysiert die Raummechanismen in verschiedenen Phasen der Filmgeschichte und beschreibt die Integration dieser Mechanismen zu einem szenischen Masterspace, der die Angst effektiv inszenieren kann. Die Entwicklung der Raumdarstellung wird als ein Schlüsselfaktor für die Wirkung von Angst in Filmen vorgestellt.
4. Angsträume im Film: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Arten von Angsträumen im Film. Es analysiert die Bedeutung des filmischen Raumes für den Realitätseindruck des Phantastischen, indem es Beispiele aus verschiedenen Filmen wie "The Haunting", "Aliens", "Psycho" und "The Blair Witch Project" heranzieht. Dabei wird die sukzessive Entstehung von Raum und Bedrohung, die Semantisierung des Raumes und die Rolle des Raumes im postmodernen Angstfilm erörtert. Die Analyse umfasst verschiedene filmische Techniken, die dazu beitragen, Angst und Schrecken beim Zuschauer zu erzeugen.
Schlüsselwörter
Angstfilm, Horrorfilm, Thriller, Science Fiction, Raumdarstellung, Filmische Technik, Angstinszenierung, Suspense, Surprise, Psychoanalyse, Rezeption, Realitätseindruck, Phantastisches, Postmoderner Horror.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Angsträume im Film
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Angsträumen im Film. Sie analysiert genre- und thematische Aspekte des Angstfilms und die Entwicklung der filmischen Raumdarstellung im Kontext der Angst. Im Fokus stehen verschiedene Techniken der Angstinszenierung und deren Wirkung auf den Zuschauer.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Genese und Entwicklung des Angstfilms, die Rolle des Raumes in der Erzeugung von Angst und Spannung, die filmischen Mittel zur Inszenierung von Angsträumen, die Beziehung zwischen Angst und Lust beim Rezipienten und die Entwicklung der Raumdarstellung im Horrorfilm von frühen Stummfilmen bis zum postmodernen Horror.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Genre- und thementypische Aspekte des Angstfilms, Von der Locus – Einstellung zum Masterspace – Zur Geschichte und Entwicklung der filmischen Raumdarstellung, Angsträume im Film und Schluss. Jedes Kapitel befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Angstinszenierung im Film.
Wie wird die Entwicklung der filmischen Raumdarstellung behandelt?
Die Arbeit verfolgt die Entwicklung der filmischen Raumdarstellung von den starren Bildmedien bis zum klassischen Erzählkino. Sie analysiert die Raummechanismen in verschiedenen Phasen der Filmgeschichte und beschreibt die Integration dieser Mechanismen zu einem szenischen Masterspace.
Welche Filme werden als Beispiele analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Filme, darunter "The Haunting", "Aliens", "Psycho", "The Blair Witch Project", "Wenn die Gondeln Trauer tragen", "Rosemary's Baby", "Der Exorzist", "The Shining", "Ringu" und "Funny Games", um verschiedene Arten von Angsträumen und deren Inszenierung zu veranschaulichen.
Welche filmischen Techniken werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene filmische Techniken zur Inszenierung von Angst, darunter die bewusste Einsetzung von Suspense und Überraschungsmomenten (Suspense und Surprise), Off-Screen-Blicke und Zeigegesten, Shock Cuts und die Inszenierung des subjektiven Blicks.
Welche psychologischen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit beleuchtet die psychologischen Aspekte der Gewalt und Lust in der Filmrezeption und erforscht die Gründe für das Bedürfnis der Menschen nach Konfrontation mit der Angst durch Medien wie Filme. Die Beziehung zwischen Angst und Lust beim Rezipienten wird ebenfalls untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Angstfilm, Horrorfilm, Thriller, Science Fiction, Raumdarstellung, Filmische Technik, Angstinszenierung, Suspense, Surprise, Psychoanalyse, Rezeption, Realitätseindruck, Phantastisches, Postmoderner Horror.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, die Darstellung von Angsträumen im Film zu untersuchen, genre- und thematische Aspekte des Angstfilms zu analysieren und die Entwicklung der filmischen Raumdarstellung im Kontext der Angst ins Zentrum zu rücken.
- Quote paper
- Maiwald Birgit (Author), 2007, Die Baupläne des Schreckens - Angsträume im Film, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94288