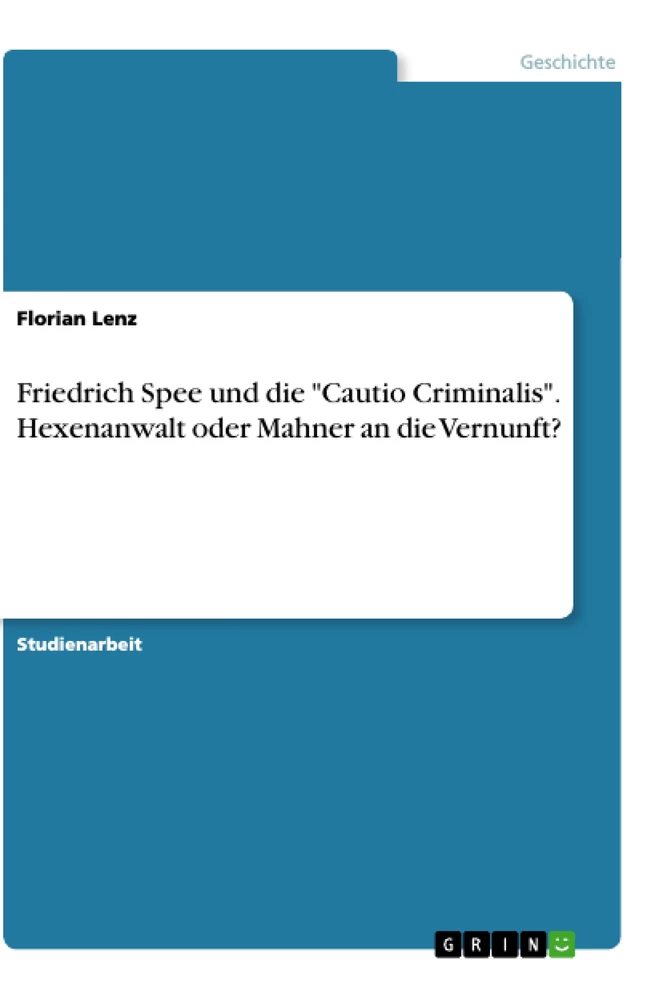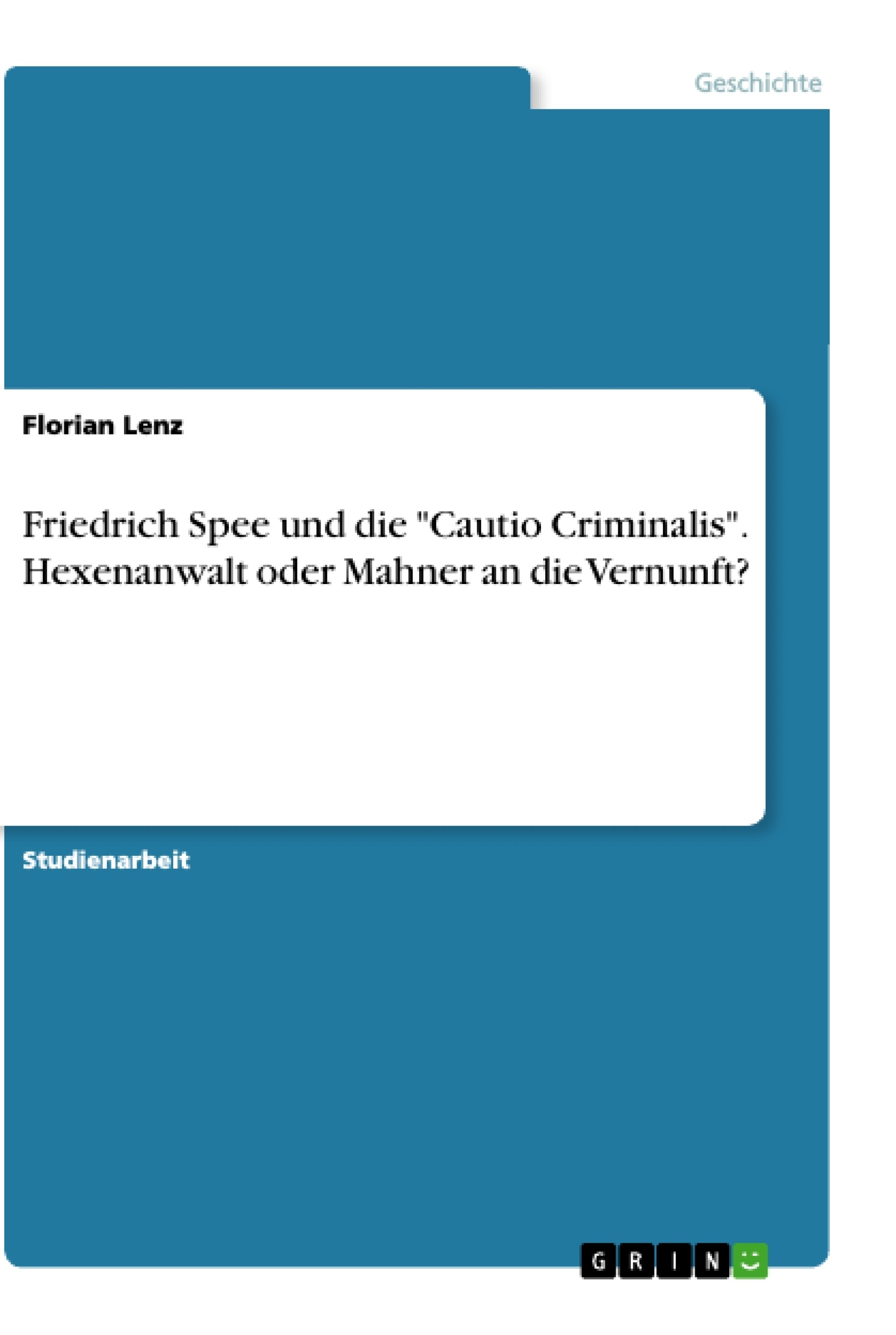Friedrich Spee SJ zählt zu den bedeutendsten Gelehrten des frühen 17. Jahrhunderts und ist heute doch ein wenig in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht. Er war Theologe und Dichter. Und er übte einen bedeutenden Einfluss auf die Srafjustiz aus. Er wandte sich in seiner Schrift "Cautio Criminalis" entschieden gegen die zu seiner Zeit üblichen Praktiken in den Strafverfahren gegen Hexen. Gekonnt führte er die innere Logik der Hexenprozesse ad absurdum und trug somit wesentlich dazu bei, den Hexenwahn zu beenden und die Folter im Strafprozess abzuschaffen.
In dieser Arbeit werden Leben und Werk des Friedrich Spee überblickartig dargestellt. Hernach wendet sich der Autor der Cautio Criminalis zu. Er stellt sie inhaltlich dar, ordnet sie in das Wesen der Strafverfahren um 1600 ein und beschreibt ihre Wirkung auf die Nachwelt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Leben und Werk des Friedrich Spee
- 1. Die Einordnung Friedrich Spees in seine Zeit
- 2. Leben und Werk
- 2.1 Herkunft und Ausbildung
- 2.2 Der Dichter
- 2.3 Der Theologe
- 2.4 Die Persönlichkeit
- 3. Die „Cautio Criminalis“
- 3.1 Hexenwahn
- 3.2 Juristische Praxis und Folter um 1630
- 3.3 Die Entstehung der „Cautio Criminalis“
- 3.4 Der Inhalt der „Cautio Criminalis“
- 3.4.1 Allgemeine Darstellung des Inhaltes
- 3.4.2 Spezielle Aspekte des Inhalts: Das Beispiel der Tortur
- III. Fazit
- 1. Hexenanwalt oder Mahner an die Vernunft?
- 2. Ein Rufer in der Wüste
- IV. Die Vita Friedrich Spees im Überblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Leben und Werk des Jesuiten Friedrich Spee darzustellen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Einordnung seines Werkes „Cautio Criminalis“ in die Biographie Spees und der Frage nach der Nachwirkung dieses Buches. Die Arbeit untersucht, ob die in neuerer Zeit verbreitete Bezeichnung „Hexenanwalt“ für Spee gerechtfertigt ist, indem sie die Motivation zum Schreiben der „Cautio Criminalis“ analysiert.
- Einordnung des Lebens und Werkes Friedrich Spees in den Kontext der Konfessionalisierung, des Hexenwahns und des Dreißigjährigen Krieges
- Analyse der „Cautio Criminalis“ als Rechtstext und ihre Bedeutung für die Strafrechtsgeschichte
- Untersuchung der Rolle Spees als Dichter und Theologe
- Beurteilung der Bezeichnung „Hexenanwalt“ im Hinblick auf Spees Motivation und Zielsetzung
- Bewertung der Nachwirkung und Rezeption von Spees Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt Friedrich Spee als bedeutenden Dichter des Barocks und Theologen vor und erläutert die Entstehung seines Werkes „Cautio Criminalis“. Die Arbeit untersucht die Motivation zum Schreiben dieses Werkes und die Frage nach seiner Nachwirkung.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Leben und Werk des Friedrich Spee. Hierbei wird zunächst seine Einordnung in die Zeit der Konfessionalisierung, des Hexenwahns und des Dreißigjährigen Krieges erläutert. Im Folgenden werden seine Herkunft und Ausbildung, seine Tätigkeit als Dichter und Theologe sowie seine Persönlichkeit beleuchtet.
- Das dritte Kapitel widmet sich der „Cautio Criminalis“. Zunächst wird der Kontext des Hexenwahns und der juristischen Praxis der Folter um 1630 dargestellt. Anschließend wird die Entstehung des Werkes und sein Inhalt im Detail analysiert, wobei der Fokus auf der Darstellung der Tortur liegt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themenfelder dieser Arbeit sind Friedrich Spee, „Cautio Criminalis“, Hexenwahn, Strafrechtsgeschichte, Barocklyrik, Kirchenlied, Theologie, Konfessionalisierung, Dreißigjähriger Krieg, Jesuitenorden, Seelsorge, Tortur, Rechtssystem, Hexenanwalt, Nachwirkung, Rezeption.
- Quote paper
- Florian Lenz (Author), 2006, Friedrich Spee und die "Cautio Criminalis". Hexenanwalt oder Mahner an die Vernunft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94283