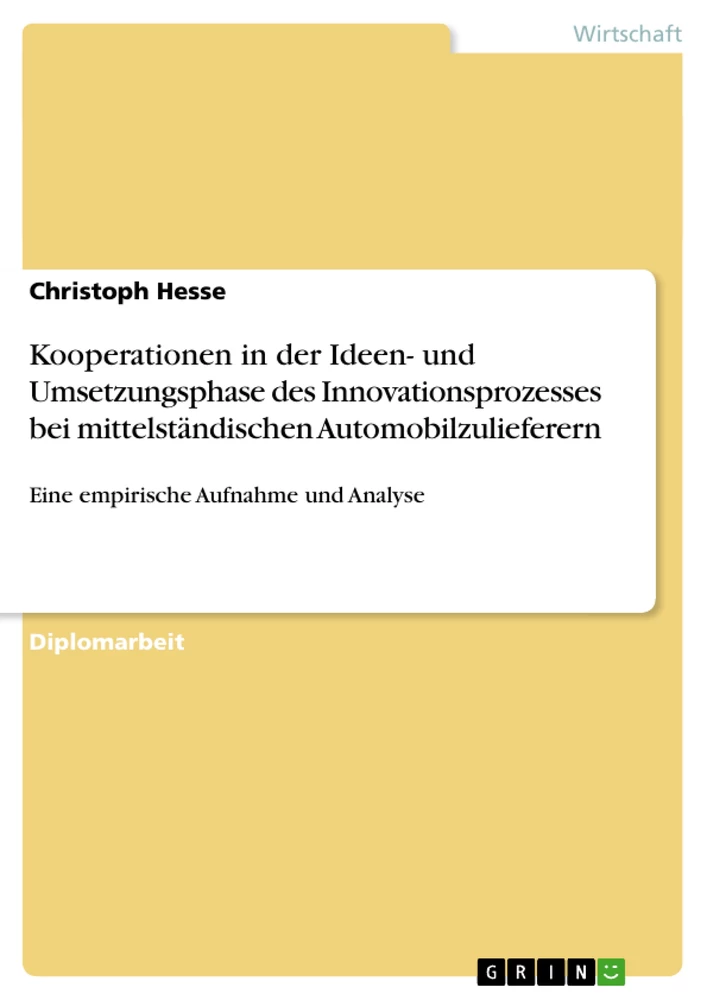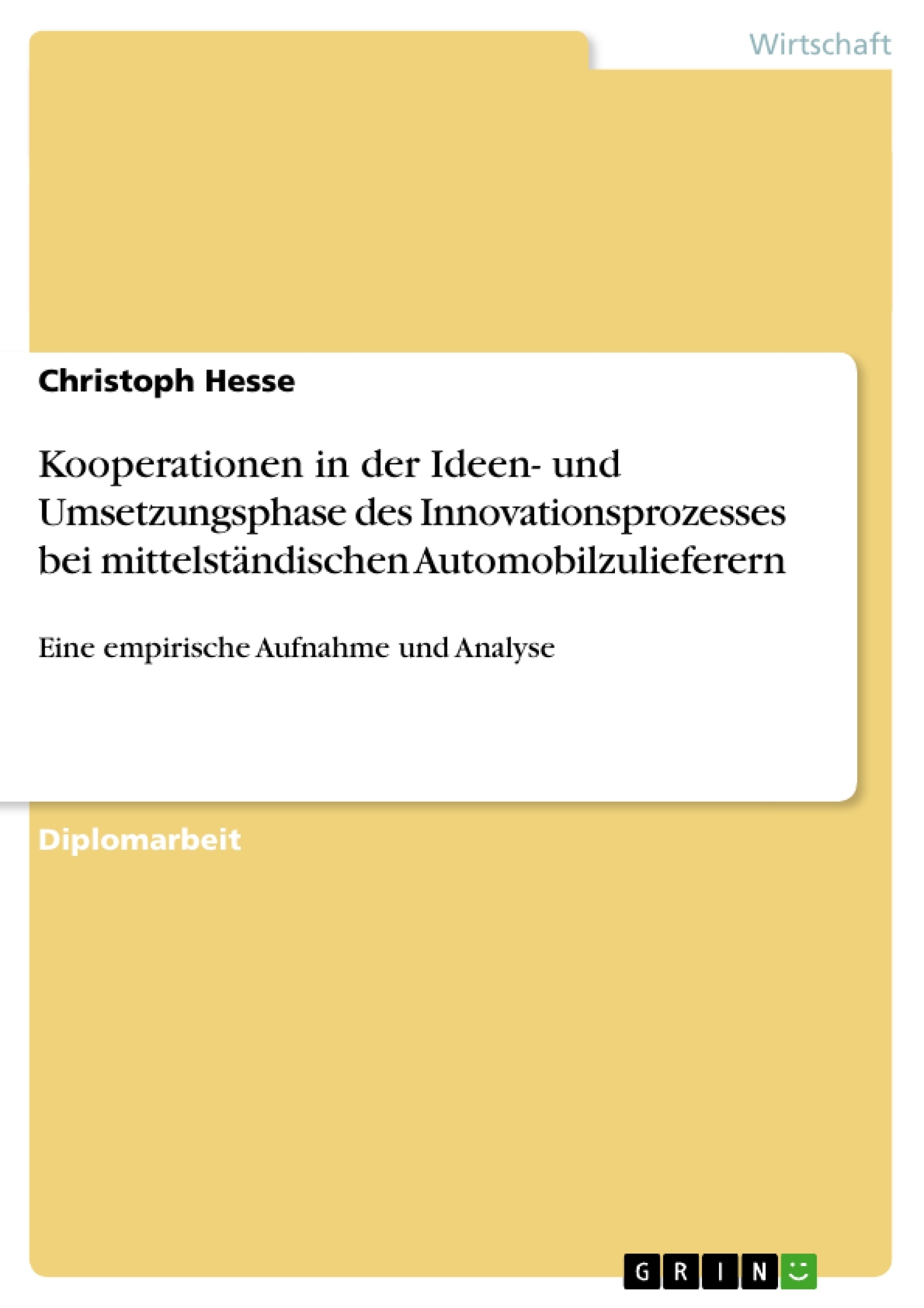Ein hohes Maß an Innovationsfähigkeit ist die Grundvoraussetzung für den Schutz der Wettbewerbsfähigkeit in einer globalisierten Welt. Aufgrund dieser Globalisierung hat sich der Druck auf die deutschen Automobilhersteller (OEMs) in den letzten Jahren deutlich erhöht. Diese nutzen jedoch ihre Marktmacht, um diesen Druck auf ihre Zulieferbetriebe abzuwälzen. Die OEMs geben immer mehr Wertschöpfung an Zulieferer ab, sowohl im Bereich der Teilezulieferung als auch im Bereich Forschung und Entwicklung und reduzieren somit ihre eigene Wertschöpfung. Den Großteil ihrer Teile beziehen OEMs von First-Tier-Lieferanten (Modul-/ Systemlieferanten), die wiederum von Second-Tier-Lieferanten und diese wiederum von Third-Tier-Lieferanten beliefert werden.
Der Fokus der Arbeit liegt auf den Zulieferern der 2. und 3. Stufe. Diese meist mittelständisch geprägten Unternehmen besitzen zwar hohe Kompetenzen im Kern, jedoch fehlt es an Ressourcen, um im zunehmend beschleunigten Innovationswettlauf mithalten zu können. Das firmeneigene Know-how reicht oft nicht für komplexe und übergreifende Innovationen aus, die aufgrund der aktuellen Automobiltrends Mechatronik, neue Materialien und komplette Vernetzung im Automobil vonnöten wären. Darüber hinaus besitzen diese Unternehmen nur sehr begrenzte personelle, technische und finanzielle Mittel, um den gewachsenen Anforderungen gerecht zu werden. Daher sind die 2nd und 3rd- Tier- Lieferanten besonders darauf angewiesen, das eigene Know-how mit dem komplementären Wissen anderer Organisationen zu verbinden. Das Eingehen von Kooperationen entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses ist unumgänglich. Diese Arbeit soll insbesondere Kooperationen in der Ideen- und der Umsetzungsphase des Innovationsprozesses beleuchten, da diese das größte Potenzial zur Verbesserung der Innovationsfähigkeit bieten.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, das Kooperationsverhalten der Automobilzulieferer der zweiten und dritten Stufe im Bundesland Nordrhein Westfalen in der Ideen- und Umsetzungsphase des Innovationsprozesses zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Problemstellung
- Aufbau der Diplomarbeit
- Grundlagen und Begriffe
- Grundlagen der unternehmerischen Innovationstätigkeit
- Begriff und Charakteristika der Innovation
- Ziele und Aufgaben des Innovationsmanagements
- Ideengewinnung
- Ideensammlung
- Interne Ideengenerierung
- Externe Ideengenerierung
- Ideenbewertung
- Umsetzung
- Besonderheiten von Innovationen und Arbeitsformen zu deren Umsetzung
- Bestandteile des Projektmanagement
- Bedeutung der Ideen- und Umsetzungsphase
- Grundlagen kooperativer Arrangements
- Kennzeichnung des Kooperationsbegriffs
- Klassifikationskriterien von Kooperationen
- Kooperationsformen
- Das Tier-Konzept und die Zulieferpyramide
- Kooperationen in der Ideen- und Umsetzungsphase
- Kooperationsmotive
- Kostengründe
- Zeitliche Gründe
- Qualitätsgründe
- Gestaltung von Kooperationen in der Ideen- und Umsetzungsphase
- Denkbare Kooperationsobjekte
- Denkbare Kooperationspartner
- Barrieren bei Kooperationen in der Ideen- und Umsetzungsphase
- Thesenbildung
- Überprüfende empirische Untersuchung zu Kooperationen in der Ideen- und Umsetzungsphase
- Empirische Erhebung
- Erhebungsverfahren und Aufbau des Fragebogens
- Grundgesamtheit und Stichprobenauswahl
- Ablauf der Datenerhebung
- Methodik der Datenauswertung
- Ergebnisse der empirischen Erhebung
- Charakterisierung der Stichprobe
- Brancheneingrenzung und Größenverteilung des Samples
- F&E-Verhalten des Samples
- Kooperationen im Allgemeinen
- Kooperationspartner, -intensität und -bereiche
- Kooperationsmotive
- Ideenphase
- Ideenherkunft
- Ideenprozess
- Kooperationspartner und -intensität
- Umsetzungsphase
- Aufbau des Projektmanagements
- Kooperationspartner und -intensität
- Suche und Aufbau von Partnerschaften
- Widerstände und Hindernisse bei Kooperationen in der Ideen- und Umsetzungsphase
- Hindernisse
- Gründe für das Nichtzustandekommen von Kooperationen mit den verschiedenen Partnern
- Die Rolle von Kooperationen im Innovationsprozess
- Motive und Barrieren für Kooperationen in der Ideen- und Umsetzungsphase
- Die Bedeutung von Kunden und Lieferanten als Kooperationspartner
- Analyse der Hindernisse und Herausforderungen im Rahmen von Kooperationen
- Entwicklung eines Lösungsansatzes zur Steigerung der Kooperationsaktivitäten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Bedeutung von Kooperationen in der Ideen- und Umsetzungsphase des Innovationsprozesses bei mittelständischen Automobilzulieferern. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung mit 256 Zulieferbetrieben in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist es, die praktische Umsetzung von Kooperationen, die Motive für eine Zusammenarbeit und mögliche Hindernisse zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Diplomarbeit führt in die Problemstellung ein und erläutert den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Innovationstätigkeit und kooperativer Arrangements. Es werden verschiedene Innovationsphasen, Kooperationsformen und das Tier-Konzept sowie die Zulieferpyramide vorgestellt.
Kapitel drei beleuchtet die Bedeutung von Kooperationen in der Ideen- und Umsetzungsphase des Innovationsprozesses und diskutiert die relevanten Motive und Barrieren. Kapitel vier präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, die sich auf die Kooperationsaktivitäten, -motive und -hindernisse der mittelständischen Automobilzulieferer in Nordrhein-Westfalen konzentriert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Innovationsprozess, Kooperation, Automobilzulieferer, Mittelstand, empirische Untersuchung, Ideenphase, Umsetzungsphase, Motiv, Barriere, Nordrhein-Westfalen. Die Kernaussagen der Arbeit zielen darauf ab, die Bedeutung von Kooperationen für die Innovationsfähigkeit mittelständischer Automobilzulieferer zu beleuchten und praktische Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu geben.
- Quote paper
- Christoph Hesse (Author), 2008, Kooperationen in der Ideen- und Umsetzungsphase des Innovationsprozesses bei mittelständischen Automobilzulieferern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94266