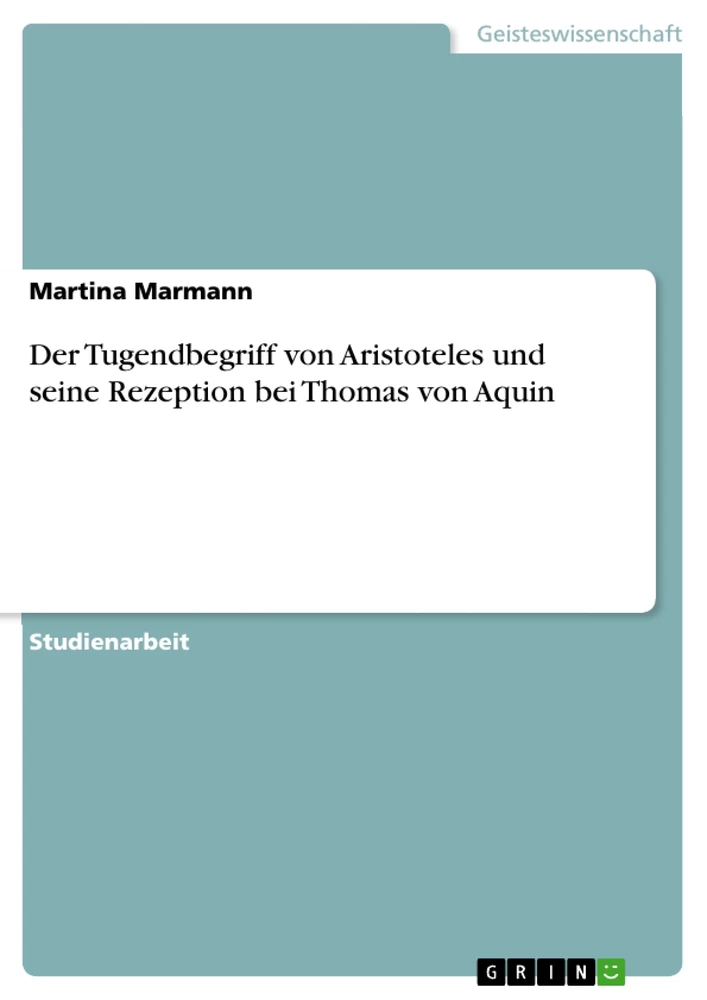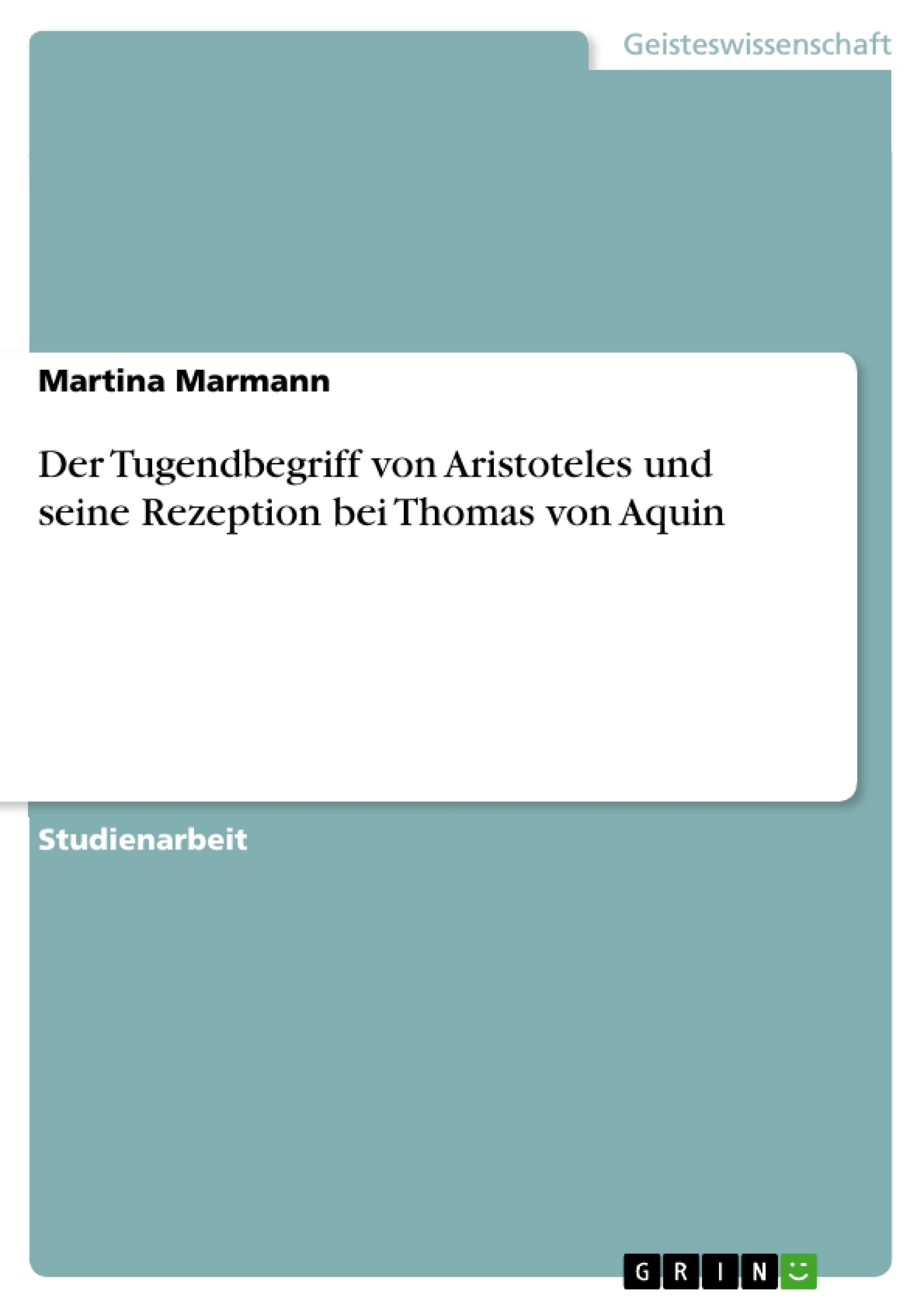Im Rahmen des Seminars „Das Gute Leben – nachgefragt bei den alten Griechen“ sind wir auf die Schrift von Aristoteles „Die Tugend“, seines Werkes Nikomachische Ethik gestoßen. Im Rahmen dieser Arbeit soll der Tugendbegriff genauer betrachtet werden. Dazu wird zunächst mit Hilfe eines Historischen Wörterbuches der Philosophie der Begriff im Allgemeinen thematisiert, bevor der Tugendbegriff bei Aristoteles dargestellt wird. An dieser Stelle soll unter anderem der Unterschied zwischen Verstandestugenden und sittlichen Tugenden geklärt werden. Auch die Begriffe des „Habitus“ und der „Mitte“ sollen thematisiert werden.
Im Anschluss an die Darstellung der Tugendlehre von Aristoteles soll Thomas’ Sichtweise erläutert werden. Er übernimmt einige Ansichten von Aristoteles, bringt aber die theologische Bedeutung von Tugend mit ein.
Anschließend soll die Rezeption des Tugendbegriffs von Aristoteles bei Thomas von Aquin genauer betrachtet werden.
Zum Abschluss dieser Seminararbeit möchte ich selbst Stellung beziehen, indem ich für mich wichtige Punkte noch einmal kurz aufgreife und meinen Standpunkt darstelle. Zum Einstieg in das Thema soll ein Blick auf die Bedeutung des Begriffs „Tugend“ im Allgemeinen dienen. Dazu wird sich im Folgenden hauptsächlich auf Ausführungen des Historischen Wörterbuches der Philosophie bezogen.
In der Antike wurde das Wort „Tugend“ in der Philosophie zur Übersetzung des griechischen Wortes „Arete“ benutzt. Diese Übersetzung ist zwar häufig als irreführend bezeichnet worden, hat sich aber trotzdem durchgesetzt. Die Bedeutung von „Arete“ ist bei den Griechen so zu verstehen, dass ein Mensch, der „Arete“ besitzt, gut ist. „Gutsein“ ist demnach die exakte Übersetzung von „Arete“. Doch der Tugendbegriff hat sich weit etabliert und meint somit nichts anderes. Es stellt sich jedoch die Frage, was einen guten Menschen ausmacht. Dessen Eigenschaften zu definieren ist nicht ganz unstrittig. Es gibt mehrere Ansichten, was einen Menschen zu einem guten Menschen macht. Beispielsweise mache seine Moralität ihn aus. Tugend scheint für ein moralisches Verständnis sehr anfällig zu sein, immer wieder tauchen Übersetzungen auf, die im Sinne von Moralität und Sittlichkeit verstanden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Tugendbegriff im Allgemeinen
- Tugenden bei Aristoteles
- Verstandestugenden
- Sittliche/ Ethische Tugenden
- Die Bedeutung der „Mitte“ bei Aristoteles
- Der Habitus
- Lust und Unlust
- Die Tugend bei Thomas von Aquin
- Zur Rezeption der aristotelischen Tugendlehre bei Thomas von Aquin
- Schlusskommentar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Tugendbegriff bei Aristoteles und dessen Rezeption bei Thomas von Aquin. Ziel der Arbeit ist es, das Verständnis von Tugend bei beiden Denkern zu beleuchten und die Rezeption des aristotelischen Tugendbegriffs in der christlichen Philosophie zu analysieren.
- Der Tugendbegriff im Allgemeinen und seine Entwicklung in der Antike
- Aristoteles' Einteilung von Tugenden in Verstandestugenden und sittliche Tugenden
- Das Konzept der „Mitte“ als grundlegendes Prinzip in Aristoteles' Tugendlehre
- Thomas von Aquins Übernahme und Weiterentwicklung der aristotelischen Tugendlehre
- Der Einfluss des christlichen Gedankens auf die Interpretation von Tugend bei Thomas von Aquin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt zunächst in den Tugendbegriff im Allgemeinen ein und beleuchtet dessen Bedeutung in der antiken Philosophie. Hierbei wird insbesondere auf die verschiedenen Interpretationen des Begriffs „Arete“ eingegangen, der als Grundlage für den späteren Tugendbegriff dient.
Im zweiten Kapitel wird die aristotelische Tugendlehre präsentiert. Es werden die beiden Arten von Tugenden, die Verstandestugenden und die sittlichen Tugenden, unterschieden und die Bedeutung der „Mitte“ als Grundprinzip für die Entwicklung moralischer Tugenden dargestellt.
Im Anschluss daran wird das Konzept des „Habitus“ bei Aristoteles behandelt. Der Habitus ist ein erworbener Charakterzug, der durch die wiederholte Ausführung von Handlungen entsteht und letztendlich das Handeln des Menschen bestimmt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Tugendlehre des Thomas von Aquin und stellt die Rezeption der aristotelischen Tugendlehre in der christlichen Philosophie dar. Thomas übernimmt die aristotelische Tugendlehre, interpretiert sie jedoch im Lichte des christlichen Glaubens.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit fokussiert auf den Begriff der Tugend und seine Rezeption in der Philosophie. Wichtige Schlüsselwörter sind: „Arete“, Tugend, Verstandestugenden, Sittliche Tugenden, „Mitte“, Habitus, Thomas von Aquin, Rezeption, christliche Philosophie.
- Quote paper
- Martina Marmann (Author), 2008, Der Tugendbegriff von Aristoteles und seine Rezeption bei Thomas von Aquin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94145