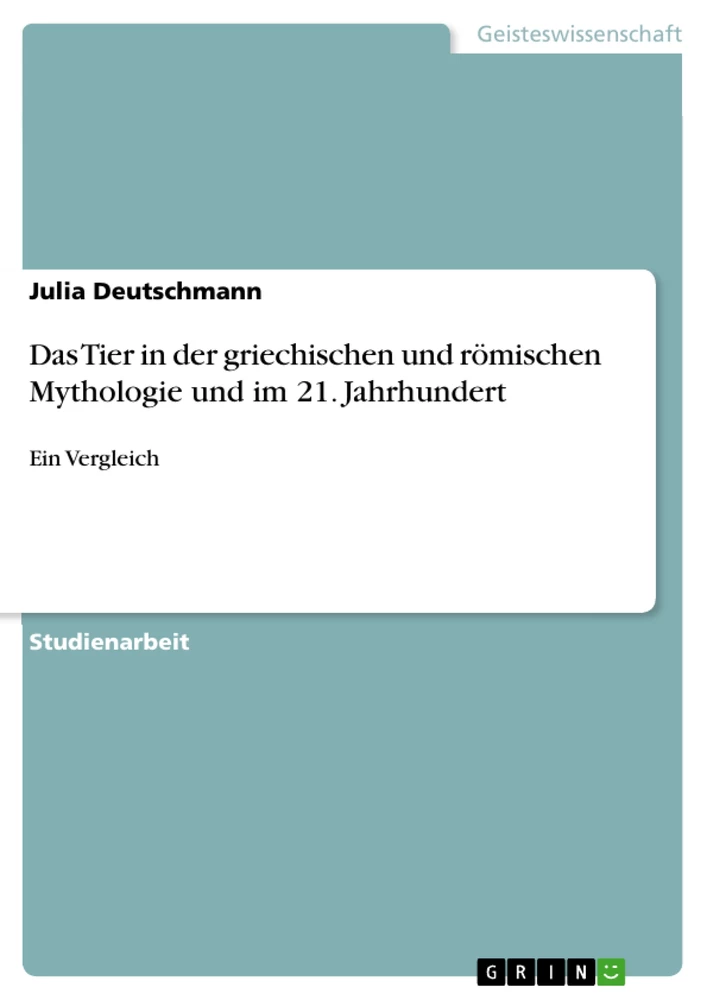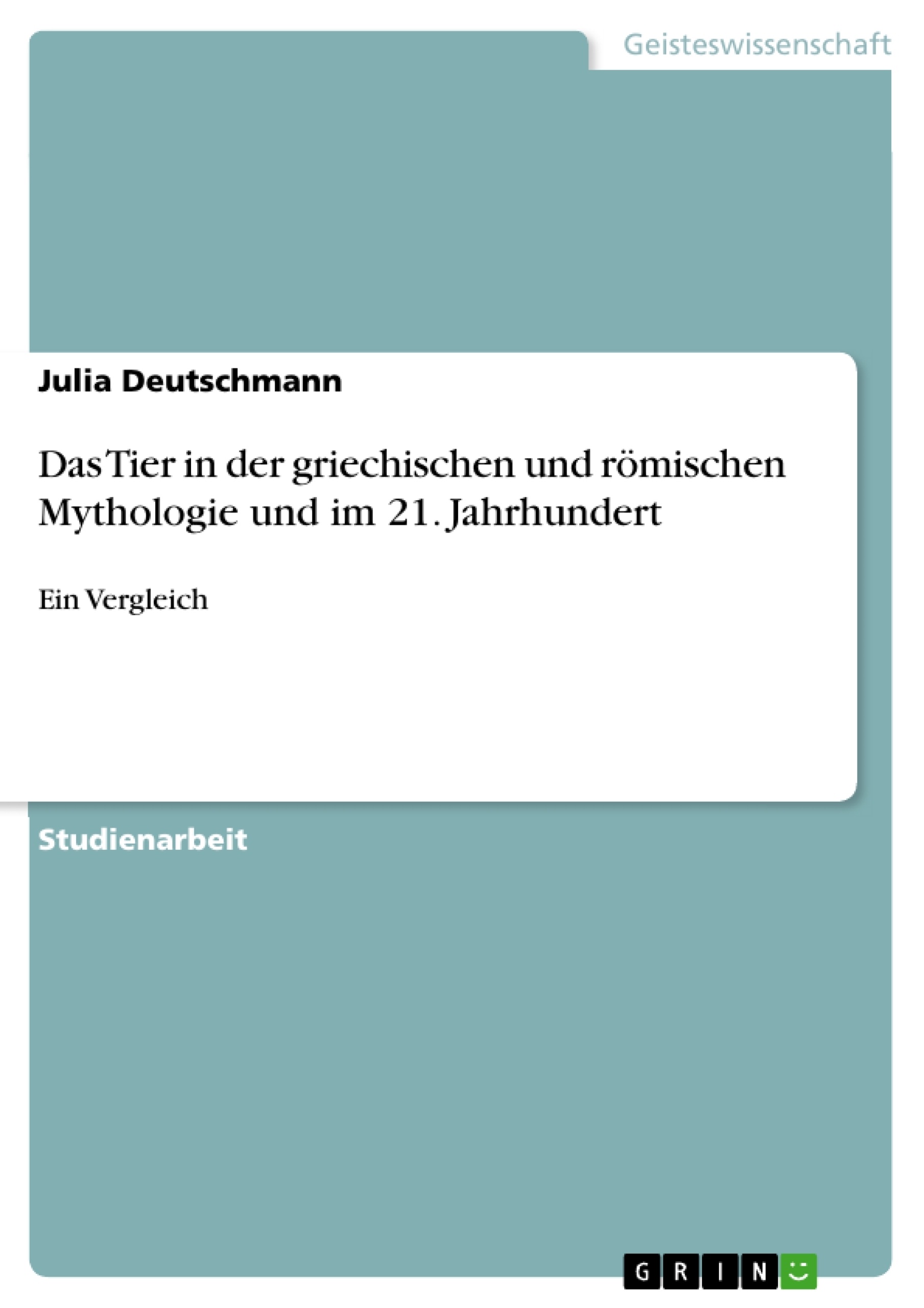In dieser Arbeit soll die Frage behandelt werden, ob mit jenem Übergang vom Mythos zum Logos, auch der Übergang von der Natur zur Kultur gezeigt werden kann. Wenn ja, wo liegt diese Schnittstelle, in der der Mensch begann diese strickte Grenze zwischen ihm und der Natur, und folglich auch zwischen ihm und dem Tier zu ziehen? Wie kann es sein, dass die westliche Kultur, mit besonderem Augenmerk auf die griechisch-römische Mythologie keinerlei Probleme hatte, sich als Teil der Natur, also des Tieres zu sehen, und heute, in der Moderne, das Tier als etwas unter sich Stehendes sieht? Kann man also tatsächlich davon sprechen, dass der Übergang vom Mythos zum Logos ebenfalls jener markante Übergang von der Natur zur Kultur ist? Ist es jener Übergang, an dem sich der Mensch begann immer mehr und mehr von der Natur zu distanzieren? Und wenn ja, warum?
Um diese Thematik zu beantworten, werden ausgewählte Literatur aber auch separiert angeführte, Überlegungen und Beobachtungen einbezogen. Im ersten Teil der Arbeit werden das Augenmerk auf Fachliteratur und der Sammlung einiger ausgewählter Mythen, mythologischen Gestalten und Gott-Mensch-Tier Beziehungen, wie etwa Athena und die mit ihrer Weisheit assoziierte Eule liegen, um anschließend im zweiten Teil der Arbeit diese mit Überlegungen fortzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1) Warum der Mythos?
- 2) Augenmerk auf einige Mythen der Antike
- 2.1) Die Metamorphosen des Zeus
- 2.2) Das Rätsel und die Macht der Sphinx
- 2.3) Die Geburt des Pegasus
- 2.4) Die Sirenen: Mischwesen aus Mensch und Vogel
- 2.5) Athena und der Steinkauz
- 2.6) Harpyien – menschliche Greifvögel
- 2.7) Der Widder als Retter
- 3) Zwischen Natur und Kultur
- 4) Die Grenze zwischen Homo et Animalis
- 5) Je größer des Logos, desto kleiner der Mythos ?
- 6) Vergleich zwischen der Antike und Heute
- 7) Eigene Gedankengänge zu den behandelten Mythen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Beziehung zwischen Mensch und Tier in der griechisch-römischen Mythologie im Vergleich zur Moderne. Die Arbeit fragt nach dem Wandel im Verhältnis von Mensch und Tier im Kontext des Übergangs vom Mythos zum Logos und der damit verbundenen Entwicklung von Natur- und Kulturverständnis.
- Die Metamorphosen der Götter und die Darstellung von Mischwesen in der Antike
- Der Übergang vom Mythos zum Logos als Bruch im Verhältnis zwischen Mensch und Natur
- Die unterschiedlichen Hierarchien zwischen Mensch und Tier in der Antike und Moderne
- Die Rolle von Mythen als Ausdruck des menschlichen Verständnisses der Welt
- Die Bedeutung der Symbolik von Tieren in mythologischen Erzählungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der unterschiedlichen Beziehungen zwischen Mensch und Tier in der Antike und Moderne ein. Sie legt die Fragestellung der Arbeit dar: Ob der Übergang vom Mythos zum Logos gleichzeitig einen Übergang von einem naturverbundenen zu einem naturentfremdeten Verhältnis zum Tier kennzeichnet. Die Autorin kündigt ihren methodischen Ansatz an, der sowohl auf Literaturrecherche als auch auf eigenen Überlegungen basiert.
1) Warum der Mythos?: Dieses Kapitel beleuchtet die Funktion von Mythen als Sinnstiftung in einer Welt, die nicht vollständig rational erfassbar ist. Es wird argumentiert, dass Mythen früher eine Erklärung für unerklärliche Phänomene lieferten und die ontologische Kluft zwischen Mensch und Göttlichem überbrückten. Im Gegensatz dazu wird der heutige, eher abwertende Gebrauch des Begriffs "Mythos" kontrastiert. Der Mythos wird als Spiegel des menschlichen Fortschritts betrachtet, wobei ungeklärte Phänomene weiterhin mythologisch interpretiert werden.
2) Augenmerk auf einige Mythen der Antike: Dieses Kapitel präsentiert eine Auswahl an Mythen, die die Beziehung zwischen Mensch und Tier in der Antike illustrieren. Die Autorin wählt Mythen aus, die für ihre These relevant sind, und kündigt an, im weiteren Verlauf der Arbeit eigene Überlegungen zu diesen Mythen anzufügen. Es wird erwähnt, dass die Auswahl nicht vollständig sein kann.
2.1) Die Metamorphosen des Zeus: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Metamorphosen des Zeus, die seine Nähe zur Natur und sein Verschwimmen mit der Tierwelt zeigen. Die Beispiele des Europa-Mythos und weiterer Geschichten unterstreichen, wie Götter sich in Tiere verwandelten, um ihre Ziele zu erreichen. Dies wird als Beleg für eine andere Art der Beziehung zwischen Mensch, Gott und Tier interpretiert.
2.2) Das Rätsel und die Macht der Sphinx: Die Erwähnung der Sphinx als Mischwesen aus Mensch und Tier unterstreicht die Akzeptanz solcher Wesen in der antiken Mythologie und ihre Bedeutung im Kontext des Verhältnisses von Mensch und Natur. Die Sphinx dient als Beispiel für die Verschmelzung der Grenzen zwischen unterschiedlichen Wesenheiten.
Schlüsselwörter
Griechisch-römische Mythologie, Mensch-Tier-Beziehung, Mythos, Logos, Natur, Kultur, Metamorphosen, Mischwesen, Zeus, Sphinx, Antike, Moderne, ontologische Kluft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Seminararbeit: Mensch und Tier in der griechisch-römischen Mythologie"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Beziehung zwischen Mensch und Tier in der griechisch-römischen Mythologie und vergleicht sie mit der modernen Sichtweise. Sie analysiert den Wandel im Verhältnis von Mensch und Tier im Kontext des Übergangs vom Mythos zum Logos und der damit verbundenen Entwicklung des Natur- und Kulturverständnisses.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Metamorphosen der Götter und die Darstellung von Mischwesen in der Antike, den Übergang vom Mythos zum Logos als Bruch im Verhältnis zwischen Mensch und Natur, die unterschiedlichen Hierarchien zwischen Mensch und Tier in der Antike und Moderne, die Rolle von Mythen als Ausdruck des menschlichen Weltverständnisses und die Bedeutung der Symbolik von Tieren in mythologischen Erzählungen.
Welche Mythen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Mythen der griechischen und römischen Antike, darunter die Metamorphosen des Zeus (z.B. der Europa-Mythos), das Rätsel der Sphinx, die Geburt des Pegasus, die Sirenen, Athena und den Steinkauz, die Harpyien und den Widder als Retter. Die Auswahl der Mythen dient der Illustration der These der Arbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Fragestellung und den methodischen Ansatz erläutert. Es folgen Kapitel, die die Funktion des Mythos, ausgewählte antike Mythen, den Übergang von Mythos zu Logos, den Vergleich zwischen Antike und Moderne und die persönlichen Gedanken der Autorin zu den behandelten Mythen beleuchten. Die Arbeit schließt mit einem Resümee.
Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Frage der Arbeit lautet, ob der Übergang vom Mythos zum Logos einen Übergang von einem naturverbundenen zu einem naturentfremdeten Verhältnis zum Tier kennzeichnet.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Autorin?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Autorin werden im Resümee der Arbeit zusammengefasst. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Beziehungen zwischen Mensch und Tier in der Antike und in der Moderne, ausgehend von der Rolle der Mythen als Sinnstiftung und der Entwicklung des menschlichen Weltverständnisses.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Griechisch-römische Mythologie, Mensch-Tier-Beziehung, Mythos, Logos, Natur, Kultur, Metamorphosen, Mischwesen, Zeus, Sphinx, Antike, Moderne, ontologische Kluft.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Punkte und Argumentationslinien zusammenfasst. Diese Zusammenfassung ist im HTML-Dokument enthalten.
- Quote paper
- Julia Deutschmann (Author), 2019, Das Tier in der griechischen und römischen Mythologie und im 21. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/940910