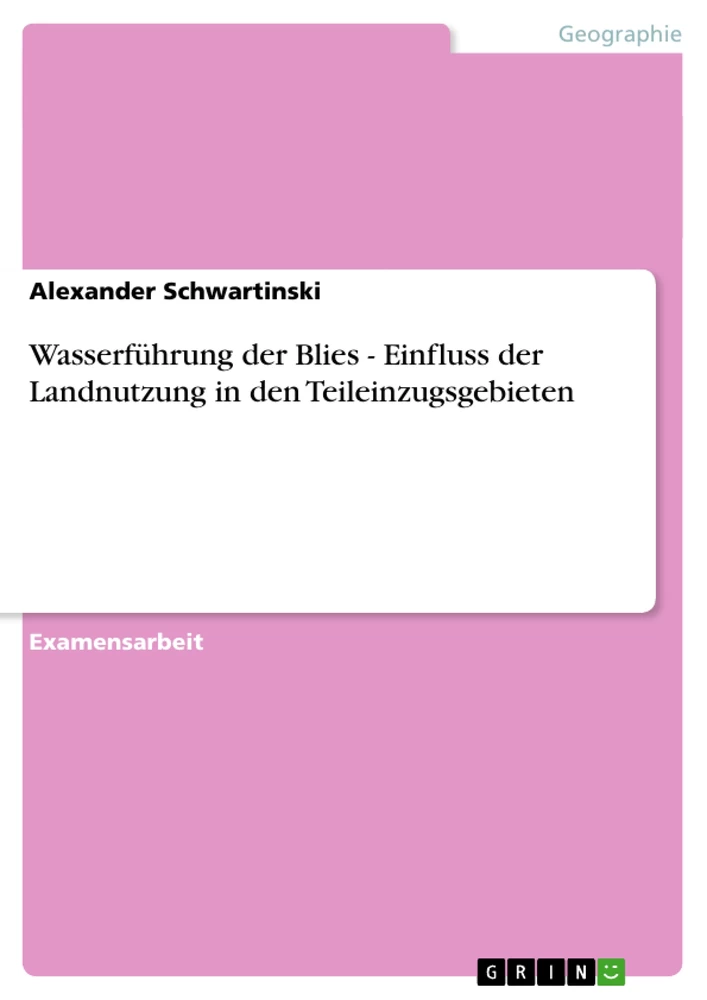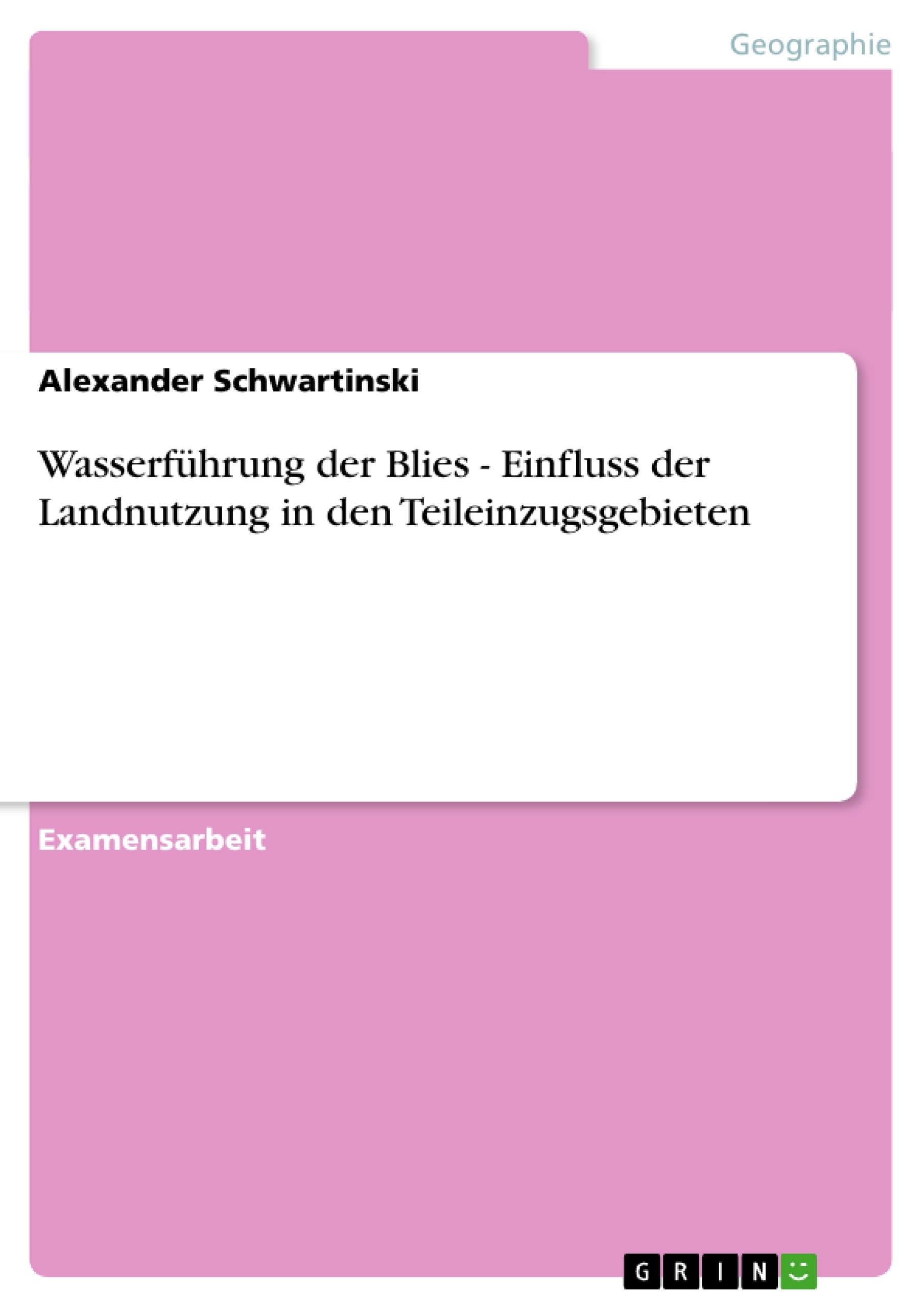Die Arbeit zeigt die Einflussfaktoren auf den Jahreszeitlichen Abflussgang eines Fließgewässers Beispiel der Blies mit ihrem Einzugsgebiet im Osten des Saarlandes und in der Südwestpfalz.
Wirft man einen Blick auf eine Gewässerkarte der Bundesrepublik Deutschland oder eines beliebigen Bundeslandes so stellt man fest, dass die Flüsse und Bäche unser Land wie Adern und Venen den menschlichen Körper durchziehen. Die Fließgewässer sind auch in ihrer Bedeutung als „Lebensadern“ den Blutgefässen gleichzusetzen.
Die hohe Bevölkerungsdichte des Saarlandes ist vor allem auf die starke Besiedlung der Flusstäler zurück zu führen.
Die starken deutschen Wirtschaftsregionen bezeichnen sich gerne nach den Flüssen an denen sie liegen, das Ruhrgebiet, die Metropolregion Rhein-Neckar und das Rhein-Main Gebiet. Die Bundeshauptstadt Berlin, der ein großer schiffbarer Fluss fehlt, ist durch den Bau von Kanälen an das europäische Binnenschifffahrtsnetz und an die Küste angeschlossen (Institut für Landeskunde 2001, S. 35). Die deutschen Flüsse wurden lange nur noch in ihrer Bedeutung als Wasserstraße wahrgenommen. Die Wasserführung ist durch Stauseen (z. B. Edersee für die Weser) und Sperrwerke reguliert und entspricht kaum noch dem natürlichen Gang. Sowohl die „Sandoz Katastrophe“ am Rhein als auch die gehäufte Anzahl an Hochwasser in den 1990 Jahren, 1993 und 1995 an Rhein und Mosel sowie 1997 an der Oder, führten den Menschen wieder die ursprünglichen Aufgaben der Flüsse, nämlich Lebensraum und Wassertransport, vor Augen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Untersuchungsgebiet
- 2.1 Die Blies
- 2.2 Saar-Nahe-Bergland: Naturräumliche Haupteinheit 19
- 2.2.1 Prims-Blies-Hügelland
- 2.2.1.1 Geologie
- 2.2.1.2 Relief
- 2.2.1.3 Böden
- 2.2.1.4 Vegetation und Landnutzung
- 2.2.1.5 Klima
- 2.2.2 Saarkohlenwald
- 2.2.2.1 Geologie
- 2.2.2.2 Relief
- 2.2.2.3 Böden
- 2.2.2.4 Vegetation und Landnutzung
- 2.2.2.5 Klima
- 2.2.3 St. Ingbert-Kaiserslauterer Senke
- 2.2.1 Prims-Blies-Hügelland
- 2.3 Pfälzerwald: Naturräumliche Haupteinheit 17
- 2.3.1 Geologie
- 2.3.2 Relief
- 2.3.3 Böden
- 2.3.4 Vegetation und Landnutzung
- 2.3.5 Klima
- 2.4 Pfälzisch-Saarländisches Muschelkalkgebiet: Naturräumliche Haupteinheit 18
- 2.4.1 Westricher Hochfläche
- 2.4.1.1 Geologie und Morphologie des Westrichs
- 2.4.1.2 Relief
- 2.4.1.3 Böden
- 2.4.1.4 Vegetation und Landnutzung
- 2.4.1.5 Klima
- 2.4.2 Bliesgau
- 2.4.2.1 Geologie
- 2.4.2.2 Relief
- 2.4.2.3 Böden
- 2.4.2.4 Vegetation
- 2.4.2.5 Klima
- 2.4.1 Westricher Hochfläche
- 2.5 Zusammenfassung
- 3. Ablaufverhalten der Blies: Unterschiede in den Teileinzugsgebieten
- 3.1 Bliessystem
- 3.2 Schwarzbachsystem
- 3.3 Die Blies: Ein ozeanisches Regenregime
- 3.4 Unterschiede im Abflussverhalten der Teileinzugsgebiete
- 4. Einflussgrößen auf das Abflussverhalten
- 4.1 Der Wasserkreislauf
- 4.2 Einfluss des Niederschlags auf den Abfluss
- 4.3 Einfluss der Landnutzung auf den Abfluss
- 4.4 Einfluss des Bodens auf das Abflussverhalten
- 4.5 Zusammenfassung von Kapitel 4
- 5. Das Abflussverhalten der Blies – Ein Erklärungsversuch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Erkenntnisse aus kleinräumigen Untersuchungen zur Abflussbildung auf das größere Einzugsgebiet der Blies anzuwenden und das unterschiedliche Abflussverhalten der einzelnen Teileinzugsgebiete zu deuten. Es geht nicht um die exakte Ermittlung von Abflussmengen, sondern um die Interpretation der Unterschiede.
- Verlauf und Einzugsgebiet der Blies
- Abflussverhalten der Blies und ihrer Zuflüsse
- Einfluss von Niederschlag, Landnutzung und Boden auf das Abflussverhalten
- Definition von Teileinzugsgebieten anhand des Abflussverhaltens
- Zuordnung der Teileinzugsgebiete zu Naturräumen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wasserführung von Flüssen ein und betont deren Bedeutung als Teil des Wasserkreislaufs. Sie beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, Erkenntnisse über die Abflussbildung aus kleineren Einzugsgebieten auf das größere Einzugsgebiet der Blies anzuwenden, um dessen unterschiedliches Abflussverhalten in den einzelnen Teilen zu deuten. Die Arbeit definiert den Begriff "Teileinzugsgebiet" und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel.
2. Untersuchungsgebiet: Dieses Kapitel beschreibt den Verlauf der Blies und ihrer Zuflüsse, wobei die durchflossenen Naturräume und Pegelstandorte genannt werden. Es bietet eine detaillierte geographische Darstellung der einzelnen Naturräume (Pfälzerwald, Saar-Nahe-Bergland, Pfälzisch-Saarländisches Muschelkalkgebiet), inklusive ihrer geologischen, geomorphologischen, bodenkundlichen, vegetationskundlichen und klimatischen Eigenschaften. Der Fokus liegt auf der starken Differenzierung des Blies-Einzugsgebietes.
3. Ablaufverhalten der Blies: Unterschiede in den Teileinzugsgebieten: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert die Abflussganglinien an 19 Pegelstationen im Blies-System und dem Schwarzbachsystem. Es beschreibt die Lage der Pegel, ordnet sie den Naturräumen zu, und analysiert die mittleren jährlichen und jahreszeitlichen Abflüsse sowie Extremwerte (Hoch- und Niedrigwasser). Das Kapitel ordnet die Blies einem ozeanischen Regenregime zu und untersucht regionale Unterschiede im Abflussverhalten der Teileinzugsgebiete anhand von Schwankungskoeffizienten, Abflussverhältnissen zwischen stärksten und schwächsten Monaten, und dem Anteil des Sommerabflusses am Gesamtabfluss.
4. Einflussgrößen auf das Abflussverhalten: Dieses Kapitel erörtert die komplexen Einflussfaktoren auf das Abflussverhalten, beginnend mit der Geschichte der Hydrologie und dem modernen Verständnis des Wasserkreislaufs. Es analysiert den Einfluss von Niederschlag (Höhe, Art, Intensität, Dauer, Verteilung) und Landnutzung (Interzeption, Verdunstung) und Boden (Infiltration, Wasserleitfähigkeit). Es werden detaillierte Erklärungen und Beispiele zu den einzelnen Einflussfaktoren gegeben, sowie die Ergebnisse von relevanten Studien vorgestellt.
Schlüsselwörter
Wasserführung, Blies, Teileinzugsgebiet, Abflussverhalten, Niederschlag, Landnutzung, Boden, Verdunstung, Interzeption, Infiltration, Ozeanisches Regenregime, Pfälzerwald, Saar-Nahe-Bergland, Pfälzisch-Saarländisches Muschelkalkgebiet, Geologie, Geomorphologie, Bodenkunde.
Häufig gestellte Fragen zur Abflussbildung im Blies-Einzugsgebiet
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Abflussbildung im Einzugsgebiet der Blies und erklärt die Unterschiede im Abflussverhalten der einzelnen Teileinzugsgebiete. Der Fokus liegt auf der Interpretation dieser Unterschiede, nicht auf der exakten Berechnung von Abflussmengen.
Welche Bereiche umfasst das Untersuchungsgebiet?
Das Untersuchungsgebiet umfasst das Einzugsgebiet der Blies, welches sich über verschiedene Naturräume erstreckt: die Blies selbst, das Saar-Nahe-Bergland (inkl. Prims-Blies-Hügelland und Saarkohlenwald), den Pfälzerwald und das Pfälzisch-Saarländische Muschelkalkgebiet (inkl. Westricher Hochfläche und Bliesgau). Jedes dieser Gebiete wird detailliert hinsichtlich Geologie, Relief, Böden, Vegetation, Landnutzung und Klima beschrieben.
Wie wird das Abflussverhalten der Blies analysiert?
Die Analyse des Abflussverhaltens basiert auf Daten von 19 Pegelstationen im Blies- und Schwarzbachsystem. Es werden mittlere jährliche und jahreszeitliche Abflüsse, Extremwerte (Hoch- und Niedrigwasser) sowie Schwankungskoeffizienten und Abflussverhältnisse zwischen den Monaten untersucht, um regionale Unterschiede zu identifizieren. Die Blies wird als ozeanisches Regenregime klassifiziert.
Welche Faktoren beeinflussen das Abflussverhalten?
Das Abflussverhalten wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter Niederschlag (Menge, Art, Intensität, Dauer, Verteilung), Landnutzung (Interzeption, Verdunstung) und Boden (Infiltration, Wasserleitfähigkeit). Die Arbeit erläutert diese Einflüsse detailliert und bezieht relevante Studien ein.
Wie werden die Teileinzugsgebiete definiert und zugeordnet?
Die Teileinzugsgebiete werden anhand des unterschiedlichen Abflussverhaltens definiert und den beschriebenen Naturräumen zugeordnet. Dies ermöglicht es, die Unterschiede im Abflussverhalten im Kontext der geographischen und hydrologischen Eigenschaften der einzelnen Regionen zu interpretieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wasserführung, Blies, Teileinzugsgebiet, Abflussverhalten, Niederschlag, Landnutzung, Boden, Verdunstung, Interzeption, Infiltration, Ozeanisches Regenregime, Pfälzerwald, Saar-Nahe-Bergland, Pfälzisch-Saarländisches Muschelkalkgebiet, Geologie, Geomorphologie, Bodenkunde.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Untersuchungsgebiet, 3. Ablaufverhalten der Blies: Unterschiede in den Teileinzugsgebieten, 4. Einflussgrößen auf das Abflussverhalten und 5. Das Abflussverhalten der Blies – Ein Erklärungsversuch. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Erkenntnisse aus kleinräumigen Untersuchungen zur Abflussbildung auf das größere Einzugsgebiet der Blies anzuwenden und das unterschiedliche Abflussverhalten der einzelnen Teileinzugsgebiete zu interpretieren und zu erklären.
- Quote paper
- Alexander Schwartinski (Author), 2007, Wasserführung der Blies - Einfluss der Landnutzung in den Teileinzugsgebieten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94001