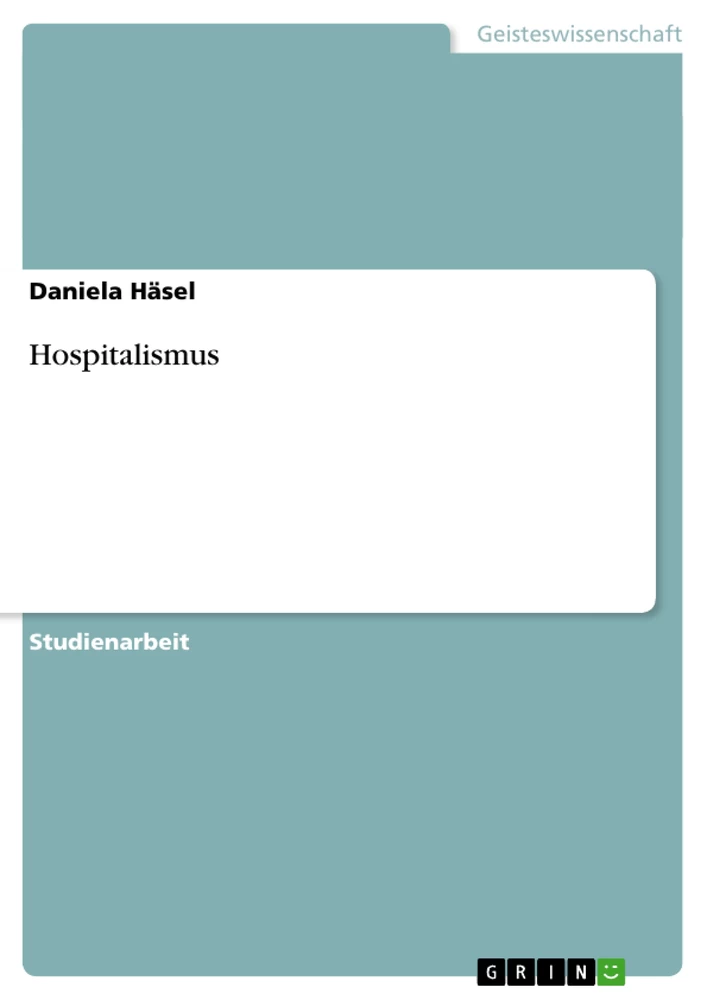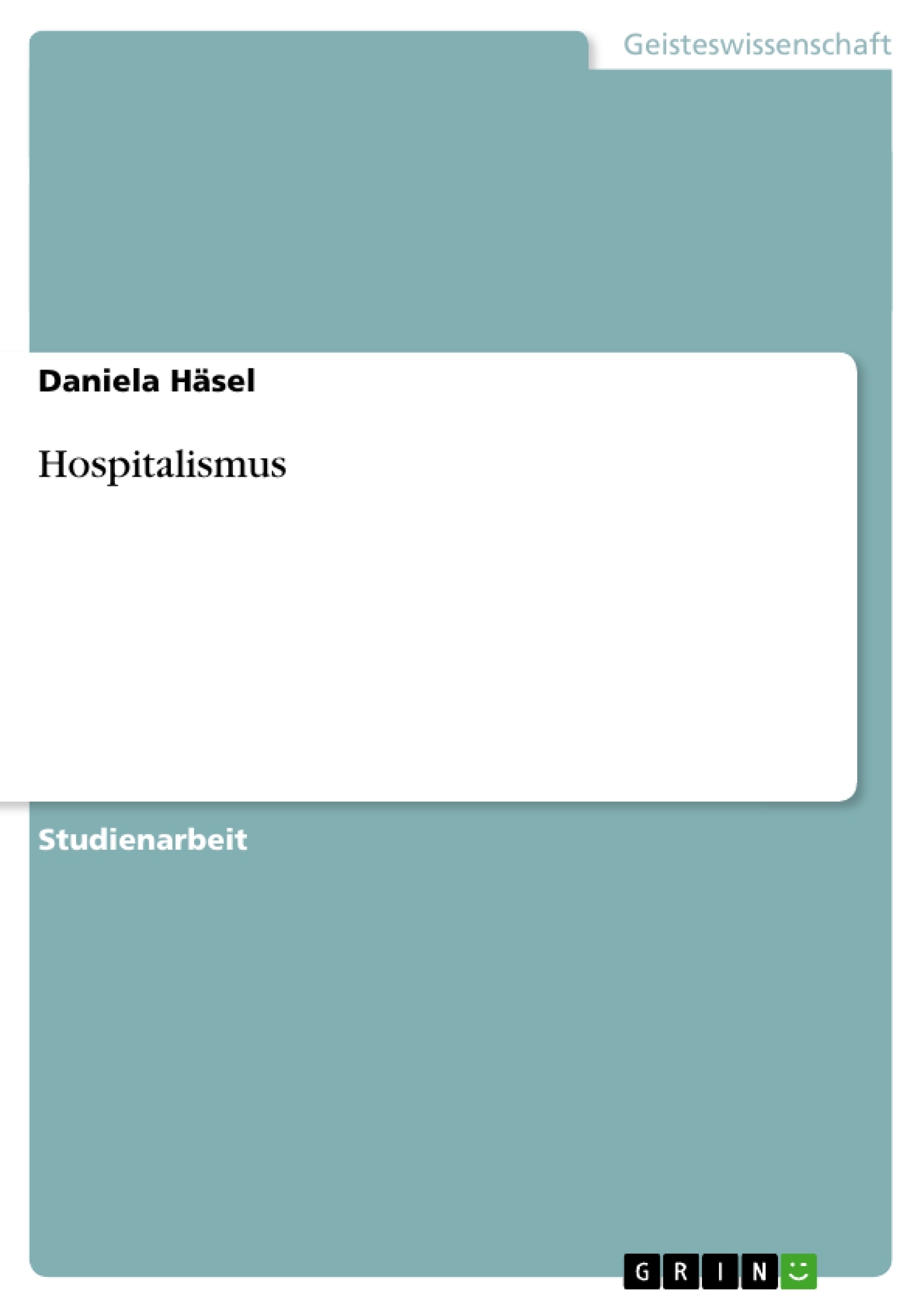1. Begriffsbestimmung
Hospitalismus ist eine zusammenfassende Bezeichnung " für alle durch bzw. während eines Krankenhausaufenthalts auftretenden Schädigungen, z.B. durch Ernährungs- oder Pflegefehler, sekundäre Infektionen oder psychischen Einwirkungen." (1)
Dabei sind zwei Formen von Hospitalismus zu unterscheiden:
(I) infektiöser Hospitalismus
Unter dem Begriff des infektiösem Hospitalismus sind alle in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen Behandlungseinrichtungen erworbene Infektionen zusammengefaßt.
(II) psychischer Hospitalismus
Bei dieser Form des Hospitalismus liegen psychische Schädigungen vor, die infolge fehlender affektiver Zuwendung auftreten.
Im weiteren Verlauf dieser Hausarbeit werde ich mich auf die spezielle Darstellung des psychischen Hospitalismus konzentrieren.
2. Psychischer Hospitalismus
"Unter Hospitalismus werden alle physischen und psychischen Symptome verstanden, die in der Regel dann auftreten, wenn Kinder in den ersten zwei Jahren ihres Lebens - bei einwandfreier Versorgung und Pflege - die dauerhafte emotionale Zuwendung einer festen Bezugsperson entbehren müssen" (2)
2.1 Ursachen des Hospitalismus
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriffsbestimmung
- (I) infektiöser Hospitalismus
- (II) psychischer Hospitalismus
- 2. Psychischer Hospitalismus
- 2.1 Ursachen des Hospitalismus
- 2.2 Hospitalismussymptome
- 2.3 Folgen des Hospitalismus
- 2.4 Gefahren der Hospitalisierung
- 2.5 Mögliche Maßnahmen zur Verhinderung des Hospitalismus
- a) „rooming in“
- b) Anpassung der Besuchszeit an die Bedürfnisse des Kindes
- c) Anpassung des Pflegesystems
- d) Vorbereitung des Kindes auf den Krankenhausaufenthalt
- 3. Problembeurteilung
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Hospitalismus, insbesondere seiner psychischen Form. Ziel ist es, die Ursachen, Symptome und Folgen des psychischen Hospitalismus zu erläutern und mögliche präventive Maßnahmen aufzuzeigen.
- Definition und Unterscheidung der Formen des Hospitalismus
- Ursachen des psychischen Hospitalismus im Kontext fehlender emotionaler Zuwendung
- Symptome des psychischen Hospitalismus bei Säuglingen und Kleinkindern
- Langfristige Folgen und Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes
- Präventive Maßnahmen zur Vermeidung des Hospitalismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel definiert Hospitalismus als die Gesamtheit aller durch einen Krankenhausaufenthalt entstehenden Schädigungen, unterteilt in infektiösen und psychischen Hospitalismus. Der Fokus liegt auf der Definition des psychischen Hospitalismus als Folge fehlender affektiver Zuwendung. Die Unterscheidung der beiden Formen legt den Grundstein für die weitere Auseinandersetzung mit dem psychischen Aspekt im Hauptteil der Arbeit.
2. Psychischer Hospitalismus: Dieses Kapitel behandelt umfassend den psychischen Hospitalismus. Es werden die Ursachen beleuchtet, die vor allem in der Abwesenheit konstanter Bezugspersonen und Reizarmut der Umgebung liegen. Die beschriebenen Symptome reichen von erhöhter Krankheitsanfälligkeit und apathischem Verhalten bis hin zu Entwicklungsstörungen. Die Diskussion der Folgen umfasst irreversible Schäden, Gefühlsarmut und soziale Beeinträchtigungen. Mögliche präventive Maßnahmen wie „Rooming-in“, angepasste Besuchszeiten und eine veränderte Pflege werden vorgestellt, um die negativen Auswirkungen zu minimieren.
Schlüsselwörter
Hospitalismus, psychischer Hospitalismus, infektiöser Hospitalismus, emotionale Zuwendung, Reizarmut, Entwicklungsstörungen, Säuglinge, Kleinkinder, präventive Maßnahmen, „Rooming-in“, Betreuung.
Häufig gestellte Fragen zum Thema Hospitalismus
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich umfassend mit dem Hospitalismus, insbesondere seiner psychischen Form. Sie definiert den Begriff, unterscheidet zwischen infektiösem und psychischem Hospitalismus, untersucht die Ursachen, Symptome und Folgen des psychischen Hospitalismus und stellt präventive Maßnahmen vor.
Was wird unter Hospitalismus verstanden?
Hospitalismus beschreibt die Gesamtheit aller durch einen Krankenhausaufenthalt entstehenden Schädigungen. Die Arbeit unterscheidet zwischen infektiösem Hospitalismus (körperliche Schädigungen) und psychischem Hospitalismus (Schädigungen durch fehlende emotionale Zuwendung).
Welche Ursachen hat psychischer Hospitalismus?
Psychischer Hospitalismus entsteht hauptsächlich durch die Abwesenheit konstanter Bezugspersonen und die Reizarmut der Krankenhausumgebung. Fehlende emotionale Zuwendung spielt eine entscheidende Rolle.
Welche Symptome zeigt psychischer Hospitalismus bei Säuglingen und Kleinkindern?
Symptome können erhöhte Krankheitsanfälligkeit, apathisches Verhalten und Entwicklungsstörungen sein. Die Arbeit beschreibt detailliert die möglichen Auswirkungen auf die körperliche und geistige Entwicklung.
Welche Folgen hat psychischer Hospitalismus?
Die Folgen können gravierend und irreversibel sein, einschließlich Gefühlsarmut, sozialen Beeinträchtigungen und nachhaltigen Entwicklungsstörungen.
Welche präventiven Maßnahmen können den psychischen Hospitalismus verhindern?
Die Arbeit schlägt verschiedene Maßnahmen vor, darunter „Rooming-in“ (Eltern bleiben beim Kind), angepasste Besuchszeiten, Anpassung des Pflegesystems und die Vorbereitung des Kindes auf den Krankenhausaufenthalt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Begriffsbestimmung (inkl. Unterscheidung der Hospitalismusformen), Psychischer Hospitalismus (Ursachen, Symptome, Folgen, präventive Maßnahmen), Problembeurteilung und Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselwörter erleichtern die Orientierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Hospitalismus, psychischer Hospitalismus, infektiöser Hospitalismus, emotionale Zuwendung, Reizarmut, Entwicklungsstörungen, Säuglinge, Kleinkinder, präventive Maßnahmen, „Rooming-in“, Betreuung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte im Gesundheitswesen, insbesondere in der Pädiatrie, sowie für Studenten der Medizin, Pflege und Pädagogik. Sie bietet ein fundiertes Verständnis des psychischen Hospitalismus und wichtige Erkenntnisse zur Prävention.
- Quote paper
- Daniela Häsel (Author), 2000, Hospitalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9400