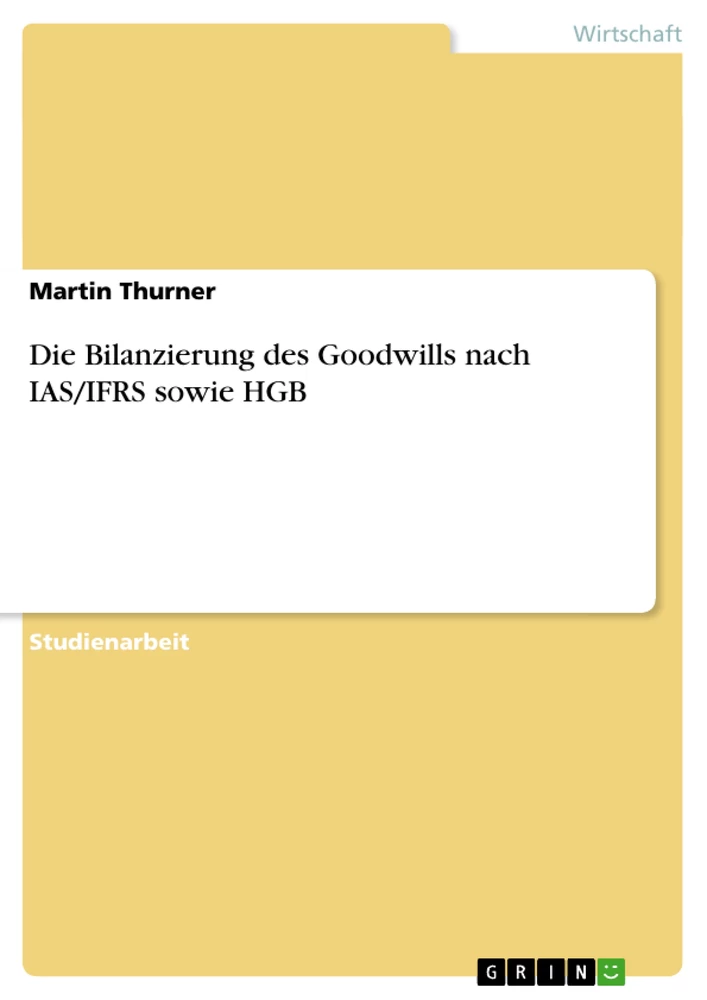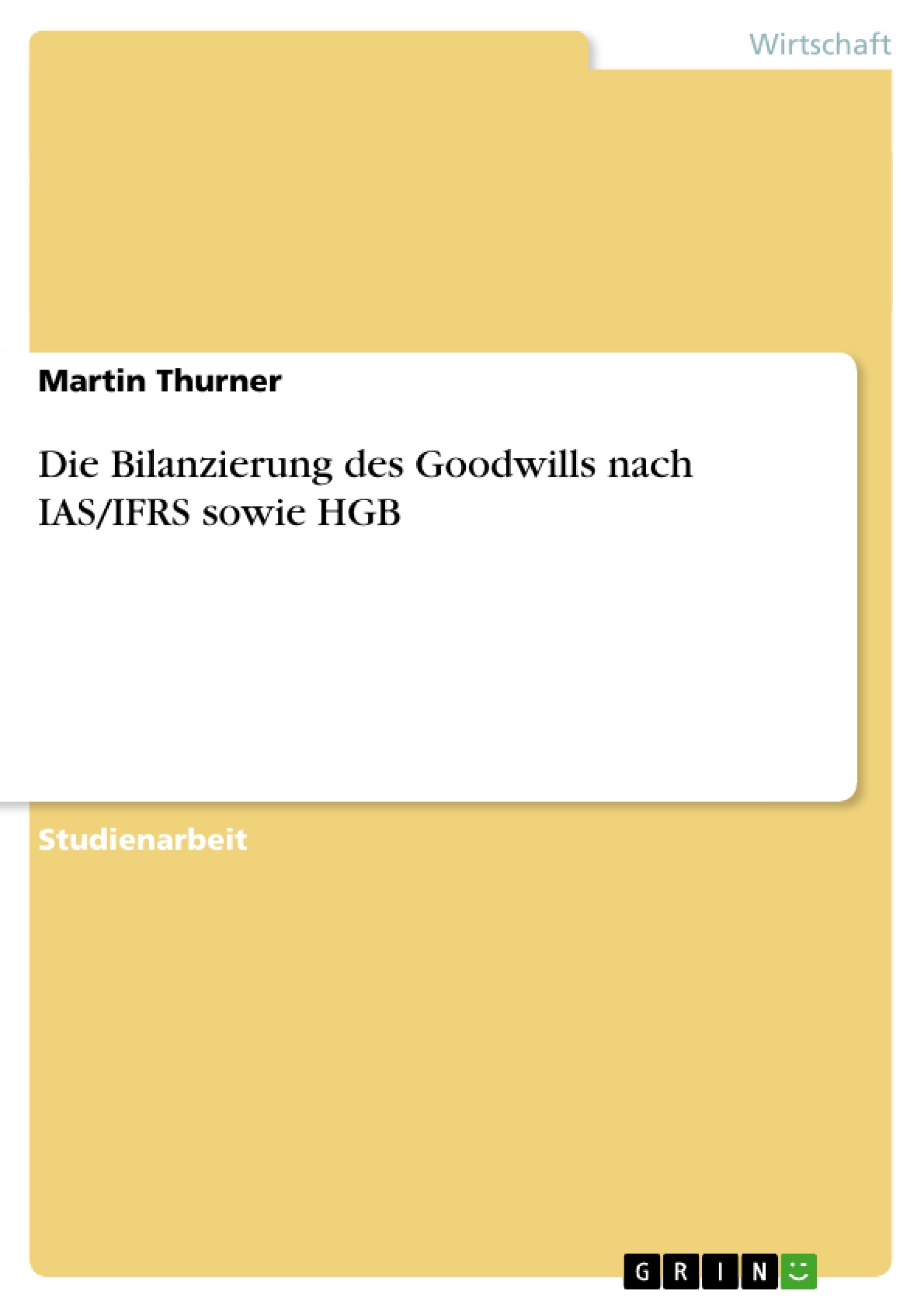Die Bewertung von „intangible assets“ (sogenanntes immaterielles Vermögen) ist ein Thema, über das sich die Fachleute in der Presse seit Jahren Gedanken machen.
Gerade im Zusammenhang mit dem 2002 von der Börse genommenen US-Konzern ENRON der mit Hilfe des Wirtschaftsprüferkonzerns Arthur Anderson jahrelang Bilanzbetrug begehen konnte, soll der „true and fair value“ Gedanke des US-GAAP, der auch die neuen IFRS-Standards prägt, stärker verwirklicht werden.
Seit damals haften auch die Konzernchefs und Finanzvorstände persönlich für die Richtigkeit der Jahresabschlüsse.
Besonders schwierig ist es bei der Bewertung von Firmenwerten bei Unternehmensübernahmen, angemessen vorzugehen.
Seit 2001 nach dem ENRON-Skandal wurde im US-GAAP die bis dato geltende „Pooling of Interest Methode“ durch die sogenannte Purchase Price Allocation und den sogenannten jährlichen Impairmenttest (Werthaltigkeitstest) abgelöst. Die Pooling of Interest Methode entsprach weitestgehend der Vorgehensweise der immer noch gültigen Bewertung nach HGB, für Unternehmen die nach IFRS bilanzieren ist der Impairment-Test mittlerweile ebenfalls vorgeschrieben.
Die in GoB und HGB zum Ausdruck kommenden Bilanzkonzeptionen sind trotzdem grundlegend, und unabdingbar für einen ausführlichen Vergleich der Goodwillbilanzierung nach (Konzern-)Rechnungslegung nach HGB und IFRS, wie er in vorliegender Arbeit vorgenommen wird.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Betriebswirtschaftliche Begriffsdefinitionen
- I. Goodwill
- 1. Originärer Goodwill
- 2. Derivativer Goodwill
- 2.1 Negativer Goodwill
- I. Goodwill
- C. Bilanzierung des Firmenwertes nach HGB
- I. Ansatz im Einzelabschluss
- 1. Wesen des Einzelabschluss
- 2. Pflicht des HGB-Einzelabschluss
- 3. Geschäft- oder Firmenwert als immaterielles Vermögen
- 4. Der Firmenwert beim Asset Deal
- 5. Rechenbeispiel
- 6. Aktivierungswahlrecht des derivativen GFW
- 7. Bilanzierungsspielraum
- 8. Ansatzverbot des originären GFW
- 9. Abschreibung des derivativen GFW
- 9.1 Pauschalabschreibung
- 9.2 Planmäßige Abschreibung
- II. Goodwill- Bilanzierung in der Konzernbilanz
- 1. Konzerneigenschaft
- 2. Aufgabe des Konzernabschluss
- 3. Kapitalkonsoliderung
- 3.1 Konsolidierungsart
- 3.2 Erwerbsmethode bei allen Formen des Anteilserwerbs
- 3.3 Konsolidierungsvorgehen (Erstkonsolidierung)
- 4. Auftreten eines Unterschiedsbetrags
- 4.1 Aktivischer Unterschiedsbetrag (positiver Firmenwert + stille Reserven)
- 4.2 Passivischer Unterschiedsbetrag (Badwill)
- 4.3 Bewertungsspielräume
- 5. Folgekonsolidierung des Goodwill
- 5.1 Pauschalabschreibung
- 5.2 Planmäßige Abschreibung
- 5.3 Verrechnung mit den offenen Rücklagen
- 6. Folgekonsolidierung des Badwill
- 6.1 Eintritt der erwarteten ungünstigen Entwicklung und andere Aufwendungen
- 6.2 Realisierter Gewinn am Abschlussstichtag
- I. Ansatz im Einzelabschluss
- C. Bilanzierung des Goodwills nach IFRS /IAS
- I. Der Goodwill im Einzelabschluss
- 1. Erstbewertung bei Erwerb
- II. Der Goodwill im Konzernabschluss
- 1. Erstkonsolidierung bei Anteilserwerb
- III. Folgebewertung/Folgekonsolidierung des Goodwills im Einzel- und Konzernabschluss
- 1. Bildung von Cash-Generating Units
- 2. Impairmenttest für den Goodwill
- IV. Der Goodwill aus IFRS/IAS aus Sicht der Unternehmenssteuerung
- I. Der Goodwill im Einzelabschluss
- D. Unterschiede zwischen Goodwillbilanzierung nach HGB und IFRS
- 1. Außerplanmäßige Abschreibung des Goodwill
- 2. Legaldefinition Firmenwert/bzw. Interpretation aus anderen Normen
- 3. Ansatz des Derivativen Firmenwertes
- 4. Planmäßige Abschreibung des Konzerngoodwill
- 5. Zuschreibungen zum Goodwill
- 7. Ansatz eines originären Geschäfts- oder Firmenwertes
- 8. Verteilung des Goodwills bei Minderheitenanteil
- 9. Ansatz des Badwill
- E. Zusammenfassung und Überblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Bilanzierung des Goodwills nach IAS/IFRS und HGB im Einzel- und Konzernabschluss. Sie analysiert die verschiedenen Ansätze und Methoden der Goodwill-Bilanzierung und beleuchtet die Unterschiede zwischen den beiden Rechnungslegungsstandards. Dabei wird insbesondere auf die Bedeutung des Impairment-Tests im IFRS-Kontext eingegangen.
- Begriffsdefinition und Arten des Goodwills (originär und derivativ)
- Bilanzierung des Goodwills nach HGB im Einzel- und Konzernabschluss
- Bilanzierung des Goodwills nach IFRS/IAS im Einzel- und Konzernabschluss
- Vergleich der Goodwillbilanzierung nach HGB und IFRS
- Relevanz des Goodwills für die Unternehmenssteuerung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel A: Einführung: Dieser Abschnitt liefert einen Überblick über die Thematik der Goodwill-Bilanzierung und stellt die Bedeutung des Themas im Kontext des Bilanzbetrugs bei ENRON und der Einführung von IFRS dar.
- Kapitel B: Betriebswirtschaftliche Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Goodwills aus betriebswirtschaftlicher Sicht, erläutert die Unterscheidung zwischen originärem und derivativen Goodwill und geht auf die Bedeutung des Goodwills für Unternehmen ein.
- Kapitel C: Bilanzierung des Firmenwertes nach HGB: In diesem Kapitel werden die Ansätze und Methoden der Goodwill-Bilanzierung nach HGB im Einzel- und Konzernabschluss detailliert dargestellt. Es wird auf die Aktivierungswahlrechte, die Abschreibungsmethoden und die Besonderheiten der Goodwill-Bilanzierung im Konzernzusammenhang eingegangen.
- Kapitel D: Bilanzierung des Goodwills nach IFRS/IAS: Dieses Kapitel behandelt die Bilanzierung des Goodwills nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS/IAS im Einzel- und Konzernabschluss. Es werden die Erstbewertung, die Folgebewertung und die Besonderheiten des Impairment-Tests im IFRS-Kontext erläutert.
- Kapitel E: Unterschiede zwischen Goodwillbilanzierung nach HGB und IFRS: Dieses Kapitel vergleicht die Goodwillbilanzierung nach HGB und IFRS und zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Standards auf. Es wird insbesondere auf die Behandlung der Abschreibung, des originären Goodwills und des Badwills eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den wichtigsten Themen und Konzepten rund um die Bilanzierung des Goodwills, wie z. B. originärer und derivativer Goodwill, Bilanzierung nach HGB und IFRS, Impairment-Test, Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibung, sowie die Bedeutung des Goodwills für die Unternehmenssteuerung.
- Quote paper
- Martin Thurner (Author), 2007, Die Bilanzierung des Goodwills nach IAS/IFRS sowie HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93977