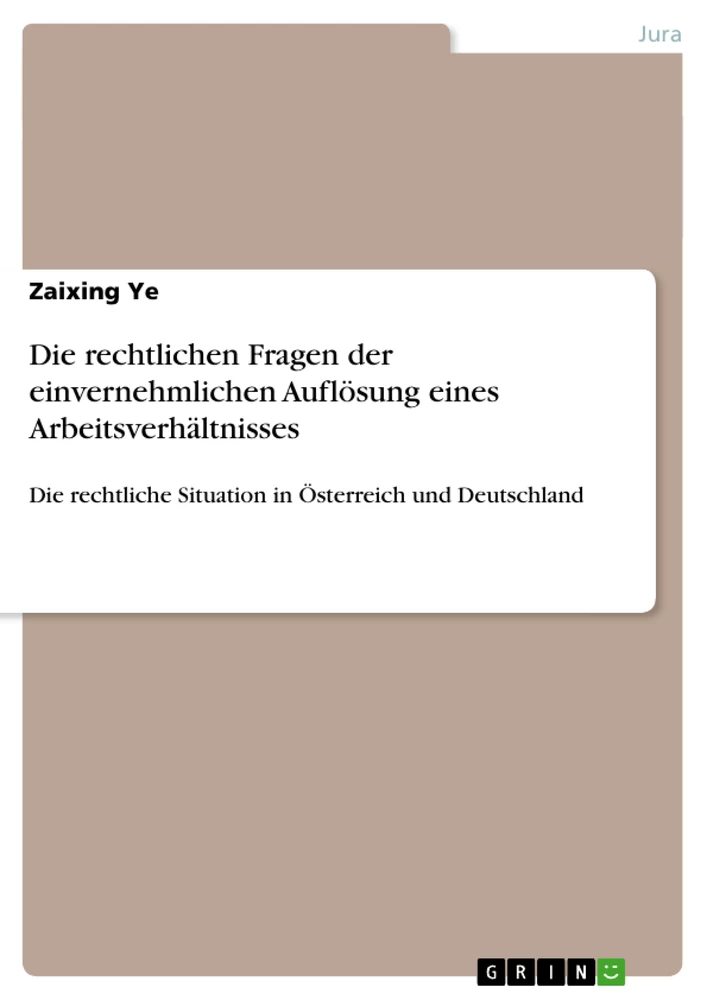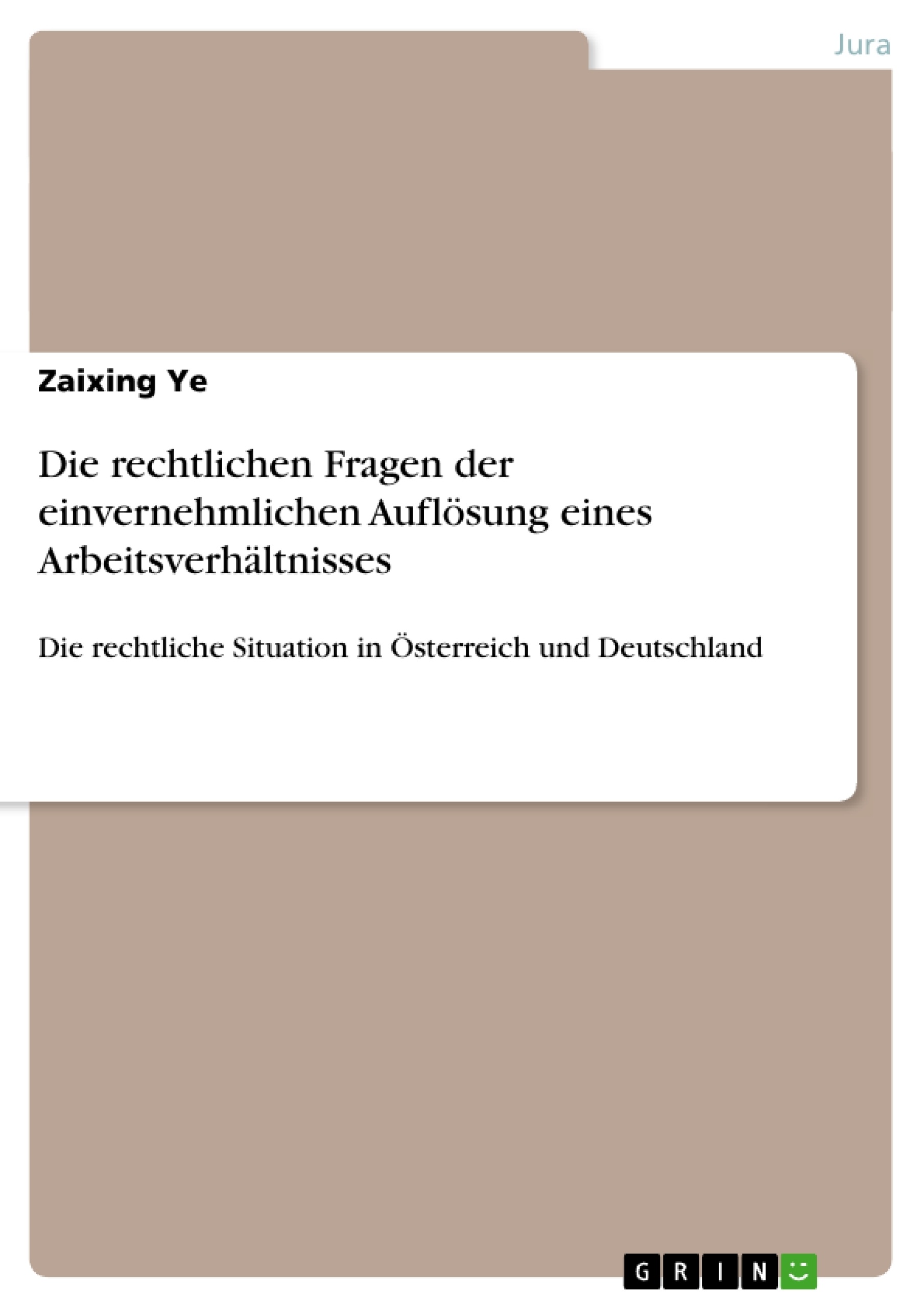In der vorliegenden Untersuchung soll die Aufmerksamkeit einem besonderen Teilbereich des Arbeitsrechtes gewidmet werden. In Zeiten, in denen die Flexibilität am Arbeitsmarkt von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist, hat auch die Notwendigkeit der flexiblen Gestaltung von Arbeitsverträgen erheblich zugenommen. Die einvernehmliche Beendigung von Arbeitsverträgen soll als das zentrale Untersuchungsobjekt dieser Arbeit behandelt werden.
Die Kündigung stellt die häufigste Form dar, ein Arbeitsverhältnis durch einseitige
Willenserklärung zu beenden. Abgesehen von den „Sonderfällen" zeitlich befristeter
Arbeitsverhältnisse oder der gesetzlichen Terminierung des Vertrages, beschränken sich die
einseitigen Auflösungsmöglichkeiten auf die Kündigung, bzw. den Austritt oder die
Entlassung aufgrund besonderer Auflösungsgründe. Durch die Wahl einer dieser
Maßnahmen zur Vertragsbeendigung nimmt man die damit einhergehende zwingende
Anwendung der gesetzlichen Rechtsfolgen in Kauf. Sie stellen
meist Arbeitnehmerschutzvorschriften dar, die auf eine potentielle Konfliktsituation
ausgerichtet sind und deren Inanspruchnahme für den Arbeitnehmer teilweise gar nicht
sinnvoll ist.
In der einvernehmlichen Auflösung eines Arbeitsverhältnisses besteht eine weitere sehr
attraktive und verbreitete Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis zu jedem Zeitpunkt zu
beenden. Damit kann erreicht werden, dass sich die oft sehr starren Kündigungsregelungen
nicht belastend auf den Produktionsprozess oder das allgemeine Fortkommen der
Vertragsparteien auswirken
Aus der einvernehmlichen Vertragsauflösung können sich für beide Vertragsparteien
enorme Vorteile im Vergleich zu den normierten Lösungsvarianten zur einseitigen
Vertragsauflösung ergeben. Die unterschiedliche Machtverteilung der Vertragspartner kann
aber die grundsätzlich positive Seite der Vertragsautonomie zu einer benachteiligenden
Vereinbarung für den Arbeitnehmer werden lassen.
Grundsätzlich wird in der vorliegenden Arbeit die österreichische Rechtslage erörtert, ein
vergleichender Verweis auf die deutsche Rechtslage unter Hervorhebung etwaiger
Unterschiede erfolgt dann im Anschluss eines jeden Kapitels.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einführung
- A. Untersuchungsgegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- B. Rechtsgrundlage und Rechtsnatur eines arbeitsrechtlichen Auflösungsvertrages
- I. Die arbeitsrechtliche Beendigungsfreiheit als Teil der Vertragsfreiheit
- II. Abgrenzung des einvernehmlichen Auflösungsvertrages von der Kündigung
- III. Abgrenzung der einvernehmlichen Auflösung von der Verkürzung der Kündigungsfrist
- IV. Abgrenzung der einvernehmlichen Auflösung von der Aussetzungsvereinbarung
- V. Abgrenzung der einvernehmlichen Auflösung von der Karenzierung
- Kapitel 2: Gültigkeitsvoraussetzungen eines Auflösungsvertrages
- A. Formerfordernis eines einvernehmlichen Auflösungsvertrages im Arbeitsrecht
- B. Rechtsvergleichende Betrachtung mit dem deutschen Recht
- C. Sittenwidrigkeit von üblichen Nebenabreden bei einvernehmlichen Auflösungsverträgen unter Berücksichtigung der neuen Gesetzeslage
- Kapitel 3: Anfechtung eines arbeitsrechtlichen Auflösungsvertrages
- A. Allgemeine Ausführung zum Anfechtungsrecht
- B. Anfechtung wegen Erklärungsirrtum- und Geschäftsirrtums nach § 871 ABGB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtlichen Fragen der einvernehmlichen Auflösung von Arbeitsverhältnissen in Österreich und Deutschland. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Grundlagen, Gültigkeitsvoraussetzungen und möglichen Anfechtungstatbestände zu geben. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des österreichischen und deutschen Rechts.
- Rechtsgrundlagen und Rechtsnatur einvernehmlicher Auflösungsverträge
- Gültigkeitsvoraussetzungen, insbesondere Formerfordernisse und Sittenwidrigkeit
- Abgrenzung zu anderen Beendigungsformen des Arbeitsverhältnisses
- Anfechtungsmöglichkeiten aufgrund von Irrtümern
- Rechtsvergleich Österreich und Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung: Dieses einführende Kapitel legt den Untersuchungsgegenstand und die Zielsetzung der Arbeit fest. Es erläutert die Rechtsgrundlage und Rechtsnatur des arbeitsrechtlichen Auflösungsvertrages und grenzt ihn von anderen Beendigungsformen wie Kündigung, Verkürzung der Kündigungsfrist, Aussetzungsvereinbarung und Karenzierung ab. Der Fokus liegt auf der Darstellung der arbeitsrechtlichen Beendigungsfreiheit im Kontext der Vertragsfreiheit und der damit verbundenen Besonderheiten im österreichischen und deutschen Recht. Die Kapitel geben eine fundierte Basis für die vertiefte Analyse in den folgenden Kapiteln.
Kapitel 2: Gültigkeitsvoraussetzungen eines Auflösungsvertrages: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Voraussetzungen für die Gültigkeit eines einvernehmlichen Auflösungsvertrages. Es analysiert die Formerfordernisse im österreichischen Arbeitsrecht, unter Berücksichtigung von Sondergesetzen wie dem Berufsausbildungsgesetz, dem Mutterschutzgesetz, dem Väter-Karenzgesetz und dem Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz. Der Einfluss des Betriebsrates wird ebenfalls beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die rechtsvergleichende Betrachtung mit dem deutschen Recht, inklusive der Analyse von Schriftformerfordernissen und Besonderheiten bei Minderjährigen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Problematik der Gesetzesumgehung und der Sittenwidrigkeit von Nebenabreden, beispielsweise bezüglich Rückerstattung von Ausbildungskosten und Konkurrenzklauseln.
Kapitel 3: Anfechtung eines arbeitsrechtlichen Auflösungsvertrages: Das Kapitel widmet sich der Anfechtung von arbeitsrechtlichen Auflösungsverträgen. Es behandelt die allgemeinen Ausführungen zum Anfechtungsrecht und konzentriert sich auf die Anfechtung wegen Erklärungsirrtums und Geschäftsirrtums nach § 871 ABGB. Dabei werden Erklärungsirrtümer, Geschäftsirrtümer (bzw. Eigenschaftsirrtümer) und Motiv- bzw. Rechtsfolgenirrtümer im Detail analysiert. Der Vergleich der Irrtumsregeln im österreichischen und deutschen Recht rundet das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Einvernehmliche Auflösung, Arbeitsverhältnis, Arbeitsrecht, Österreich, Deutschland, Auflösungsvertrag, Gültigkeit, Formerfordernisse, Sittenwidrigkeit, Anfechtung, Irrtum, Rechtsvergleich, Beendigungsfreiheit, Vertragsfreiheit, Kündigung, Gesetzesumgehung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einvernehmliche Auflösung von Arbeitsverhältnissen in Österreich und Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der einvernehmlichen Auflösung von Arbeitsverhältnissen in Österreich und Deutschland. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen, Gültigkeitsvoraussetzungen und Anfechtungsmöglichkeiten solcher Auflösungsverträge.
Welche Rechtsgebiete werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das österreichische und deutsche Arbeitsrecht, mit einem Fokus auf den Vergleich beider Rechtssysteme. Es werden Aspekte des Vertragsrechts, insbesondere die Vertragsfreiheit und die Beendigungsfreiheit von Arbeitsverhältnissen, behandelt.
Welche Themen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert die Rechtsnatur des einvernehmlichen Auflösungsvertrages, grenzt ihn von anderen Beendigungsformen wie Kündigung, Verkürzung der Kündigungsfrist, Aussetzungsvereinbarung und Karenzierung ab und untersucht die Gültigkeitsvoraussetzungen, insbesondere Formerfordernisse und die Problematik der Sittenwidrigkeit von Nebenabreden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Anfechtung von Auflösungsverträgen aufgrund von Irrtümern (Erklärungsirrtum, Geschäftsirrtum).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 (Einführung), Kapitel 2 (Gültigkeitsvoraussetzungen eines Auflösungsvertrages) und Kapitel 3 (Anfechtung eines arbeitsrechtlichen Auflösungsvertrages). Kapitel 1 legt den Fokus auf die Rechtsgrundlagen und die Abgrenzung zu anderen Beendigungsformen. Kapitel 2 befasst sich mit Formerfordernissen, Sittenwidrigkeit von Nebenabreden und einem Rechtsvergleich mit dem deutschen Recht. Kapitel 3 behandelt die Anfechtung aufgrund von Irrtümern nach § 871 ABGB.
Welche Rechtsquellen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB), einschlägige Sondergesetze wie das Berufsausbildungsgesetz, das Mutterschutzgesetz, das Väter-Karenzgesetz und das Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz. Es wird auch das deutsche Arbeitsrecht in den Rechtsvergleich einbezogen.
Welche Rolle spielt der Rechtsvergleich zwischen Österreich und Deutschland?
Der Rechtsvergleich zwischen Österreich und Deutschland ist ein zentraler Aspekt der Arbeit. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Rechtsvorschriften und deren Anwendung werden ausführlich analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Einvernehmliche Auflösung, Arbeitsverhältnis, Arbeitsrecht, Österreich, Deutschland, Auflösungsvertrag, Gültigkeit, Formerfordernisse, Sittenwidrigkeit, Anfechtung, Irrtum, Rechtsvergleich, Beendigungsfreiheit, Vertragsfreiheit, Kündigung, Gesetzesumgehung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Jurist*innen, Studierende des Rechts, Arbeitsrechtler*innen, Personalverantwortliche und alle, die sich mit der einvernehmlichen Beendigung von Arbeitsverhältnissen in Österreich und Deutschland auseinandersetzen.
- Quote paper
- Dr. iur Zaixing Ye (Author), 2008, Die rechtlichen Fragen der einvernehmlichen Auflösung eines Arbeitsverhältnisses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93936