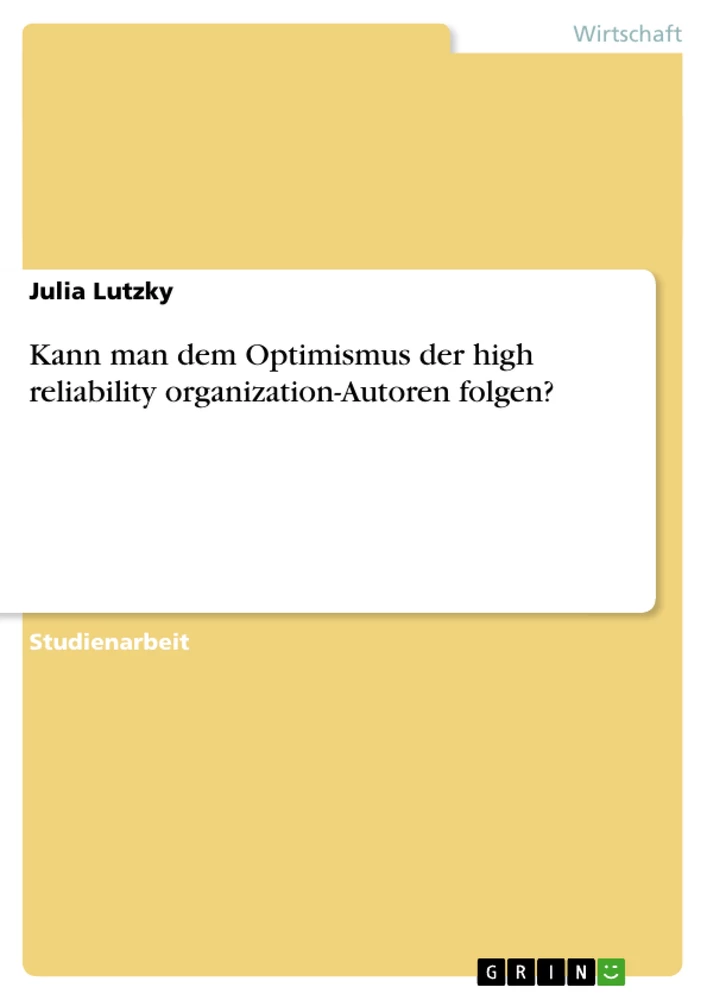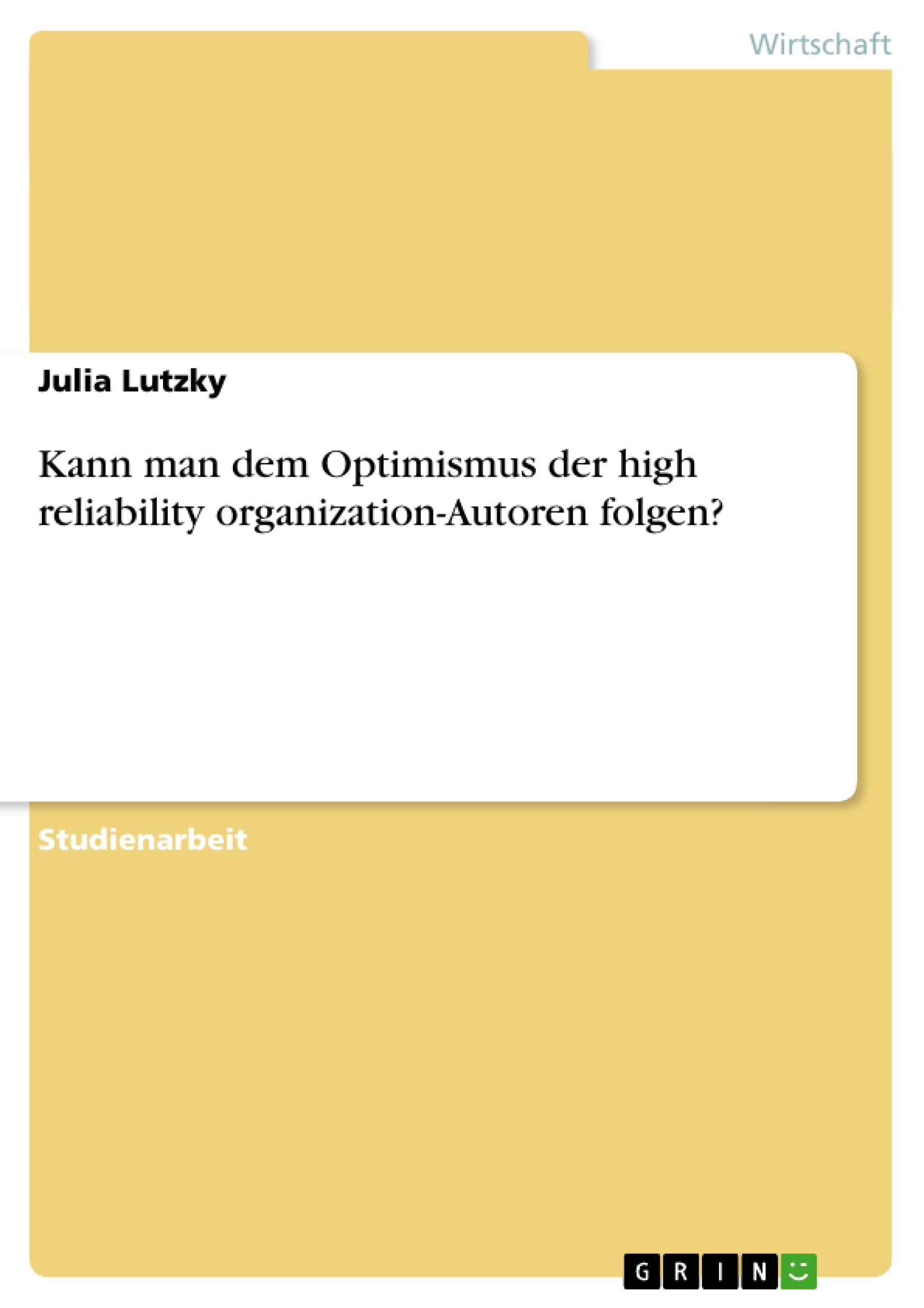1. Einleitung
Die Arbeit mancher Organisationen ist dadurch gekennzeichnet, dass sie entweder mit hoch riskanten Technologien arbeiten müssen, oder dass ihr Arbeitsumfeld äußerst gefährlich ist. Das trifft auf die Arbeit in Kernkraftwerken oder Chemiekonzernen zu, aber auch Flugsicherungsunternehmen, Flugzeugträger, Feuerwehren oder die Polizei sind besonderen Gefahren ausgesetzt. Unfälle müssen deshalb ausge-schlossen werden. Vor allem bei Kernkraftwerken oder Chemiekonzernen haben Unfälle katastrophale Folgen für Mensch und Umwelt und dennoch wird immer wie-der von Vorfällen in Atomkraftwerken oder von Tankerunglücken in den Medien berichtet. Nichtsdestotrotz scheint es Organisationen zu geben, die seit langer Zeit unfallfrei arbeiten. Diese scheinen den Sprung von „hoch riskanten“ Organisationen zu „hoch verlässlichen“ Organisationen geschafft zu haben. Trotz erschwerter Be-dingungen wie enormem Zeitdruck oder die Nutzung komplexer Technologien, fal-len sie durch ein besonders hohes Maß an Zuverlässigkeit auf, weshalb sie als high reliability organizations (HROs) bezeichnet werden. Diese besonderen Organisatio-nen sind ein zentraler Bestand und häufiger Untersuchungsgegenstand in der Krisen-forschung geworden. Aus Sicht der Vertreter der HRO-Forschung sind Unfälle durch gewisse Organisationsstrukturen, die gut gemanagt werden, vermeidbar. Die dazu durchgeführten Fallstudien bestätigen diese These. Es scheint Mechanismen zu ge-ben, die ein unfallfreies Arbeiten mit riskanten Technologien oder in einer gefährli-chen Umgebung ermöglichen. Die Liste der Merkmale ist lang und variiert je nach Organisation. Doch einige Merkmale tauchen immer wieder auf. Diese sollen im Verlauf der Arbeit dargestellt werden.
Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit der HRO-Forschung, soll die Frage geklärt werden, ob diese Merkmale Unfälle wirklich ausschließen und ob wirklich von „hoch verlässlichen“ Organisationen gesprochen werden kann bzw. ob die Ver-treter der HRO-Forschung eine zu optimistische Sicht verfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN.
- 2.1. ORGANISATION UND ZUVERLÄSSIGKEIT.
- 2.2. DIE SICHT DER NORMAL ACCIDENT THEORY
- 3. DIE OPTIMISTISCHE SICHT: HIGH-RELIABILITY THEORY
- 3.1. DIE HIGH-RELIABILITY ORGANIZATIONS.
- 3.1.1. Der Untersuchungsgegenstand der HRO-Forscher..
- 3.1.2. Antizipation von Fehlern......
- 3.1.3. Reaktion auf Unerwartetes.
- 3.2. DIE GRENZEN DER THEORIE DER HIGH-RELIABILITY ORGANIZATIONS
- 3.2.1. Der Begriff der high reliability organization und der Zuverlässigkeit ....
- 3.2.3. Sicherheit als Unternehmensziel ..
- 3.2.4. Extensiver Gebrauch von Redundanzen
- 3.2.5. Fokussierung auf Technik …..\li>
- 4. FAZIT..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die These, dass Unfälle durch bestimmte, gut gemanagte Organisationsstrukturen in hoch riskanten Arbeitsumfeldern vermeidbar sind. Die Arbeit setzt sich kritisch mit der High-Reliability Theory (HRT) auseinander, die diese These vertritt. Die Studie analysiert, ob die von der HRT beschriebenen Merkmale tatsächlich Unfälle ausschließen können und ob die Bezeichnung „hoch verlässliche“ Organisation gerechtfertigt ist.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Zuverlässigkeit“
- Analyse der Normal Accident Theory (NAT) als Gegenposition zur HRT
- Vorstellung der zentralen Merkmale von High-Reliability Organizations (HROs)
- Diskussion der Grenzen und Kritikpunkte der HRT
- Bewertung der optimistischen Sichtweise der HRT hinsichtlich der Vermeidung von Unfällen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Arbeit und die Forschungsfrage einführt. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen und klärt den Begriff der „Zuverlässigkeit“, indem verschiedene Definitionen vorgestellt und kritisch diskutiert werden. Im Anschluss wird die Normal Accident Theory (NAT) erläutert, die als Gegenposition zur HRT verstanden werden kann. Kapitel 3 widmet sich der HRT, indem es die zentralen Merkmale von HROs vorstellt und analysiert, wie diese Organisationen mit Risiken und unerwarteten Ereignissen umgehen. Schließlich werden in diesem Kapitel auch die Grenzen und Kritikpunkte der HRT diskutiert. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Ergebnisse zusammenfasst und die Forschungsfrage beantwortet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Zuverlässigkeit, Risikomanagement, High-Reliability Organizations (HROs), Normal Accident Theory (NAT), High-Reliability Theory (HRT), Unfallvermeidung und Organisationsstrukturen. Sie analysiert die Ergebnisse der HRO-Forschung und untersucht deren Grenzen und Kritikpunkte.
- Quote paper
- Julia Lutzky (Author), 2007, Kann man dem Optimismus der high reliability organization-Autoren folgen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93786