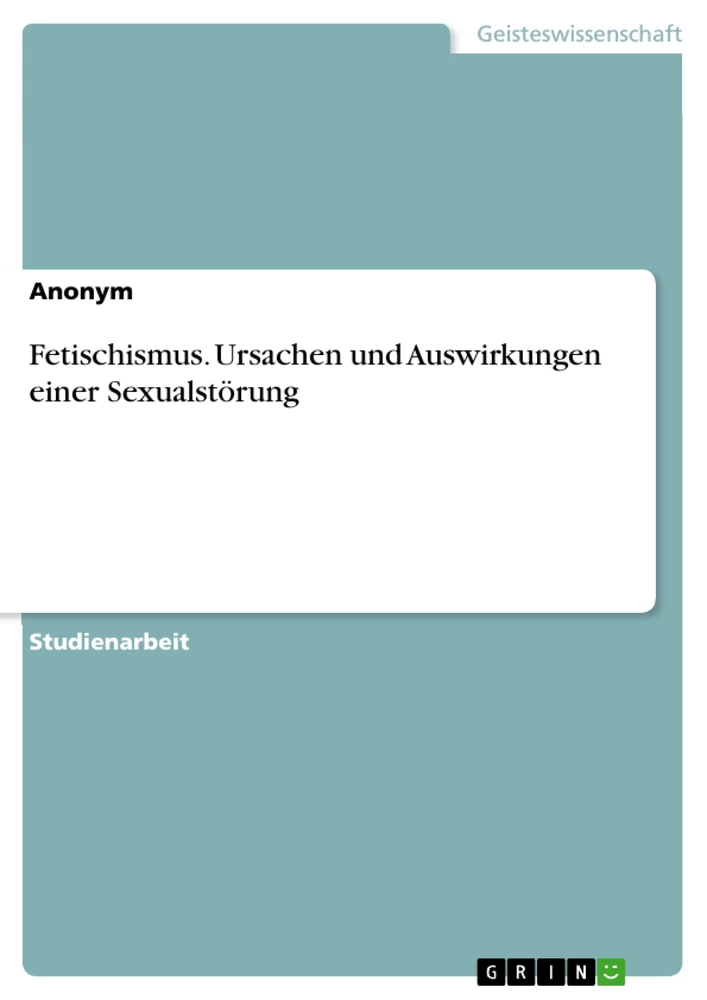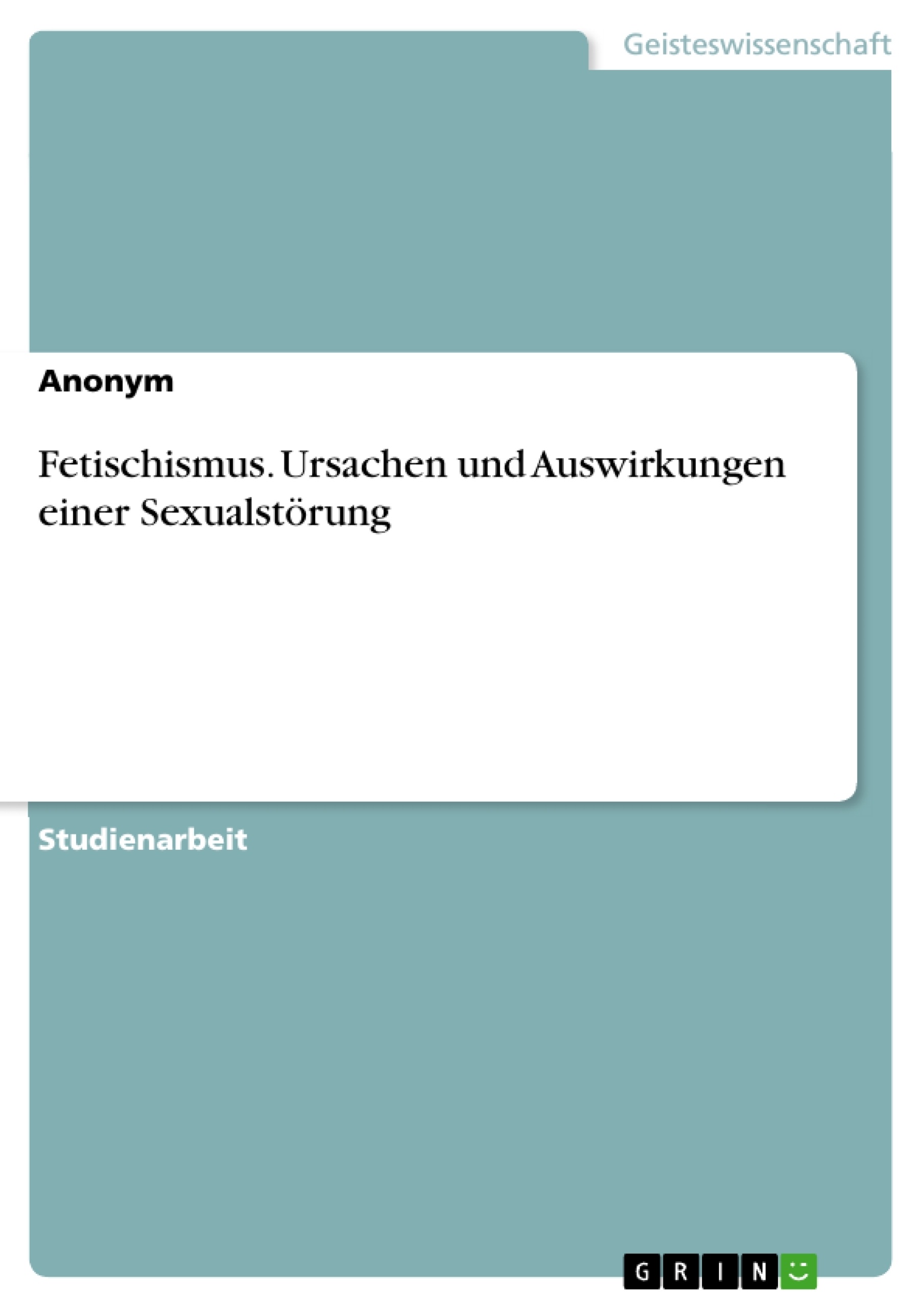Die Arbeit behandelt das Thema Fetischismus. Hierfür werden der Ursprung, Ursachen und Auswirkungen erörtert. Das ICD-10 beinhaltet in der Kategorie F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. In der Unterkategorie F65 werden Störungen der Sexualpräferenzen behandelt. F65.0 bezeichnet den Fetischismus:
Oft ist die Grenze zwischen „gesund und krank“ schwer zu ziehen, da es zwischen diesen beiden Extremen viele Abstufungen gibt. Zu einer Störung wird der Fetisch sobald er bei dem Betroffenen einen Leidensdruck erzeugt oder andere Personen aufgrund dessen Schaden nehmen können. Auch handelt es sich um eine Störung, wenn der Fetisch den Geschlechtsverkehr mit einem anderen Menschen komplett ersetzen würde. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass der Übergang von normal zu krank fließend ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Definition nach ICD-10
- 2. Definition nach DSM-IV
- 3. Ursprung des Fetisch
- 4. Sexuelle Objekte des Fetischismus
- 5. Ursachen des Fetischismus
- 6. Auswirkungen des Fetisch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Fetischismus. Ziel ist es, die Definition, den Ursprung, die Ausprägungen und mögliche Ursachen des Fetischismus zu beleuchten. Dabei werden die diagnostischen Kriterien nach ICD-10 und DSM-IV verglichen.
- Definition von Fetischismus nach ICD-10 und DSM-IV
- Ursprung und historische Entwicklung des Begriffs "Fetisch"
- Vielfalt sexueller Objekte im Fetischismus
- Mögliche Ursachen und Theorien zum Fetischismus
- Auswirkungen und Behandlungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Definition nach ICD-10: Kapitel 1 erläutert die Definition von Fetischismus gemäß ICD-10, der ihn als eine Störung der Sexualpräferenzen klassifiziert (F65.0). Es wird die Verwendung nicht-lebender Objekte zur sexuellen Erregung und Befriedigung beschrieben, wobei die Bedeutung dieser Objekte individuell variiert. Die Kapitel hebt die Schwierigkeit hervor, die Grenze zwischen "normal" und "krank" zu ziehen, da viele Abstufungen existieren und ein Fetisch erst dann als Störung gilt, wenn er Leidensdruck verursacht oder anderen schadet. Der Text betont, dass schwacher Fetischismus in Paarbeziehungen vorkommen kann, und dass eine Therapie meist nur bei signifikantem Leidensdruck notwendig ist, oftmals in Form einer Verhaltens- oder Paartherapie.
2. Definition nach DSM-IV: Im zweiten Kapitel wird der Fetischismus im DSM-IV als Paraphilie kategorisiert. Das DSM-IV definiert Paraphilien als wiederkehrende, intensive, sexuell erregende Fantasien, Bedürfnisse oder Verhaltensweisen über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten. Im Gegensatz zum ICD-10 legt das DSM-IV den Fokus auf die Beeinträchtigung des Betroffenen im sozialen oder beruflichen Bereich, weniger auf den Schaden für andere. Der Unterschied in der Betrachtungsweise zwischen ICD-10 und DSM-IV wird deutlich herausgestellt.
3. Ursprung des Fetisch: Kapitel 3 befasst sich mit der Etymologie des Wortes "Fetisch", das aus dem Lateinischen ("facere") und Portugiesischen ("feitico") stammt und ursprünglich die Verehrung lebloser Gegenstände mit magischen Kräften bei Naturvölkern beschrieb. Die Übernahme des Begriffs in die Psychologie durch Alfred Binet im 19. Jahrhundert zur Erklärung sexueller Fixierungen wird detailliert dargestellt.
4. Sexuelle Objekte des Fetischismus: Dieses Kapitel beschreibt die große Vielfalt sexueller Objekte im Fetischismus. Es werden häufige Varianten wie Fuß-, Leder- und Gummifetische genannt, aber auch die Rolle von Bekleidungsstücken, Materialien (hart/weich) und dem Zustand der Objekte (nass/trocken, sauber/dreckig). Besondere Erwähnung finden "negative" Fetische und neuere Varianten wie der "Looner"-Fetisch. Die enorme Individualität der Präferenzen wird betont.
5. Ursachen des Fetischismus: Das fünfte Kapitel beleuchtet die bis heute weitgehend unbekannten Ursachen des Fetischismus. Es werden verschiedene Theorien diskutiert, darunter genetische Faktoren, soziale Einflüsse, Konditionierung und frühkindliche Erlebnisse. Am Beispiel des Windelfetischismus wird die mögliche Rolle von Liebesentzug oder frühzeitiger Sauberkeitserziehung angedeutet. Die Vielschichtigkeit und der Mangel an eindeutigen Erklärungen werden deutlich gemacht.
Schlüsselwörter
Fetischismus, ICD-10, DSM-IV, Sexualstörungen, Paraphilien, sexuelle Präferenzen, sexuelle Objekte, Ursachen, Behandlung, Psychotherapie, Verhaltenstherapie.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Fetischismus"
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick zum Thema Fetischismus. Es beinhaltet Definitionen nach ICD-10 und DSM-IV, beschreibt den Ursprung des Begriffs, untersucht die Vielfalt sexueller Objekte, mögliche Ursachen und Auswirkungen sowie Behandlungsansätze.
Wie wird Fetischismus im ICD-10 definiert?
Das ICD-10 klassifiziert Fetischismus (F65.0) als Störung der Sexualpräferenzen, charakterisiert durch die Verwendung nicht-lebender Objekte zur sexuellen Erregung und Befriedigung. Die Grenze zwischen normalem und krankhaftem Verhalten wird als fließend beschrieben, wobei Leidensdruck oder Schädigung anderer entscheidend sind. Eine Therapie wird meist nur bei signifikantem Leidensdruck empfohlen.
Wie unterscheidet sich die Definition im DSM-IV?
Das DSM-IV kategorisiert Fetischismus als Paraphilie, definiert als wiederkehrende, intensive, sexuell erregende Fantasien, Bedürfnisse oder Verhaltensweisen über mindestens sechs Monate. Der Fokus liegt hier stärker auf der Beeinträchtigung des Betroffenen im sozialen oder beruflichen Bereich, weniger auf der Schädigung anderer. Der Unterschied zur ICD-10-Definition wird hervorgehoben.
Woher stammt der Begriff "Fetisch"?
Der Begriff "Fetisch" stammt etymologisch aus dem Lateinischen ("facere") und Portugiesischen ("feitico") und bezog sich ursprünglich auf die Verehrung lebloser Gegenstände mit magischen Kräften bei Naturvölkern. Seine Übernahme in die Psychologie durch Alfred Binet im 19. Jahrhundert zur Erklärung sexueller Fixierungen wird erläutert.
Welche Arten von sexuellen Objekten gibt es im Fetischismus?
Das Dokument beschreibt eine große Vielfalt sexueller Objekte, darunter häufige Varianten wie Fuß-, Leder- und Gummifetische, aber auch Bekleidungsstücke, Materialien (hart/weich), Zustände (nass/trocken, sauber/dreckig) und "negative" Fetische sowie neuere Varianten wie der "Looner"-Fetisch. Die enorme Individualität der Präferenzen wird betont.
Was sind die möglichen Ursachen von Fetischismus?
Die Ursachen des Fetischismus sind weitgehend unbekannt. Das Dokument diskutiert verschiedene Theorien, darunter genetische Faktoren, soziale Einflüsse, Konditionierung und frühkindliche Erlebnisse. Am Beispiel des Windelfetischismus wird die mögliche Rolle von Liebesentzug oder frühzeitiger Sauberkeitserziehung angedeutet. Die Vielschichtigkeit und der Mangel an eindeutigen Erklärungen werden hervorgehoben.
Welche Auswirkungen und Behandlungsansätze gibt es?
Die Auswirkungen von Fetischismus hängen vom Ausmaß des Leidensdrucks und der Beeinträchtigung des sozialen und beruflichen Lebens ab. Behandlungsansätze werden nur kurz erwähnt und umfassen Verhaltenstherapie und Paartherapie, primär bei signifikantem Leidensdruck.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Fetischismus, ICD-10, DSM-IV, Sexualstörungen, Paraphilien, sexuelle Präferenzen, sexuelle Objekte, Ursachen, Behandlung, Psychotherapie, Verhaltenstherapie.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Fetischismus. Ursachen und Auswirkungen einer Sexualstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937708