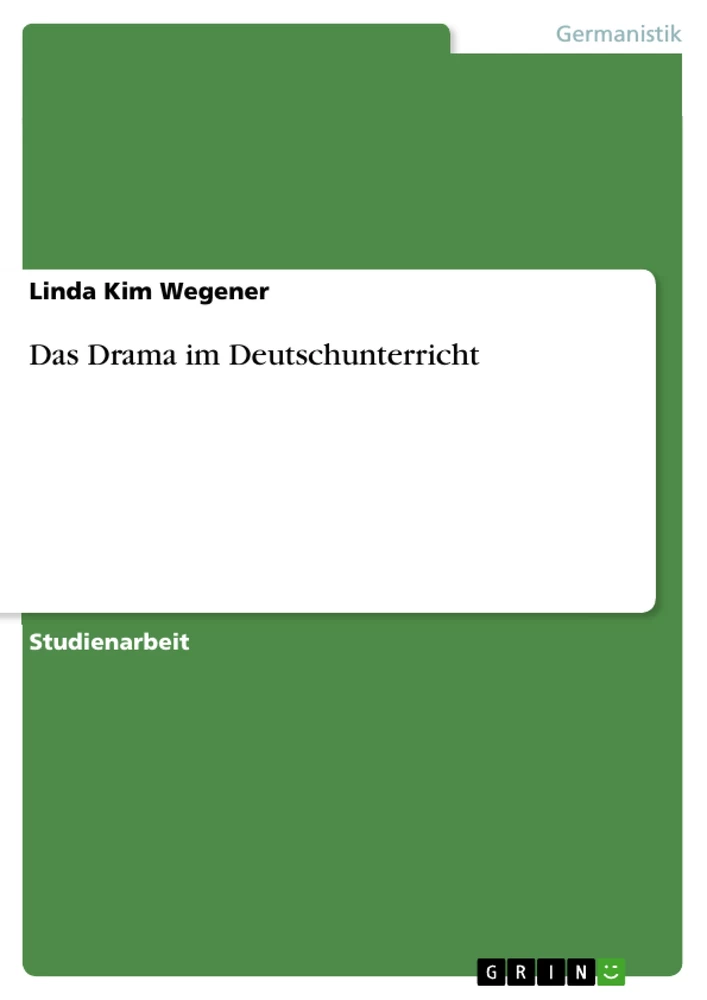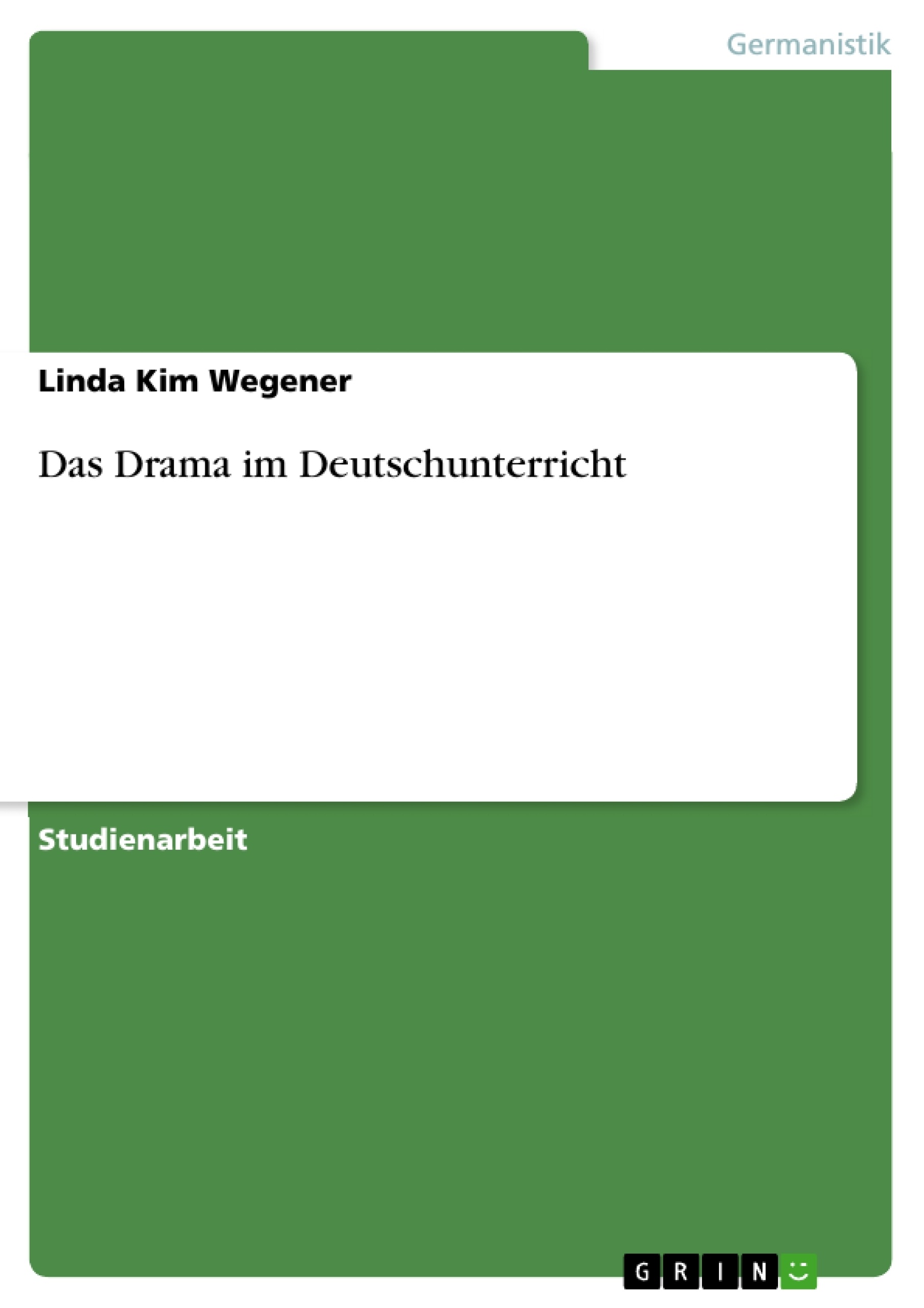Im Folgenden soll davon ausgegangen werden, dass das Drama zwar immer durch seinen geschichtlichen Hintergrund geprägt wird, dass es jedoch im Sinne des Allgemeinbegriffs als Summe seiner wesentlichen Merkmale dagegen zeitlos ist, sich demnach in den rund zweieinhalb Jahrtausenden seiner Geschichte nicht verändert hat. Bereits Aristoteles versuchte das Wesen des Dramas zu bestimmten. In seiner Poetik, der bis heute bedeutendsten Dramentheorie, nennt er sechs bestimmende Elemente für das Drama. Die Elemente beansprucht er zwar für die Tragödie, doch wenn man das sechste Element als nicht notwendig erachtet, sondern als möglich einstuft, können die Elemente auch für das Drama im allgemeinen gelten. Die sechs Bestandteile, die danach jede Tragödie aufzuweisen hat, sind: mythos (Handlung), ethe (Charaktere), lexis (Rede, Sprache), diánoia (Gedanke, Absicht), opsis (Schau, Szene) und melopoiía (Gesang, Musik). Nach Aristoteles beziehen sich die ersten beiden Elemente sowie das vierte (Handlung, Charakter und Absicht) auf das, was dargestellt wird, die restlichen auf Art bzw. Szenerie und Mittel bzw. Sprache/Gesang der Darstellung. Im Folgenden soll auf der Basis der drei wichtigsten Elemente (Handlung, Sprache und Szenerie) die Eigenart des Dramas näher bestimmt werden (wobei nach Aristoteles die Charaktere der Handlung zuzuordnen sind).
Das wichtigste im Drama ist nach Aristoteles die Handlung, er meint damit kaum mehr als den Ereigniszusammenhang, der den Inhalt des Dramas ausmacht. Im Vordergrund stehen dabei sozial-kommunikative Verhaltensäußerungen. Die Handlung ergibt sich aus einer Kette von Begebenheiten, an denen meist mehrere Personen beteiligt sind.
Die zusammenhänge Handlungsfolge unterscheidet das Drama zwar von beschreibenden Texten, die ein räumliches Nebeneinander darstellen, sowie von gedanklich-assoziativen Texten (Lyrik) jedoch nicht von der Erzählliteratur (Epik).
Aristoteles schrieb dem Epos eine dramatische Struktur zu. Zur Abgrenzung von der Epik bedarf das Drama also einer zusätzlichen Bestimmung. Diese findet sich im Bereich der Sprache bzw. Figurenrede. Handeln schließt das Reden ein, im Drama ist es die beherrschende Art des Handelns und gleichzeitig Medium außersprachlicher, wie z.B. innerer Vorgänge. Das normale Drama ist also ein Sprechdrama.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Das Drama
- Die wesentlichen Elemente des Dramas
- Handlung
- Sprache/Figurenrede
- Szenerie/szenische Darbietung
- Zur Geschichte des Dramas
- Theorie des Dramas
- Aristoteles (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
- Pierre Corneille (1606 - 1684)
- Gotthold Ephraim Lessing (1729 - 1781)
- Jakob Lenz (1751 - 1792)
- Berthold Brecht (1898-1956)
- Dramatische Formen (Auswahl)
- Analytisches Drama
- Bürgerliches Trauerspiel
- Episches Theater
- Dokumentarisches Theater
- Tragikomödie
- Geschlossene und offene Form im Drama
- Dramendidaktik
- Die Entwicklung der Dramendidaktik
- Aktuelle didaktische Ansätze
- Der gattungstheoretische Ansatz
- Der theaterpädagogische Ansatz
- Der produktionsorientierte Ansatz
- Die wesentlichen Elemente des Dramas
- Didaktische Begründung für das Drama im Deutschunterricht
- Die szenische Interpretation mit dem Drama
- Die Rolle des Lehrers beim szenischen Interpretieren
- Szenische Interpretation mit Reiner Lückers und Stefan Reisners Theaterstück Wasser im Eimer (3./4. Klasse)
- Hinweise zu Wasser im Eimer
- Mögliche Ansätze zur szenischen Interpretation
- Szenische Interpretation mit Georg Büchners Woyzeck (9./10. Klasse)
- Hinweise zu Georg Büchners Woyzeck
- Mögliche Ansätze zur szenischen Interpretation nach Ingo Scheller
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung beleuchtet die Rolle des Dramas im Deutschunterricht. Es wird die Entwicklung des Dramas als literarische Gattung, seine wesentlichen Elemente und dramatischen Formen sowie die Bedeutung des Dramas für die didaktische Praxis im Deutschunterricht beleuchtet.
- Wesentliche Elemente des Dramas
- Entwicklung des Dramas als Gattung
- Dramatische Formen und ihre Besonderheiten
- Didaktische Ansätze für den Einsatz des Dramas im Unterricht
- Praktische Beispiele für szenische Interpretationen im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Ausarbeitung beginnt mit einer Definition des Dramas und seiner zentralen Elemente: Handlung, Sprache/Figurenrede und Szenerie/szenische Darbietung. Es folgt ein Überblick über die Geschichte des Dramas von der Antike bis zum 19. Jahrhundert, wobei die Entwicklung des Dramas als Spiegel gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen beleuchtet wird.
Die Ausarbeitung stellt verschiedene Dramentheorien von Aristoteles bis Bertold Brecht vor und beleuchtet die verschiedenen dramatischen Formen wie analytisches Drama, Bürgerliches Trauerspiel, episches Theater und Tragikomödie. Der Schwerpunkt liegt auf der didaktischen Relevanz des Dramas im Deutschunterricht, wobei verschiedene didaktische Ansätze wie der gattungstheoretische, theaterpädagogische und produktionsorientierte Ansatz diskutiert werden.
Im letzten Teil der Ausarbeitung werden konkrete Beispiele für szenische Interpretationen im Unterricht vorgestellt. Dazu gehören Reiner Lückers und Stefan Reisners Theaterstück "Wasser im Eimer" (3./4. Klasse) und Georg Büchners "Woyzeck" (9./10. Klasse). Für beide Stücke werden Hinweise zur Interpretation und konkrete Ansätze zur szenischen Umsetzung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Drama, Dramenanalyse, Dramentheorie, Dramendidaktik, szenische Interpretation, Theaterpädagogik, Deutschunterricht, Handlung, Sprache, Szenerie, Figurenrede, Aristoteles, Lessing, Brecht, Bürgerliches Trauerspiel, Episches Theater, Tragikomödie, Woyzeck, Wasser im Eimer.
- Quote paper
- Linda Kim Wegener (Author), 2008, Das Drama im Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93759