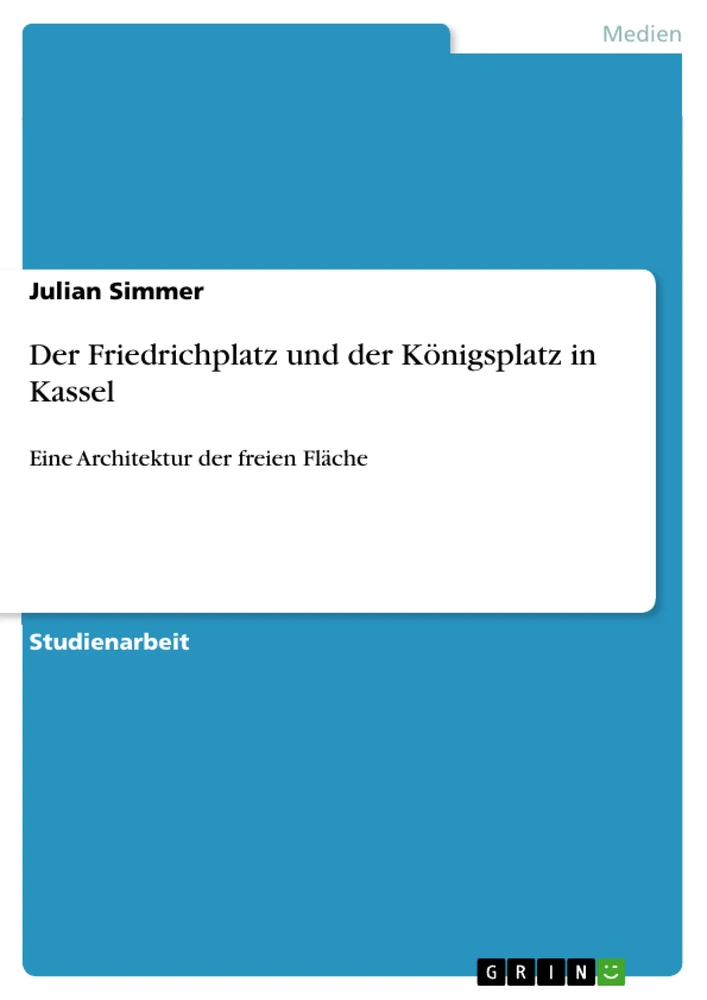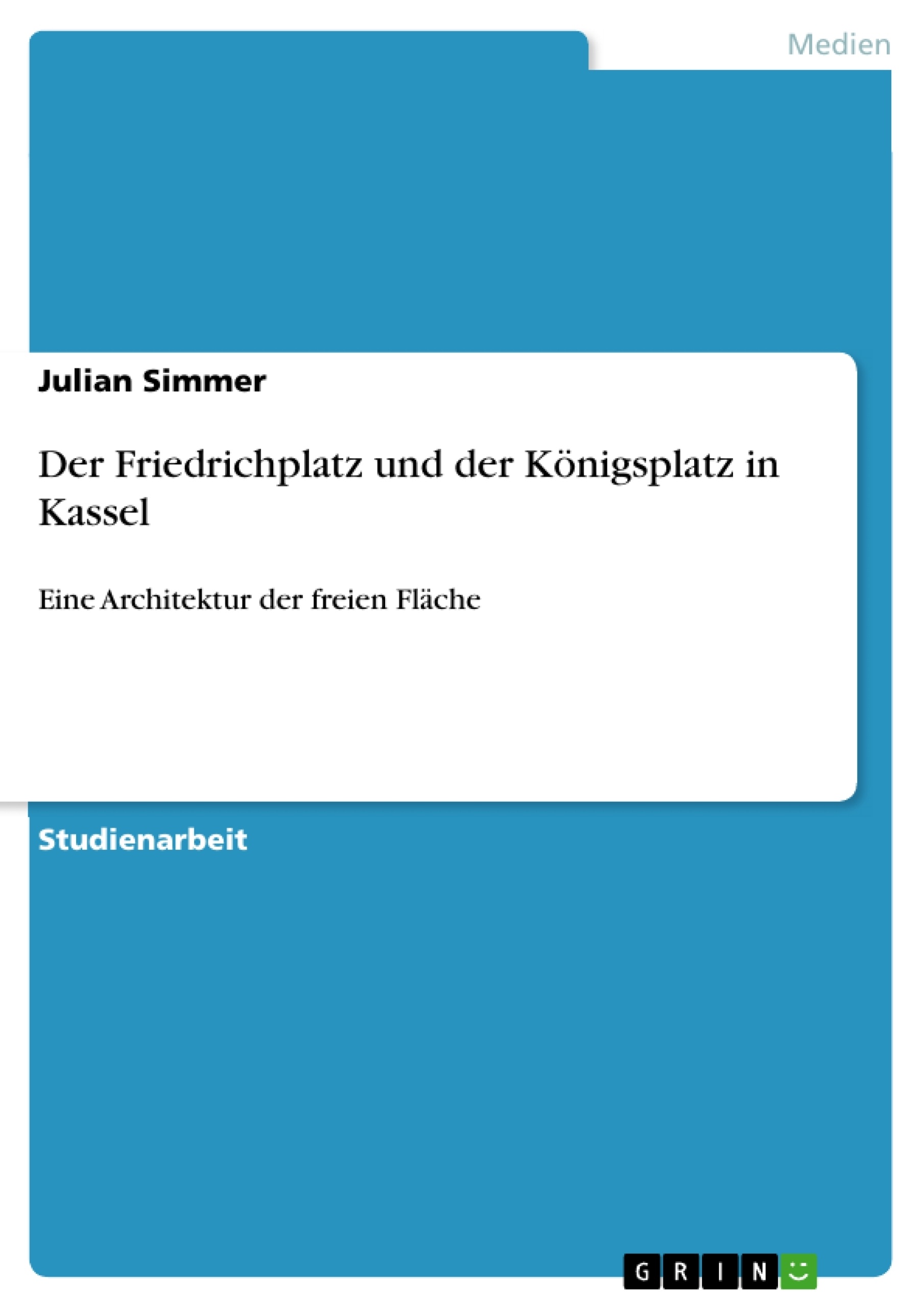War der Friedrichsplatz wirklich ein sich verselbstständigender Wegweiser in eine gesellschaftspolitisch neue Zeit, oder war er nur ein cleveres Projekt eines Landgrafen, der sich ein Platz in den Reihen der führenden europäischen Metropolen sichern wollte?
Der Königsplatz entstand 1768 als eine vom Residenzkomplex völlig unabhängige Anlage an der Nahtstelle zwischen Altstadt und Oberneustadt.
Dort befanden sich die Post, die Gewerbehalle und einige private Paläste.
Trotz seines Namens erhob er jedoch nicht mehr den Anspruch symbolische Mitte der neu vereinten Stadt zu sein, sondern fungierte eher als ein Zusammenführer der unterschiedlichen Strukturiertheitsformen von Oberneustadt und Altstadt. Die dort aufeinanderprallenden ja schon fast verschiedenen Kulturen wurden vom Königsplatz aufgefangen, ausgeglichen und abgefedert.
Der Friedrichsplatz wurde zwischen 1769 und 1783 im Auftrag von Landgraf Friedrich II. Von Hessen-Kassel(1720-1785) erbaut. Dem Friedrichsplatz in Kassel kommt, neben der Place Royale in Nancy und der etwa Zeitgleich gebauten Place Royal in Brüssel, große Bedeutung in Bezug auf den Entfesselungsprozess der Städte und die damit verbundene Neuordnung zwischen Stadt- und Landschaftsraum in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu.
Inhaltsverzeichnis
- Der Friedrichsplatz in Kassel
- Introduktion
- These
- Einführung in die Thematik
- Baubeschreibung des Museums Fridericianum
- Der Königsplatz in Kassel
- Fazit
- Quellen
- Bilder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Friedrichsplatz in Kassel und seine Bedeutung für die Stadtentwicklung im 18. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Planung und Gestaltung des Platzes im Kontext der städtebaulichen Neuordnung und untersucht, inwiefern der Friedrichsplatz als Zeichen eines gesellschaftlich-politischen Wandels interpretiert werden kann.
- Die Rolle des Friedrichsplatzes im Kontext der städtebaulichen Neuordnung in Kassel
- Der Einfluss des Klassizismus auf die Architektur des Friedrichsplatzes
- Die Bedeutung des Museum Fridericianum als Symbol für Bildung und Kultur
- Der Friedrichsplatz als Beispiel für die Verbindung von Stadt- und Landschaftsraum
- Die Rolle von Landgraf Friedrich II. in der Gestaltung des Friedrichsplatzes
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der Friedrichsplatz in Kassel
- Das Kapitel liefert eine Einleitung in die Thematik und stellt die Fragestellung der Arbeit vor.
- Es wird die Entstehung und Bedeutung des Friedrichsplatzes im Kontext der Stadtentwicklung im 18. Jahrhundert beleuchtet.
- Das Kapitel beschreibt den Friedrichsplatz als Verbindungsglied zwischen Alt- und Neustadt und zeigt seine Verbindung zu ähnlichen Plätzen in anderen europäischen Städten auf.
- Kapitel 2: Baubeschreibung des Museums Fridericianum
- Das Kapitel befasst sich mit der Architektur des Museums Fridericianum und seiner Bedeutung für den Friedrichsplatz.
- Es werden die architektonischen Besonderheiten des Gebäudes und die Rolle des Architekten Simon Louis du Ry erläutert.
- Das Kapitel hebt die Bedeutung des Museums Fridericianum als öffentlich zugängliches Museum hervor.
- Kapitel 3: Der Königsplatz in Kassel
- Das Kapitel befasst sich mit dem Königsplatz in Kassel.
- Es werden die architektonischen Besonderheiten des Platzes und seine Bedeutung für die Stadtentwicklung beschrieben.
Schlüsselwörter
Friedrichsplatz, Kassel, Stadtentwicklung, Klassizismus, Museum Fridericianum, Simon Louis du Ry, Landgraf Friedrich II., Place Royale, Place Royal, städtebauliche Neuordnung, Bildung, Kultur.
- Quote paper
- Mag. Art. Julian Simmer (Author), 2011, Der Friedrichplatz und der Königsplatz in Kassel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/936675