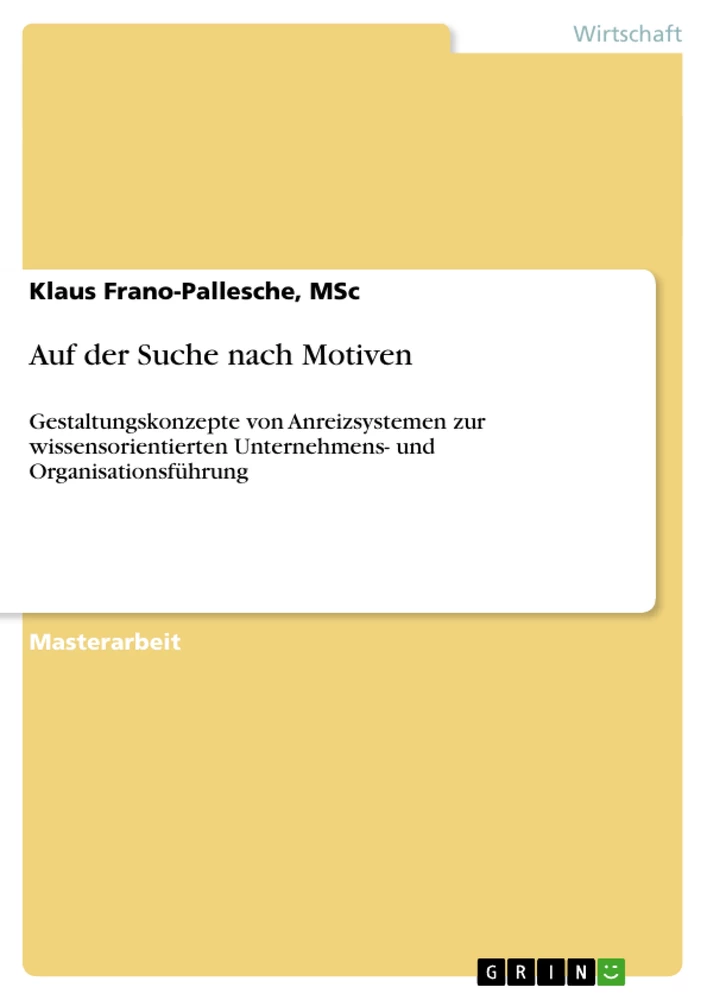The challenge of the future is coined by the use of the resource term Knowledge, which, as a deciding competitive factor, is the fourth agent of production after Land, Capital and Labor. This resourced-based view allows for the development of core competencies. Because the globalisation of markets, its dynamism is no longer steerable; there is an interconnectedness which increases exponentially. People with their ability to solve problems are in the centre of these processes. With the instruments of Taylorism, complex enterprises cannot be steered for much longer. Furhtermoore, most employees will need to be more than executives of predetermined tasks. The promotion of the full potential in an enterprise and at the same time to realize the motivation of the people ist the priority pattern assignment of executives. Four empirical studies, which adumbrate sphere of action, flow into this Master Thesis. In the last chapter, the results of exploration of the relevant motivation theories an the one hand and the empirical studies on the other, will give an overview of the necessary terms and parameters. These are needed to create general conditions for a widely framed incentive system for knowledge based enterprises.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Aufbau der Master Thesis
- Ausgangssituation
- Fragestellung
- Methodische Vorgehensweise
- Ziel der Arbeit
- Begriffsdefinitionen
- Anreiz
- Motiv
- Anreizsysteme
- Motivation
- Intrinsische Motivation
- Extrinsische Motivation
- Systemisches Management
- Kompliziertheit und Komplexität
- Motivationstheoretische Ansätze
- Die Psychoanalytischen Theorien
- Instinkt- und Triebtheorien nach McDougall, Freud, Hull
- Vergleichende Betrachtung der Psychoanalytischen Theorien
- Inhaltstheorien
- Die Hierarchie der Bedürfnisse nach Maslow (Reifungstheorie) 1954
- Die ERG-Theorie von Alderfer (1969)
- Das Zwei-Faktoren-Modell von Herzberg (1959)
- Die Theorie der gelernten Bedürfnisse nach McClelland (1953; 1985)
- Optimism Theory von Seligman
- Die Optimal Experience Theory von Csikszentmihalyi
- Das Modell nach Steven Reiss
- Vergleichende Betrachtung der Inhaltstheorien
- Prozesstheorien
- Anreiz-Beitrags-Theorien
- Erwartungstheoretische Motivationstheorien – Grundlegender Aufbau
- Das Risikowahl-/Leistungsmotivationsmodell von Atkinson
- Das Weg-Ziel-Modell von Evans
- Die Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-(VIE)-Theorie von Vroom
- Das Prozessmodell von Porter & Lawler
- „Goal-setting“-(Zieltheorie-) Modell von Locke (1976)
- Das erweiterte Motivationsmodell von Heckhausen
- Vergleichende Betrachtung der Prozesstheorien
- Attributionstheorien
- Kausalattribution, Theorie der Motivation und Emotion von Weiner
- Kognitive Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan (1985)
- Sozialpsychologische Ansätze der Motivationstheorien
- Fairnesstheorie
- Die Gerechtigkeitstheorie von Adams (1963)
- Abschließende Bewertung der Psychoanalytischen, der Inhalts-, der Prozess- und der Attrubitionstheorien
- Wissen
- Kompetenz
- Empirische Untersuchung der Effizienz und Effektivität von Anreizsystemen
- Die Fraunhofer IAO Studie „knowledge meets motivation“
- „Vom Wissen zum Können“ – empirische Untersuchung auf systemtheoretischer Basis der DETECON GmbH, Eschborn
- „Wissensmanagement 2004“ Studie der LexisNexis Deutschland GmbH im Auftrag von forsa, Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH, 2004
- An inquiry into the motivations of knowledge workers in the Japanese financial industry, by Kubo, Izumi / Saka, Ayse
- Interpretation und Diskussion der empirischen Untersuchungsergebnisse
- Extrinsische oder intrinsische Motivation?
- Mitarbeiterzufriedenheit und Wirksamkeit von Wissensmanagement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Master Thesis untersucht Gestaltungskonzepte von Anreizsystemen zur wissensorientierten Unternehmens- und Organisationsführung. Das Hauptziel ist die Entwicklung von Rahmenbedingungen für ein umfassendes Anreizsystem in wissensbasierten Unternehmen. Die Arbeit basiert auf der Analyse relevanter Motivationstheorien und vier empirischer Studien.
- Motivationstheorien im Kontext von Wissensmanagement
- Effizienz und Effektivität von Anreizsystemen
- Intrinsische vs. extrinsische Motivation von Wissensarbeitern
- Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Wissensmanagement
- Entwicklung von Rahmenbedingungen für Anreizsysteme in wissensbasierten Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der wissensorientierten Unternehmensführung ein und betont die Bedeutung von Wissen als Produktionsfaktor. Sie skizziert die Problematik traditioneller Steuerungsinstrumente in komplexen Unternehmen und formuliert die Forschungsfrage nach Gestaltungskonzepten von Anreizsystemen zur Motivation von Wissensarbeitern. Die methodische Vorgehensweise und die Ziele der Arbeit werden ebenfalls dargelegt.
Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der Arbeit, wie Anreiz, Motiv, Anreizsysteme, intrinsische und extrinsische Motivation, systemisches Management sowie Kompliziertheit und Komplexität. Es legt die Grundlage für ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Terminologie und stellt sicher, dass die spätere Analyse auf einer soliden begrifflichen Basis beruht. Die Definitionen bilden den Rahmen für die Interpretation der empirischen Daten und die Entwicklung der Empfehlungen für Anreizsysteme.
Motivationstheoretische Ansätze: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene motivationstheoretische Ansätze, darunter psychoanalytische, inhalts- und prozesstheoretische Modelle sowie attributionstheoretische Ansätze. Es werden klassische Theorien wie Maslows Bedürfnishierarchie, Herzbergs Zwei-Faktoren-Modell und Vrooms VIE-Theorie detailliert erläutert und ihre Relevanz für das Verständnis der Motivation von Wissensarbeitern diskutiert. Die vergleichende Betrachtung der unterschiedlichen Ansätze dient der Identifizierung relevanter Aspekte für die Gestaltung von Anreizsystemen.
Empirische Untersuchung der Effizienz und Effektivität von Anreizsystemen: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert die Ergebnisse von vier empirischen Studien, die verschiedene Aspekte der Motivation von Wissensarbeitern und der Effektivität von Anreizsystemen beleuchten. Die Studien untersuchen unterschiedliche Kontexte und Methoden, um ein umfassendes Bild der Zusammenhänge zu liefern. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Interpretation und Diskussion im folgenden Kapitel.
Interpretation und Diskussion der empirischen Untersuchungsergebnisse: Dieses Kapitel synthetisiert die Ergebnisse der empirischen Studien und diskutiert ihre Implikationen für die Gestaltung von Anreizsystemen im Wissensmanagement. Es werden die Beziehungen zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation, Mitarbeiterzufriedenheit und der Wirksamkeit von Wissensmanagement analysiert. Die Diskussion liefert wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung von praxisorientierten Empfehlungen.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Anreizsysteme, Motivation, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Mitarbeiterzufriedenheit, Wissensarbeiter, Motivationstheorien, empirische Untersuchung, Anreizgestaltung, Unternehmenssteuerung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Master Thesis: Gestaltungskonzepte von Anreizsystemen zur wissensorientierten Unternehmens- und Organisationsführung
Was ist das Thema der Master Thesis?
Die Master Thesis untersucht Gestaltungskonzepte von Anreizsystemen zur wissensorientierten Unternehmens- und Organisationsführung. Das Hauptziel ist die Entwicklung von Rahmenbedingungen für ein umfassendes Anreizsystem in wissensbasierten Unternehmen.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse relevanter Motivationstheorien und der Auswertung von vier empirischen Studien. Die methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung detailliert beschrieben.
Welche Motivationstheorien werden behandelt?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene motivationstheoretische Ansätze, darunter psychoanalytische Theorien (McDougall, Freud, Hull), Inhaltstheorien (Maslow, Alderfer, Herzberg, McClelland, Seligman, Csikszentmihalyi, Reiss), Prozesstheorien (Anreiz-Beitrags-Theorien, Erwartungstheorien, Zieltheorien) und Attributionstheorien (Weiner, Deci & Ryan). Die verschiedenen Ansätze werden verglichen und auf ihre Relevanz für Wissensarbeiter untersucht.
Welche empirischen Studien wurden analysiert?
Die Thesis analysiert vier empirische Studien: die Fraunhofer IAO Studie „knowledge meets motivation“, die DETECON GmbH Studie „Vom Wissen zum Können“, die LexisNexis/forsa Studie „Wissensmanagement 2004“ und die Studie von Kubo und Saka über die Motivation von Wissensarbeitern in der japanischen Finanzindustrie.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Zentrale Begriffe wie Anreiz, Motiv, Anreizsysteme, intrinsische und extrinsische Motivation, systemisches Management, Kompliziertheit und Komplexität werden im Kapitel "Begriffsdefinitionen" präzise erläutert.
Welche Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die Forschungsfrage lautet: Welche Gestaltungskonzepte von Anreizsystemen sind geeignet, Wissensarbeiter in wissensbasierten Unternehmen zu motivieren?
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wissensmanagement, Anreizsysteme, Motivation, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Mitarbeiterzufriedenheit, Wissensarbeiter, Motivationstheorien, empirische Untersuchung, Anreizgestaltung, Unternehmenssteuerung.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der empirischen Studien werden präsentiert und analysiert. Die Interpretation der Ergebnisse fokussiert auf den Zusammenhang zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation, Mitarbeiterzufriedenheit und der Wirksamkeit von Wissensmanagement.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen für die Gestaltung von Anreizsystemen im Wissensmanagement und entwickelt praxisorientierte Empfehlungen für die Entwicklung von Rahmenbedingungen für Anreizsysteme in wissensbasierten Unternehmen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Begriffsdefinitionen, einen Überblick über motivationstheoretische Ansätze, die Präsentation und Analyse der empirischen Studien, die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse sowie ein Fazit. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis befindet sich im Dokument.
- Arbeit zitieren
- Master of Science Klaus Frano-Pallesche, MSc (Autor:in), 2005, Auf der Suche nach Motiven, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93656