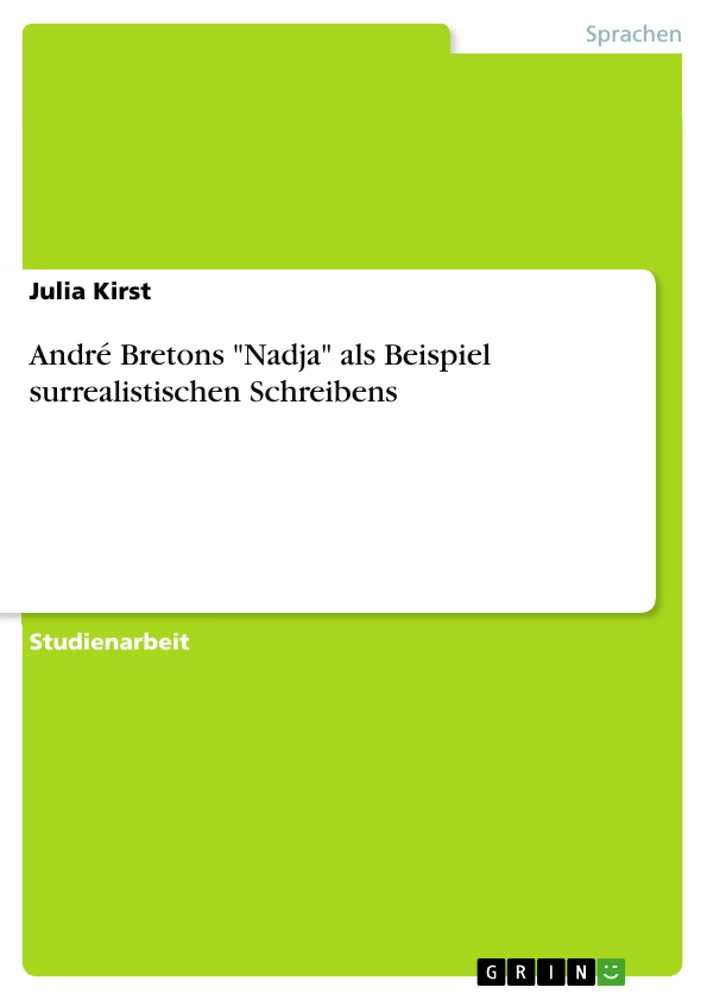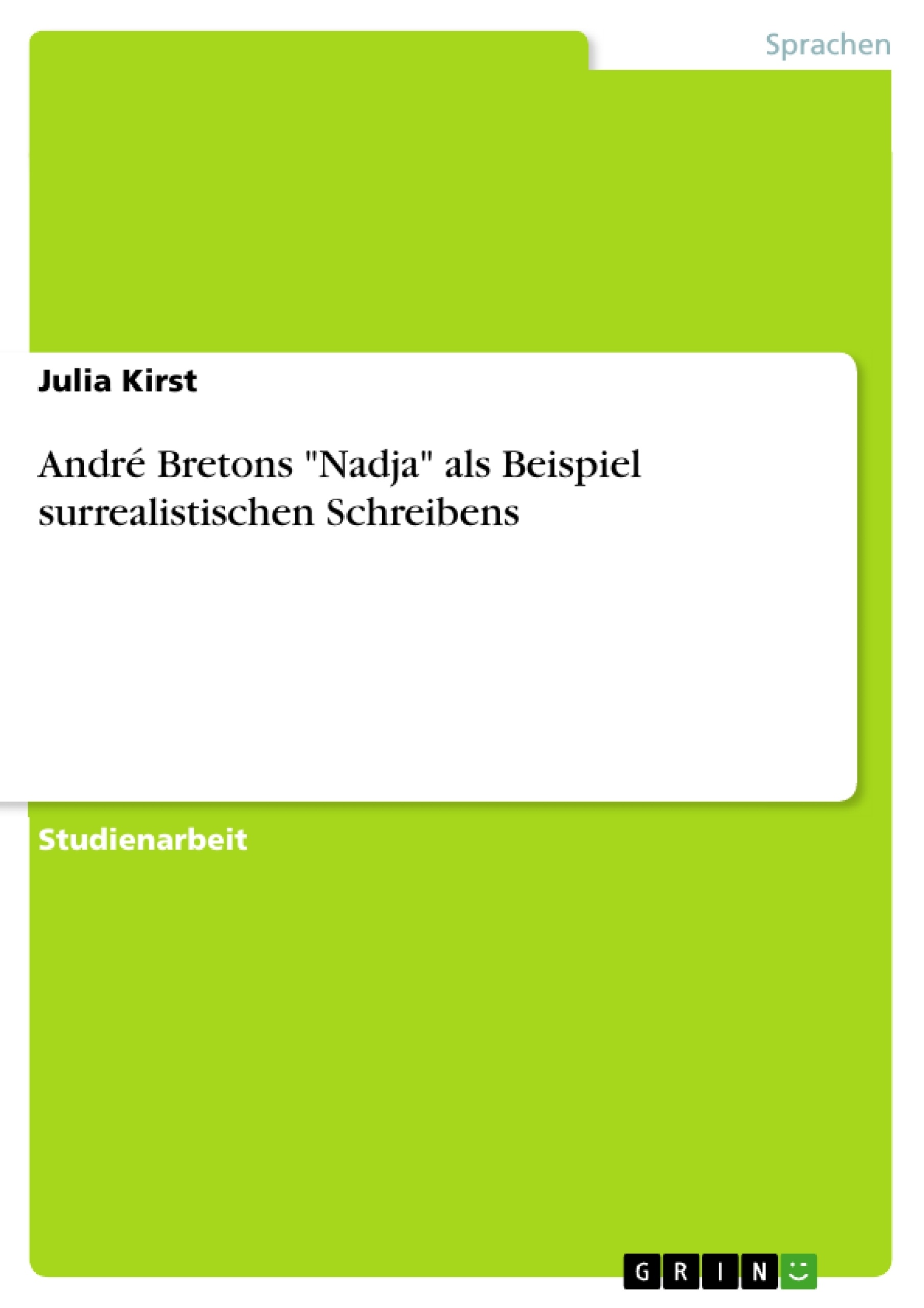Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit André Bretons "Nadja".
Zunächst wird das Phänomen des "hasard objectif", das mit dem Werk sowie dem Surrealismus im Allgemeinen in enger Verbindung steht, erläutert.
Eine weitere wichtige Rolle in "Nadja" spielt zudem die Beziehung zwischen dem Autor und der Hauptfigur, die in der Arbeit genauer analysiert und dargestellt wird. Diesbezüglich sind auch die Illustrationen sowie das Bild-Text-Verhältnis im Buch von Wichtigkeit, worauf ebenfalls eingegangen wird.
Abschließend geht es um den Wahnsinn, der mit Nadja in Verbindung steht, den aus medizinischer Sicht galt sie als verrückt und wurde in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Darstellung Nadjas
- L'hasard objectif
- Die Zeichen und Vorahnungen
- Die Beziehung zwischen Breton und Nadja
- Nadja in der Rolle des Mediums.
- Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Breton und Nadja
- Die Illustrationen
- Mme Sacco »>, << Blanche Derval » und « Ses yeux de fougère »
- Nadjas Zeichnungen
- Die Darstellung Najas in den Zeichnungen
- Nadja und die folie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung befasst sich mit André Bretons Werk Nadja, das 1928 entstand. Das Werk ist ein Beispiel für surrealistisches Schreiben und beschäftigt sich mit der Person Nadja, die als Verkörperung des Surrealismus betrachtet werden kann. Die Arbeit untersucht die Darstellung der Figur Nadja, ihren autobiografischen Hintergrund und ihre Beziehung zu André Breton. Des Weiteren werden die Erscheinungen der Theorie des hasard objectif beleuchtet, die das alltägliche Leben in ein "merveilleux quotidien" verwandeln.
- Die Darstellung der Figur Nadja
- Die Theorie des hasard objectif und ihre Auswirkungen auf das Werk
- Die Beziehung zwischen Breton und Nadja
- Die Illustrationen und Zeichnungen im Werk
- Nadja und der Wahnsinn
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Werk Nadja von André Breton und dessen Entstehung im Kontext der surrealistischen Bewegung vor. Sie erläutert den autobiografischen Hintergrund Bretons und Nadjas und hebt die Bedeutung des hasard objectif für das Werk hervor.
Das Kapitel über die Darstellung Nadjas befasst sich mit der Frage, wer Nadja ist und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der realen Person Léona Camille Ghislaine Delcourt und der Figur Nadja im Text bestehen. Es werden auch die Vorahnungen und Prophezeiungen von Nadja behandelt, die eine zentrale Rolle in der Beziehung zwischen Breton und Nadja spielen.
Im Kapitel über den hasard objectif werden die Zeichen und Vorahnungen im Werk analysiert. Es wird erläutert, wie das Alltägliche durch den hasard objectif zu einem "merveilleux quotidien" wird und wie diese Theorie den Zugang zum Wunderbaren ermöglicht.
Das Kapitel über die Beziehung zwischen Breton und Nadja beleuchtet die Rolle Nadjas als Medium und das Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden. Es wird erklärt, wie Nadja Breton den Zugang zu ihrer geheimnisvollen Welt verschafft und wie die Begegnung zwischen ihnen das Leben Bretons und die surrealistische Bewegung beeinflusst hat.
Das Kapitel über die Illustrationen und Zeichnungen im Werk konzentriert sich auf die visuelle Gestaltung von Nadja und die Bedeutung der abstrakten, surrealistischen Zeichnungen Nadjas. Es werden auch die Zeichnungen von Nadja analysiert, die einen besonderen Bezug zu ihrer Person und dem Werk im Allgemeinen haben.
Das Kapitel über Nadja und den Wahnsinn befasst sich mit der Frage nach der moralischen Verantwortung Bretons gegenüber Nadja. Es wird unter anderem untersucht, warum Nadja in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert wurde und wie ihre Krankheit im Werk zum Ausdruck kommt.
Schlüsselwörter
Surrealismus, André Breton, Nadja, hasard objectif, merveilleux quotidien, Medium, Abhängigkeitsverhältnis, Illustrationen, Zeichnungen, Wahnsinn, psychiatrische Anstalt, moralische Verantwortung.
- Quote paper
- Julia Kirst (Author), 2007, André Bretons "Nadja" als Beispiel surrealistischen Schreibens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93405