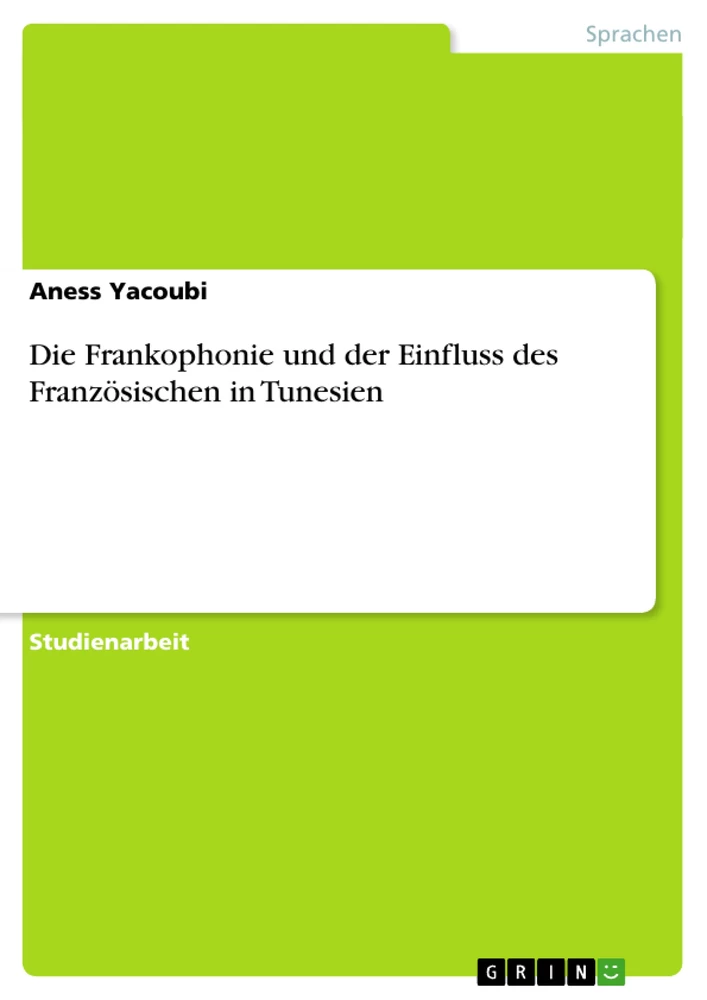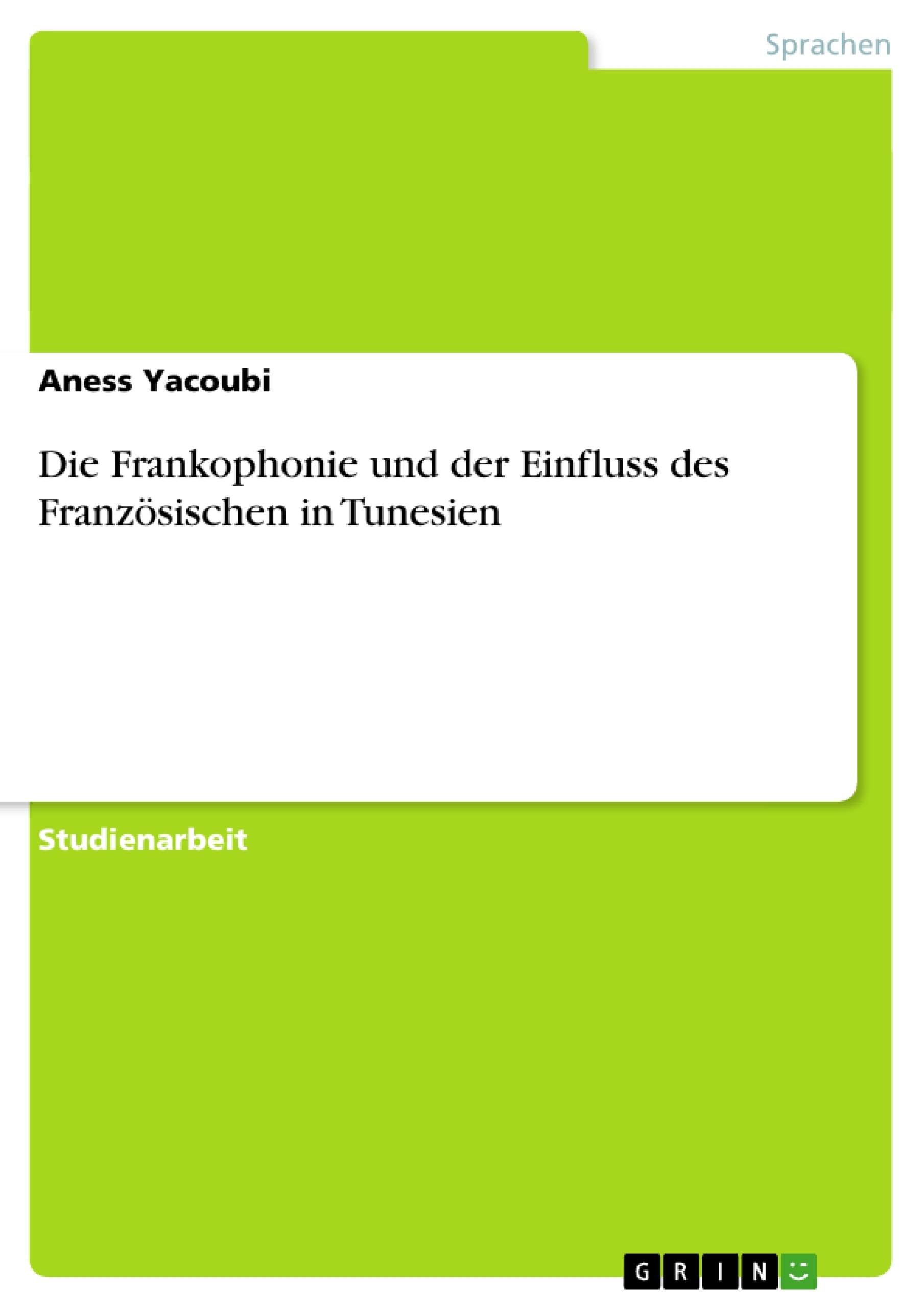Auf sprachlicher Ebene bezeichnet die Frankophonie die Gesamtheit aller französischsprachigen Staaten. Der funktionale Status in den einzelnen Ländern ist jedoch unterschiedlich. In einem Land kann das Französische Muttersprache und einzige Amtssprache (Frankreich) oder eine Amtssprache eines mehrsprachigen Landes (Schweiz, Belgien, Kanada etc.) sein. Es kann ebenfalls eine Amtssprache in einem Land sein ohne dass es Muttersprache für weitere Bevölkerungsgruppen ist (Zaire, Kongo). Schließlich kann es auch nur eine Verkehrssprache (Madagaskar) oder eine privilegierte Bildungssprache (Tunesien, Libanon etc.) sein.
Jedoch entstand im Zuge des Kolonialismus und hauptsächlich in den afrikanischen Ländern eine Art Widerstand gegen die Französisierung. Einige afrikanische Staaten und Bevölkerungsgruppen sehen das Französische als eine Bedrohung seitens des Neokolonialismus gegen die eigene Sprache im Land, die aufgrund des Französischen immer mehr zurückgedrängt wird. Auf der Oberfläche kann es schon möglich sein, dass mit Hilfe des Französischen afrikanische Staaten mehr und mehr in die westliche Welt integriert werden. Es ist gut möglich, dass sich für einige Menschen aus Afrika die Türen Europas öffnen und sie eine Möglichkeit für eine bessere berufliche und soziale Zukunft haben. Einige Menschen aus afrikanischen Ländern träumen Tag und Nacht davon nach Europa auszuwandern und ein neues Leben anzufangen. Denn das Französische oder auch das Englische würde den Zugang zum Beruf erleichtern. Dies ist nun mal die Geschichte, die sich so entwickelt hat. Westeuropäische Sprachen stehen für Fortschritt und Globalisierung. Dieses Faktum kann man nicht ändern oder rückgängig machen. Daher ist es vielleicht aus diesem Grund, dass einige Bevölkerungsgruppen das Französische als Bedrohung für die eigene Kultur sehen. Es ist für sie alles andere als eine Leitkultur oder eine privilegierte Sprache. Sie zerstöre die eigene Kultur im Land und würde die Verantwortung dafür tragen, wenn die heimischen Sprachen nach und nach aussterben würden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Der Begriff Frankophonie
- 1.2. Ziel der Studienarbeit
- 2. Geschichtliches zur Republik Tunesien
- 3. Die Entwicklung und Verbreitung des Arabischen im Maghreb
- 3.1. Die sprachliche Situation im Maghreb (Tunesien)
- 4. Einfluss des Französischen in Tunesien
- 5. Entlehnungen und Mischformen im tunesischen Dialekt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Französischen auf Tunesien, insbesondere seine Rolle als Bildungssprache und seine Auswirkungen auf den tunesischen Arabisch-Dialekt. Die Studie beleuchtet den komplexen Status des Französischen im tunesischen Kontext – zwischen privilegierter Sprache und potenzieller Bedrohung für die eigene Kultur.
- Der Begriff Frankophonie und seine Bedeutung über die sprachliche Ebene hinaus.
- Die historische Entwicklung Tunesiens und der Einfluss der französischen Kolonialisierung.
- Die Entwicklung und Verbreitung des Arabischen im Maghreb und die Entstehung von Dialekten.
- Der Einfluss des Französischen auf den tunesischen Arabisch-Dialekt, einschließlich Entlehnungen und Mischformen.
- Die Akzeptanz des Französischen in der tunesischen Bevölkerung und die damit verbundenen kulturellen und sprachlichen Konflikte.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Frankophonie ein und definiert den Begriff sowohl sprachlich als auch sozialpolitisch und wirtschaftlich. Es wird der unterschiedliche Status des Französischen in verschiedenen Ländern aufgezeigt, von Muttersprache bis hin zu privilegierter Bildungssprache. Zudem wird der ambivalenten Rolle des Französischen in postkolonialen Kontexten, insbesondere der potenziellen Bedrohung für einheimische Sprachen, Beachtung geschenkt. Das Kapitel endet mit der Definition des Ziels der Arbeit – der Untersuchung des Phänomens Französisch in Tunesien und dessen Einfluss auf den arabischen Dialekt.
2. Geschichtliches zur Republik Tunesien: Diese Kapitel beschreibt die historische Entwicklung Tunesiens, beginnend mit der osmanischen Herrschaft bis zur Unabhängigkeit. Es beleuchtet die wirtschaftlichen Krisen des 19. Jahrhunderts, die französische Kolonialisierung und die daraus resultierenden politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Die Entwicklung von Unabhängigkeitsbewegungen und die letztendliche Errichtung der tunesischen Republik werden detailliert dargestellt. Die Bedeutung dieses historischen Überblicks liegt in der Veranschaulichung des Kontextes, in dem der Einfluss des Französischen zu verstehen ist.
3. Die Entwicklung und Verbreitung des Arabischen im Maghreb: Dieses Kapitel behandelt die sprachliche und kulturelle Entwicklung im Maghreb, beginnend mit der römischen Besatzung und Christianisierung bis hin zur islamischen Expansion und Arabisierung. Es wird die Bedeutung des Klassischen Arabisch als heilige Sprache des Islam hervorgehoben und der Entstehung von regionalen Dialekten Rechnung getragen. Der Einfluss des Berberischen und später des Französischen auf die sprachliche Situation im Maghreb wird analysiert, einschließlich der Entstehung einer Diglossie zwischen Hochsprache und Dialekt.
4. Einfluss des Französischen in Tunesien: Dieses Kapitel untersucht den tiefgreifenden Einfluss des Französischen auf Tunesien seit der französischen Kolonialisierung. Es beleuchtet die Rolle des Französischen in Bildung, Medien und Öffentlichkeit. Die Entwicklung eines fünfsprachigen Systems wird analysiert – die heilige Koransprache, Neuhocharabisch, Regionaldialekte, Französisch und Mischformen aus Arabisch/Berberisch und Französisch. Die Kapitel diskutiert die ambivalenten Reaktionen der tunesischen Bevölkerung auf das Französisch: zwischen Akzeptanz als Sprache des Fortschritts und Ablehnung als Bedrohung der eigenen Kultur.
5. Entlehnungen und Mischformen im tunesischen Dialekt: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der sprachlichen Entlehnungen und Mischformen im tunesischen Arabisch-Dialekt, die aus der historischen Begegnung mit Türkisch, Berberisch, Italienisch, Spanisch und vor allem Französisch resultieren. Es wird die Anpassung der entlehnten Wörter an die arabische Grammatik erläutert, sowie der Gebrauch dieser Wörter in der gesprochenen Sprache und sogar zunehmend in der Schriftsprache (z.B. in der Werbung) gezeigt.
Schlüsselwörter
Frankophonie, Tunesien, Französisch, Arabisch, Dialekt, Kolonialismus, Sprachkontakt, Sprachwandel, Diglossie, Kulturaustausch, Identitätskrise, Entlehnung, Mischsprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Der Einfluss des Französischen auf den tunesischen Arabisch-Dialekt
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der französischen Sprache auf Tunesien, insbesondere ihre Rolle als Bildungssprache und ihre Auswirkungen auf den tunesischen Arabisch-Dialekt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem komplexen Status des Französischen im tunesischen Kontext – zwischen privilegierter Sprache und potenzieller Bedrohung für die eigene Kultur.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Begriff Frankophonie und seine Bedeutung, die historische Entwicklung Tunesiens und der Einfluss der französischen Kolonialisierung, die Entwicklung und Verbreitung des Arabischen im Maghreb und die Entstehung von Dialekten, der Einfluss des Französischen auf den tunesischen Arabisch-Dialekt (inkl. Entlehnungen und Mischformen), sowie die Akzeptanz des Französischen in der tunesischen Bevölkerung und die damit verbundenen kulturellen und sprachlichen Konflikte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Frankophonie und Definition des Ziels der Arbeit. Kapitel 2 (Geschichtliches zur Republik Tunesien): Historische Entwicklung Tunesiens bis zur Unabhängigkeit. Kapitel 3 (Entwicklung und Verbreitung des Arabischen im Maghreb): Sprachliche und kulturelle Entwicklung im Maghreb. Kapitel 4 (Einfluss des Französischen in Tunesien): Einfluss des Französischen auf Bildung, Medien und Öffentlichkeit in Tunesien. Kapitel 5 (Entlehnungen und Mischformen im tunesischen Dialekt): Analyse sprachlicher Entlehnungen und Mischformen im tunesischen Arabisch-Dialekt durch den Kontakt mit verschiedenen Sprachen, insbesondere Französisch.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Frankophonie, Tunesien, Französisch, Arabisch, Dialekt, Kolonialismus, Sprachkontakt, Sprachwandel, Diglossie, Kulturaustausch, Identitätskrise, Entlehnung, Mischsprache.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss des Französischen auf den tunesischen Arabisch-Dialekt zu untersuchen und den komplexen Status des Französischen im tunesischen Kontext zu beleuchten. Sie analysiert die Auswirkungen der französischen Kolonialisierung auf die sprachliche Situation und die damit verbundenen kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen.
Wie wird der Einfluss des Französischen auf den tunesischen Arabisch-Dialekt konkret untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Französischen durch die Analyse von Entlehnungen und Mischformen im tunesischen Arabisch-Dialekt. Es wird die Anpassung der entlehnten Wörter an die arabische Grammatik und deren Verwendung in der gesprochenen und zunehmend auch in der Schriftsprache untersucht.
Welche Bedeutung hat der historische Kontext für die Arbeit?
Der historische Kontext, insbesondere die französische Kolonialisierung Tunesiens, ist essentiell für das Verständnis des Einflusses des Französischen auf die Sprache und Kultur Tunesiens. Die Arbeit beleuchtet daher die historische Entwicklung Tunesiens und die daraus resultierenden politischen, wirtschaftlichen und sprachlichen Abhängigkeiten.
Welche Rolle spielt der Begriff "Frankophonie" in der Arbeit?
Der Begriff "Frankophonie" wird sowohl sprachlich als auch sozialpolitisch und wirtschaftlich definiert. Die Arbeit zeigt den unterschiedlichen Status des Französischen in verschiedenen Ländern auf und betrachtet die ambivalente Rolle des Französischen in postkolonialen Kontexten.
- Quote paper
- Aness Yacoubi (Author), 2007, Die Frankophonie und der Einfluss des Französischen in Tunesien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93377