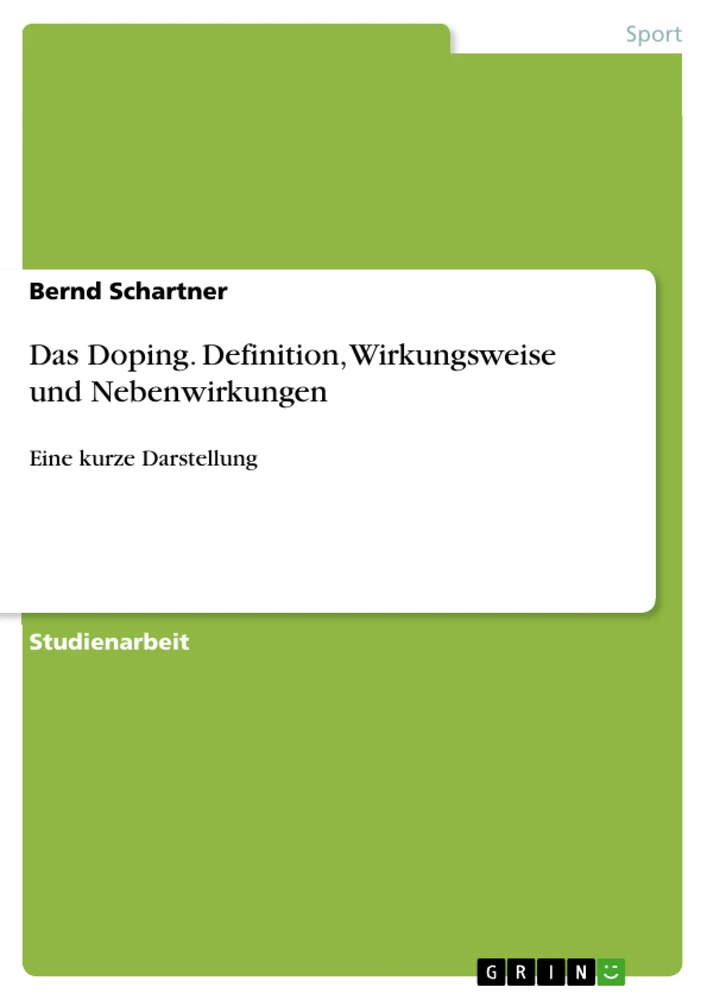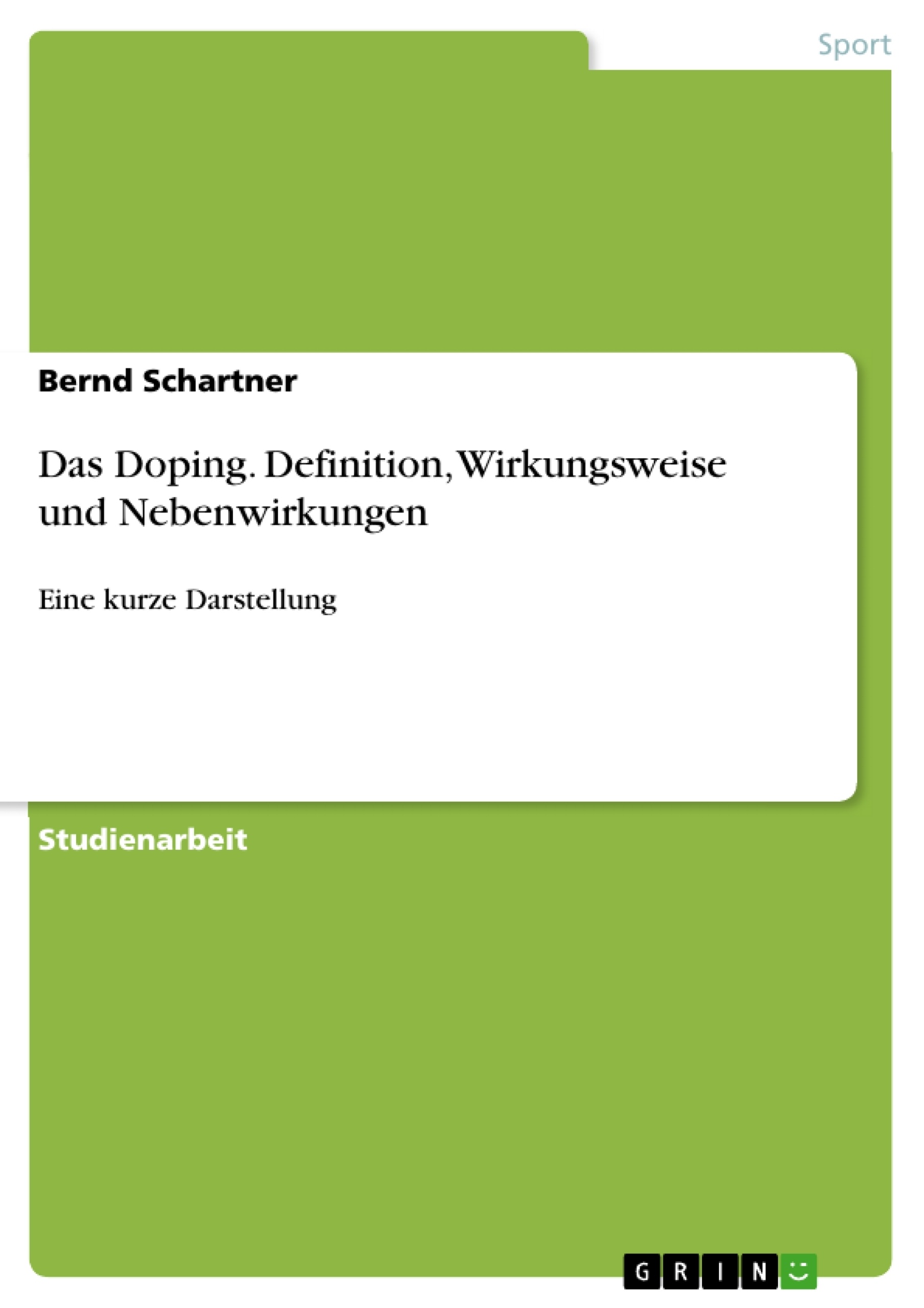Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Sport und Doping. Anliegen dieser Arbeit ist es zunächst, den Begriff „Doping“ zu definieren und zu erklären. Aufbauend auf dieser Definition wird im zweiten Abschnitt im Speziellen auf die Wirkungsweise von Erythropoietin (EPO) eingegangen. Ebenfalls behandelt werden die möglichen Gesundheitsrisiken bei EPO-Missbrauch als auch die gegebene Problematik der Nachweisbarkeit beim EPO-Doping.
Im dritten Teil dieser Studienarbeit wird auf die Einnahme leistungserhöhender Stimulantien sowie deren generelle Wirkungsweise, deren Nebenwirkungen und wie sich diese Stimulantien auf die Leistungsreserven der Sporttreibenden auswirken, eingegangen. Abschließend werden die Erkenntnisse dieser Studienarbeit kurz zusammengefasst und über die Freigabe von Dopingmitteln diskutiert. Hierbei bedient sich der Autor sowohl an in Literatur vorhandener als auch eigener Argumente und teilt diese in pro und contra. Am Ende folgt ein persönliches Fazit zur Freigabe von Dopingmitteln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sport und Doping
- Begriffsdefinition
- Erythropoietin (EPO)
- Wirkung
- Gesundheitsrisiken
- Nachweisbarkeit
- Stimulanzien
- Wirkungsweise
- Nebenwirkungen
- Leistungsreserven
- Zusammenfassung und Diskussion
- Pro Doping
- Contra Doping
- persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit dem Thema Sport und Doping. Das Hauptanliegen der Arbeit ist es, den Begriff "Doping" zu definieren und zu erklären. Darauf aufbauend werden im weiteren Verlauf die Wirkungsweise, Gesundheitsrisiken und Nachweisbarkeit von Erythropoietin (EPO) sowie die Wirkungsweise, Nebenwirkungen und Auswirkungen von leistungssteigernden Stimulanzien auf die Leistungsreserven von Sporttreibenden beleuchtet.
- Definition und Entwicklung des Begriffs „Doping“
- Wirkung und Gesundheitsrisiken von Erythropoietin (EPO)
- Nachweisbarkeit von EPO-Doping
- Wirkungsweise, Nebenwirkungen und Auswirkungen von leistungssteigernden Stimulanzien
- Diskussion der Freigabe von Dopingmitteln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Studienarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Sport und Doping und zielt darauf ab, den Begriff "Doping" zu definieren und zu erklären. Die Arbeit befasst sich mit der Wirkungsweise von Erythropoietin (EPO), den damit verbundenen Gesundheitsrisiken und der Nachweisbarkeit von EPO-Doping. Außerdem werden die Einnahme leistungssteigernder Stimulanzien, deren Wirkungsweise, Nebenwirkungen und Auswirkungen auf die Leistungsreserven von Sportlern untersucht. Zum Schluss werden die Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und die Freigabe von Dopingmitteln diskutiert.
Sport und Doping
Der Einsatz leistungssteigernder Substanzen ist im Leistungs- und im Freizeitsport seit jeher ein bekanntes Problem, das vermutlich schon seit den ersten sportlichen Wettkämpfen besteht. Doping im Sport ist keine neue Entwicklung der letzten Jahrzehnte, sondern ist seit dem Altertum eine gängige Methode, um die Leistungsfähigkeit von Sportlern zu steigern. Quellen belegen, dass bereits bei den Olympischen Spielen in der Antike versucht wurde, die Leistungsfähigkeit durch die Einnahme von Kräutern, Pilzen oder bestimmten Getränken zu verbessern. Das Doping wurde mit der Kommerzialisierung des Sports ab den 1960er Jahren zunehmend zum Problem. Auch im Freizeitsport nimmt das Doping in der heutigen Zeit zu. Schätzungen sprechen von rund 30 Millionen Menschen weltweit, die regelmäßig zu Dopingmitteln greifen.
Begriffsdefinition
Doping wird in der Regel als die Einnahme von nicht erlaubten Substanzen oder die Nutzung verbotener Methoden definiert, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen oder zu erhalten. Der Begriff Doping tauchte erstmals 1889 in einem englischen Wörterbuch auf und wurde als eine Mischung aus Narkotika und Opium beschrieben, die zu dieser Zeit Pferden bei Pferderennen verabreicht wurde. Sprachlich basiert der Begriff vermutlich auf dem Wort »dop«, einem Dialekt der südostafrikanischen Kaffer, die einen starken Schnaps als »dop« bezeichneten und ihn als Stimulanz einsetzten. Der Welt-Anti-Doping-Code (WADA) definiert Doping als das Auftreten von Verstößen gegen Anti-Doping-Bestimmungen, wie z.B. das Vorhandensein einer verbotenen Substanz in der Probe eines Athleten oder der (versuchte) Gebrauch einer verbotenen Substanz oder Methode durch einen Athleten.
Erythropoietin (EPO)
Erythropoietin (EPO) ist ein Glykoprotein-Hormon, das das Wachstum der roten Blutkörperchen fördert. Dies führt zu einer erhöhten Sauerstoffversorgung des Gewebes, was vor allem im Ausdauersportbereich zu missbräuchlicher Anwendung führt. Die leistungssteigernde Wirkung ist für das Verbot von EPO im Sport verantwortlich. Die Fédération Internationale de Ski (FIS) führt EPO seit 1988 auf ihrer Verbotsliste als Dopingmittel auf. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verbot EPO erstmals 1990 und setzte das Verbot bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona durch. Körpereigen wird Erythropoietin hauptsächlich in den Nieren und zu kleinen Mengen auch in der Leber gebildet. In der Medizin wird rekombinantes EPO seit dem Ende der 1980er Jahre als Arzneimittel bei totalem Nierenversagen eingesetzt. Hochdosiert ist es als „Antianämikum bei chronischer Polyarthritis, AIDS, Tumoren und operativen Eingriffen wirksam“.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Studienarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Sport und Doping, wobei die Schwerpunkte auf den Begriffen „Doping“ und „Erythropoietin (EPO)“ liegen. Weitere wichtige Aspekte sind die Wirkungsweise, Gesundheitsrisiken und Nachweisbarkeit von EPO sowie die Wirkungsweise, Nebenwirkungen und Auswirkungen leistungssteigernder Stimulanzien auf die Leistungsreserven von Sportlern. Die Diskussion der Freigabe von Dopingmitteln stellt einen weiteren zentralen Punkt der Arbeit dar.
- Quote paper
- Bernd Schartner (Author), 2020, Das Doping. Definition, Wirkungsweise und Nebenwirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/933567