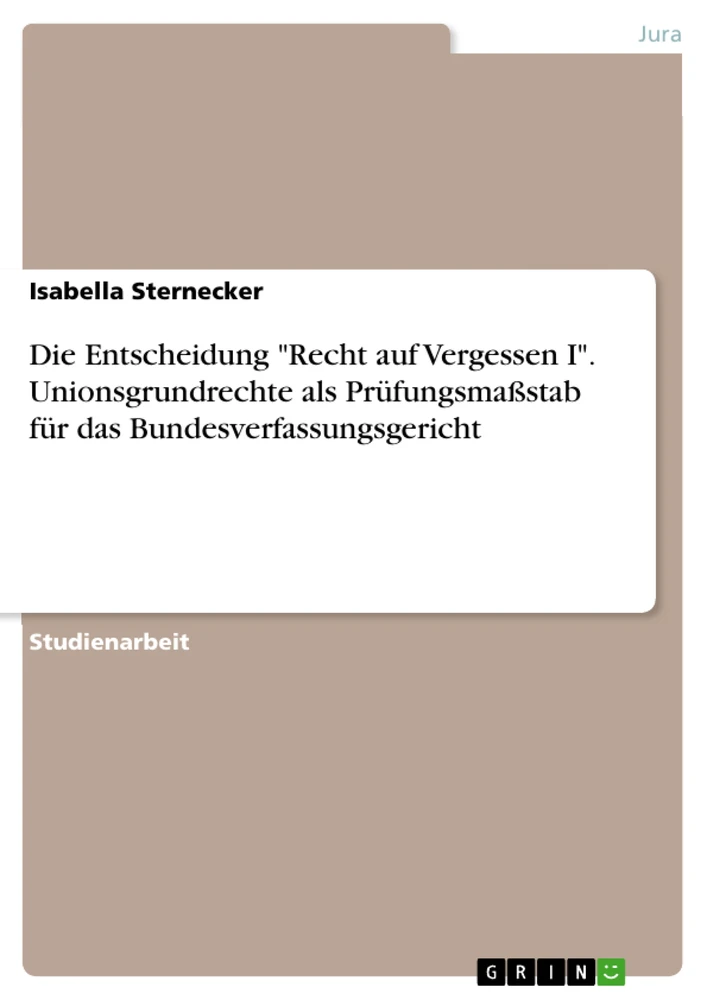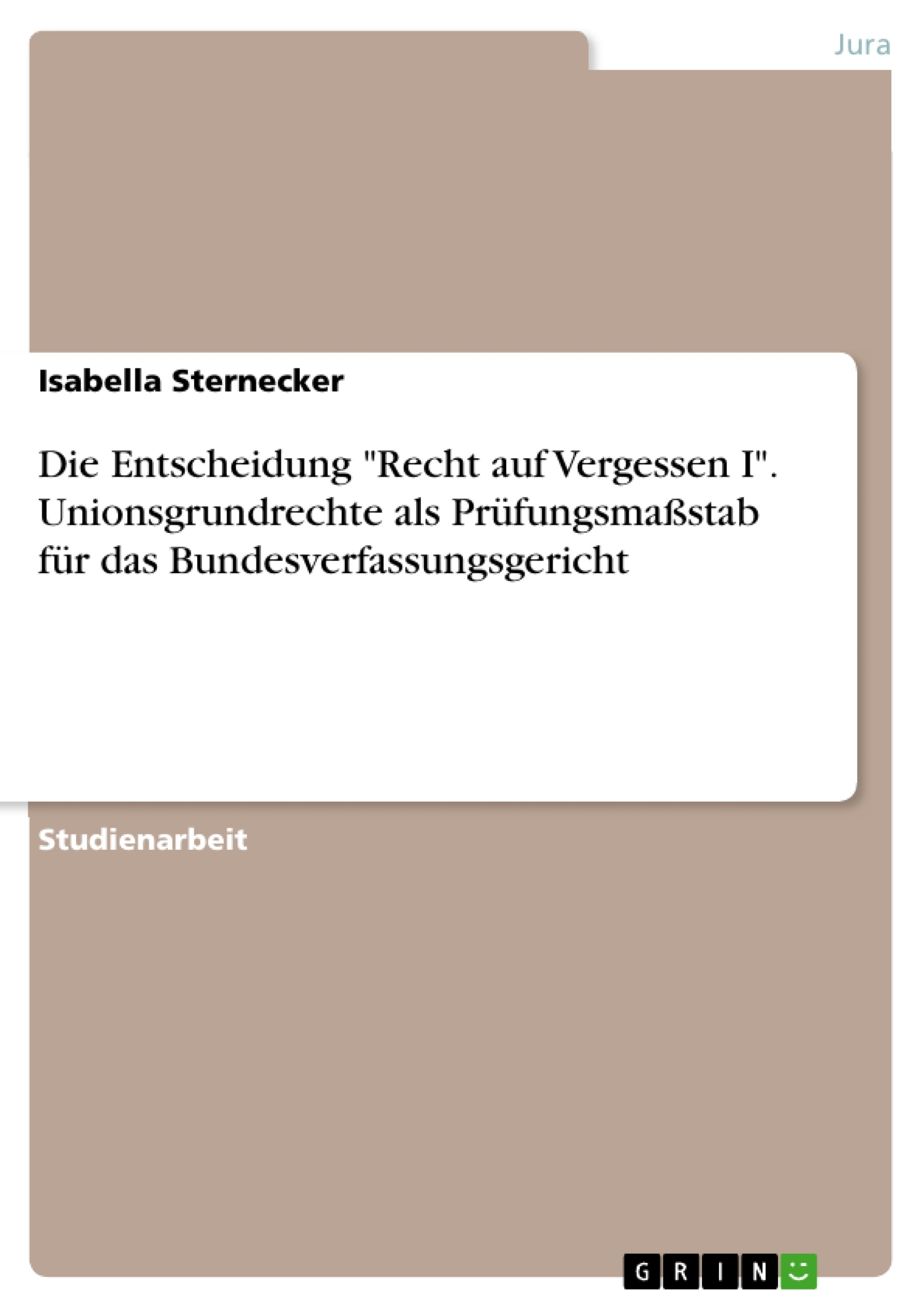Seit der Begründung des Europäischen Gerichtshofes 1957 und verstärkt seit der rechtsverbindlichen Aufnahme der EU-Grundrechtecharta in europäisches Primärrecht durch den Lissabonner Vertrag 2009 hat es zwischen den gewichtigen gerichtlichen Grundrechtsgaranten innerhalb der Europäischen Union einen regelrechten Ping-Pong-Kampf um die Kernfragen der vertikalen Machtverteilung gegeben. Während der unionale Grundrechtsschutz anfangs lediglich die Unmittelbarkeit und den Vorrang des Gemeinschaftsrechts zur Etablierung eines integrativen und einheitlichen Binnenmarktes absichern sollte, rückten im Laufe der Zeit verstärkt menschenrechtliche Aspekte und somit auch die Bedeutung des EuGH in den Vordergrund. Dies bewegte das Bundesverfassungsgericht zum Erlass des "Solange-I"-Vorbehalts, welcher später durch die berühmte "Solange-II"-Rechtsprechung abgemildert wurde. Die Entscheidungen „Europäischer Haftbefehl“ und „Lissabon“ verdeutlichten dann aber wieder die Angst Karlsruhes vor wachsendem Einflussverlust angesichts eines immer dominanter werdenden EuGH. Die 2013 vom EuGH erlassene Rechtsprechung zu „Åkerberg Fransson“ sowie die darauf folgende Reaktion des BVerfG im Urteil zur Antiterrordatei markieren schließlich die wohl absehbare Kumulation dieser sich immer weiter zuspitzenden Lage in der Beziehung von GRCh und nationalem Grundgesetz.
Doch zum Ende des Grundgesetz-Jubiläumsjahres 2019 könnte Karlsruhe nun mit den beiden Entscheidungen "Recht auf Vergessen I" und "Recht auf Vergessen II" eine neue Ära des verfassungsprozessualen Grundrechtsschutzes eingeläutet haben. Bislang widmete die Literatur vor allem der zweiten Entscheidung aufgrund ihres paukenschlagähnlichen Charakters große Beachtung. Dies ist sicherlich gerechtfertigt, jedoch darf daneben die Bedeutung von "Recht auf Vergessen I" in dieser "Novemberrevolution" nicht etwa in Vergessenheit geraten.
Ob und inwiefern auch diesem Urteil eine revolutionäre Rolle zugeschrieben werden kann, wird in dieser Arbeit eingehender untersucht. Hierfür wird zunächst der bisherige Meinungsstand zur Grundrechtsbindung in der EU genauer dargestellt und anschließend aufgezeigt, wo das BVerfG in "Recht auf Vergessen I" neue Akzente setzt. Im Rahmen einer kritischen Darstellung ihrer Risiken und Chancen wird abschließend eine eigene Stellungnahme zu der Entscheidung vom 6.11.2019 getroffen.
Inhaltsverzeichnis
- A. „Recht auf Vergessen I“ im Schatten von „Vergessen II“?
- Bisheriger Meinungsstand
- I. Unionsrechtlich voll determinierter Bereich
- II. Spielraumbereich
- 1. Trennungsthese des BVerfG
- a) Darstellung
- b) Rechtsliteratur
- 2. Kumulationsthese des EuGH
- a) Darstellung
- b) Rechtsliteratur
- 3. Alternative Lösungsansätze
- C. Die Entscheidung „Recht auf Vergessen I“
- I. Sachverhalt
- II. Neue verfassungsprozessuale Akzente durch das BVerfG
- 1. Rechtlicher Hintergrund
- 2. Abstrakte Darstellung
- a) Abkehr des Ersten Senates von der Trennungsthese
- b) Auslegung nationaler Grundrechte im Lichte der GRCh
- c) Ausnahmen vom Vorrang nationaler Grundrechte
- 3. Abgrenzungskriterien des BVerfG
- 4. Anwendung auf den vorliegenden Sachverhalt
- 5. Zusammenfassung
- III. Kritische Analyse und Stellungnahme
- 1. Kritikpunkte und Folgeschwierigkeiten
- a) Gefahr eines Aushebelns der Kumulationstheorie
- b) Abgrenzungsschwierigkeiten
- c) Fehlende Bereitschaft zum Vorabentscheidungsverfahren
- 2. Chancen von „Recht auf Vergessen I“
- a) Gleichgewicht in der europäischen Grundrechtelandschaft
- b) Deutsche Stimme im europäischen Grundrechtedialog
- D. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit analysiert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Fall „Recht auf Vergessen I“ (1 BvR 16/13) und befasst sich mit der Frage, wie das BVerfG Unionsgrundrechte als Prüfungsmaßstab einsetzt.
- Die Interaktion zwischen nationalem und europäischem Grundrechtsschutz
- Die Abgrenzung von nationalem und europäischem Grundrechtsschutz
- Die Rolle des BVerfG im europäischen Grundrechtedialog
- Die Auswirkungen der Entscheidung „Recht auf Vergessen I“ auf die europäische Grundrechtelandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A behandelt den bisherigen Meinungsstand zur Frage, inwieweit Unionsgrundrechte den nationalen Grundrechtsschutz determinieren. Hier werden die Trennungsthese des BVerfG und die Kumulationsthese des EuGH gegenübergestellt.
Kapitel C widmet sich der Entscheidung „Recht auf Vergessen I“ und stellt die Argumentation des BVerfG dar. Es wird erörtert, welche neuen verfassungsprozessualen Akzente durch das BVerfG gesetzt wurden und welche Abgrenzungskriterien das BVerfG in diesem Zusammenhang entwickelt hat.
Kapitel III befasst sich mit der kritischen Analyse und Stellungnahme zur Entscheidung „Recht auf Vergessen I“. Es werden Kritikpunkte und Folgeschwierigkeiten aufgezeigt, aber auch Chancen der Entscheidung für die europäische Grundrechtelandschaft diskutiert.
Schlüsselwörter
Unionsgrundrechte, Grundgesetz, BVerfG, EuGH, Trennungsthese, Kumulationsthese, Recht auf Vergessen, Datenschutz, europäischer Grundrechtsschutz, nationale Grundrechte, Vorrang, Abgrenzung, europäische Grundrechtelandschaft, Grundrechtedialog.
- Quote paper
- Isabella Sternecker (Author), 2020, Die Entscheidung "Recht auf Vergessen I". Unionsgrundrechte als Prüfungsmaßstab für das Bundesverfassungsgericht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/931723