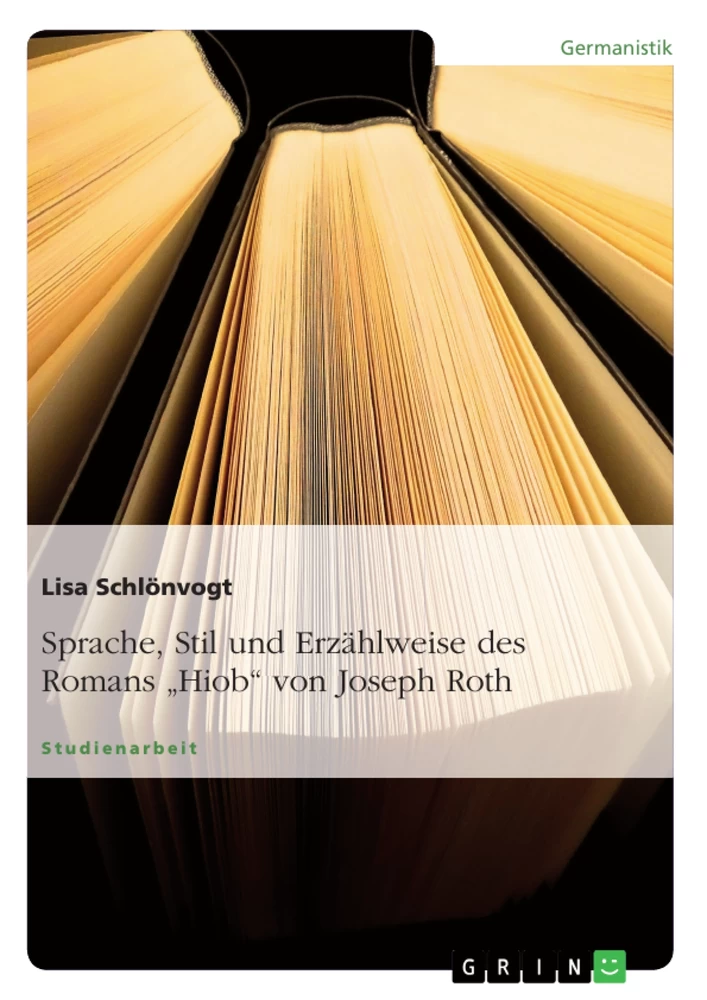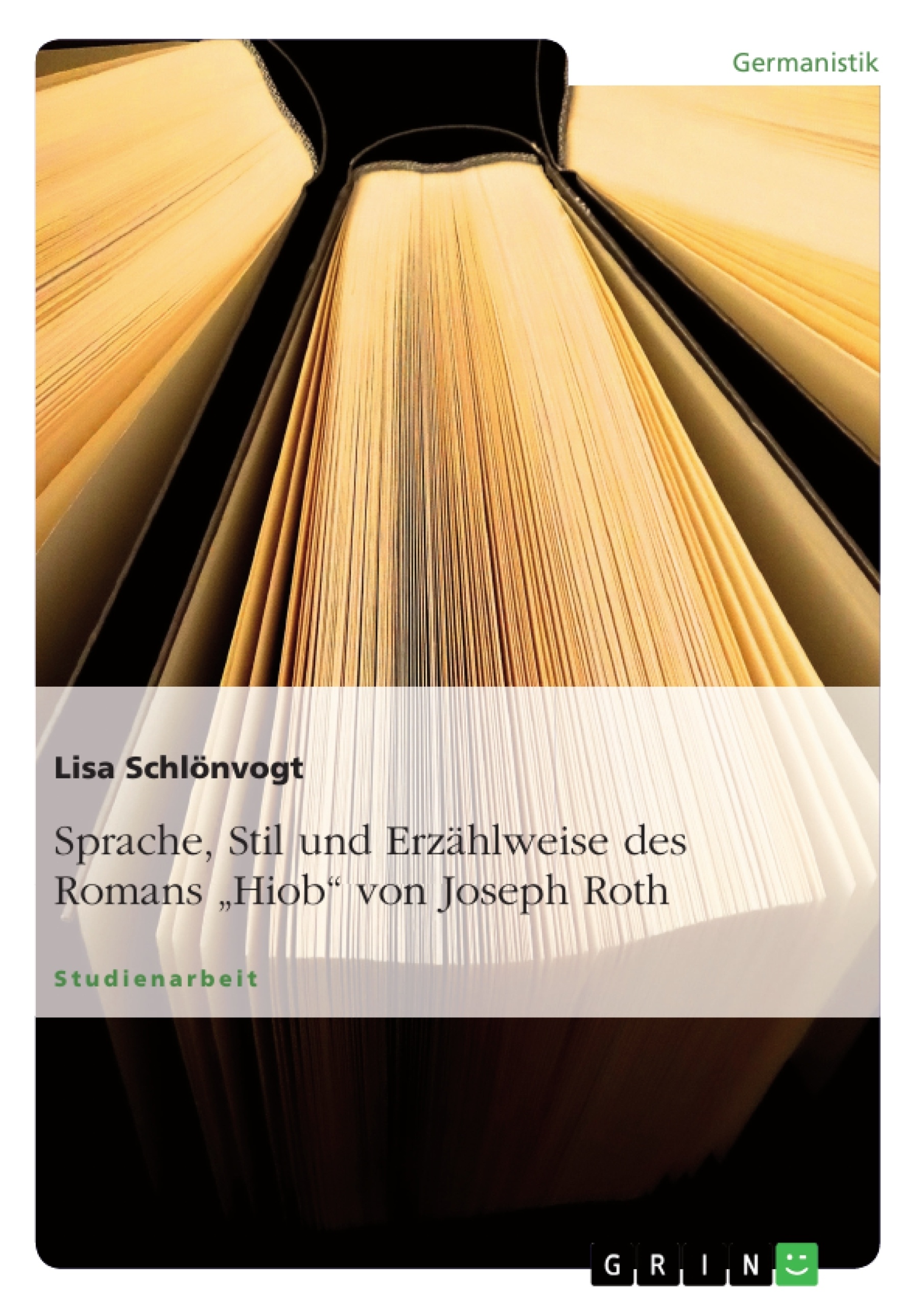Die Geschichte „eines einfachen Mannes“ liest sich leicht und engagiert und bewegt das Gemüt des Lesers. „Man schämt sich nicht [...] ganz sentimentalisch erschüttert zu sein,“ heißt es in Stefan Zweigs Hiob-Rezension. Beinahe jeder Autor versucht eben diese Wirkung bei seinen Lesern zu erreichen. Dabei hat jeder Autor seinen eigenen Stil, ja beinahe seine eigene Sprache. Joseph Roth, der selbst lange Zeit als Journalist gearbeitet hatte, stellte eine programmatische Forderung, die ihm selbst wohl bei jeder schriftstellerischen Arbeit gegenwärtig war: „Aus dem Vergehenden, dem Verwehenden, das Merkwürdige und zugleich das Menschlich-Bezeichnende festzuhalten, ist die Pflicht des Schriftstellers. Er hat die erhabene bescheidene Aufgabe, die privaten Schicksale aufzuklauben, welche die Geschichte fallen lässt. Blind und leichtfertig, wie es scheint.“
Während der thematische Stoff Roths bereits eine „sentimentale Erschütterung“ impliziert, weil es sich um menschliche Grundprobleme und Grundthemen handelt, muss jetzt lediglich noch die Sprache und der Stil dieser Grundstimmung angepasst werden.
Roth hat dabei einen ganz eigenen Stil. Viele seiner Kritiker beschreiben ihn als „Analytiker“ und „eminenten Beobachter“ (Hermann Kesten), seine Sprache als „immer wunderbar einfach, strahlend treffsicher [...] (Ulrich Greiner) und seine Werke „erlebt man statt zu lesen“ (Stefan Zweig).
In folgender Arbeit soll es nun darum gehen, eben diese Besonderheiten der Roth´schen Sprache und Erzählweise in dem Roman „Hiob“ (1930) zu analysieren und seinen Stil zu charakterisieren. Dabei sollen sowohl die Aspekte der Syntax und Wortwahl, der Erzählhaltung, der verwendeten stilistischen Mittel und der besonderen Sprache (Bezug zur Bibel und zu der Gattung Märchen) erörtert werden. Abschließend wird geprüft, ob sich in dem Roman „Hiob“ eine Einheit von Handlung, Zeit und Ort nachvollziehen lässt, was eigentlich ein typisches Merkmal des aristotelischen Dramas darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurze Inhaltsangabe einschließlich Aufbau
- Die einfache Sprache – Syntax und Wortwahl
- Der kunstvolle Stil
- Stilistische Mittel / Rhetorische Figuren
- Die Märchenhaftigkeit des Romans
- Einfluss der biblischen Sprache
- Die variable Erzählweise
- Sachliches Erzählen: Beobachten und Dokumentieren
- Perspektivenwechsel
- Einheit von Zeit, Ort und Handlung?
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Sprache und Erzählweise von Joseph Roths Roman „Hiob“ (1930) und charakterisiert seinen Stil. Dabei werden Aspekte wie Syntax und Wortwahl, Erzählhaltung, stilistische Mittel und die besondere Sprache (Bezug zur Bibel und zu der Gattung Märchen) erörtert. Abschließend wird untersucht, ob sich im Roman eine Einheit von Handlung, Zeit und Ort nachvollziehen lässt.
- Die besondere Sprache und Erzählweise von Joseph Roth
- Analyse der Syntax und Wortwahl in „Hiob“
- Stilistische Mittel und rhetorische Figuren
- Der Einfluss der biblischen Sprache und der Gattung Märchen
- Die Frage nach der Einheit von Handlung, Zeit und Ort
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bis 9 spielen in Zuchnow, der Heimat der jüdischen Familie Singer. Der Protagonist Mendel Singer erfährt Leid und Unglück: sein jüngstes Kind ist behindert, sein ältester Sohn wird zum Militärdienst eingezogen, die Tochter entwickelt eine krankhafte Neigung zu Männern.
Kapitel 9 ist ein Übergangskapitel, das die Ankunft der Familie in New York schildert.
Kapitel 10 bis 16 spielen in New York. Der Aufenthalt Mendel Singers in Amerika beginnt vielversprechend, doch bald wenden sich die Ereignisse wieder ins Unglück: Mendel bekommt Heimweh, der Erste Weltkrieg bricht aus, Jonas wird vermisst gemeldet und Schemarjah fällt als Soldat. Deborah, Mendels Frau, stirbt und Mirjam wird wahnsinnig. Mendel verliert seinen Glauben und wartet auf seinen Tod.
Doch dann geschieht das Wunder: der geheilte Menuchim kommt als erfolgreicher Dirigent nach New York und findet seinen Vater. Mendel kehrt dankbar zu seinem Glauben zurück.
Schlüsselwörter
Joseph Roth, „Hiob“, Sprache, Erzählweise, Stil, Syntax, Wortwahl, stilistische Mittel, biblische Sprache, Märchenhaftigkeit, Einheit von Zeit, Ort und Handlung, jüdische Familie, Leid, Unglück, Glaube, Amerika.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Joseph Roths Sprache in "Hiob"?
Seine Sprache wird als wunderbar einfach, strahlend treffsicher und zugleich tief sentimental erschütternd beschrieben.
Welche literarischen Einflüsse prägen den Stil des Romans?
Der Roman ist stark von der biblischen Sprache und der Gattung des Märchens beeinflusst, was ihm eine zeitlose, fast sakrale Qualität verleiht.
Worum geht es in der Handlung von "Hiob"?
Es ist die Geschichte von Mendel Singer, einem einfachen jüdischen Mann, der durch schwerste Schicksalsschläge seinen Glauben verliert, bevor ein "Wunder" ihn rettet.
Gibt es eine Einheit von Ort, Zeit und Handlung im Roman?
Die Arbeit untersucht dies kritisch, da die Handlung über viele Jahre hinweg von Russland (Zuchnow) nach New York wechselt, was eher gegen die klassischen aristotelischen Einheiten spricht.
Wie wird Mendel Singers Leben in Amerika dargestellt?
Sein Aufenthalt in New York beginnt hoffnungsvoll, mündet aber in tiefes Unglück durch den Ersten Weltkrieg, den Verlust seiner Familie und geistige Verzweiflung.
Was bedeutet "Märchenhaftigkeit" in diesem Kontext?
Es bezieht sich auf die Struktur der Erzählung und das unerwartete, wunderbare Ende, das an die Auflösung eines Märchens erinnert.
- Quote paper
- Lisa Schlönvogt (Author), 2008, Sprache, Stil und Erzählweise des Romans „Hiob“ von Joseph Roth, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93171