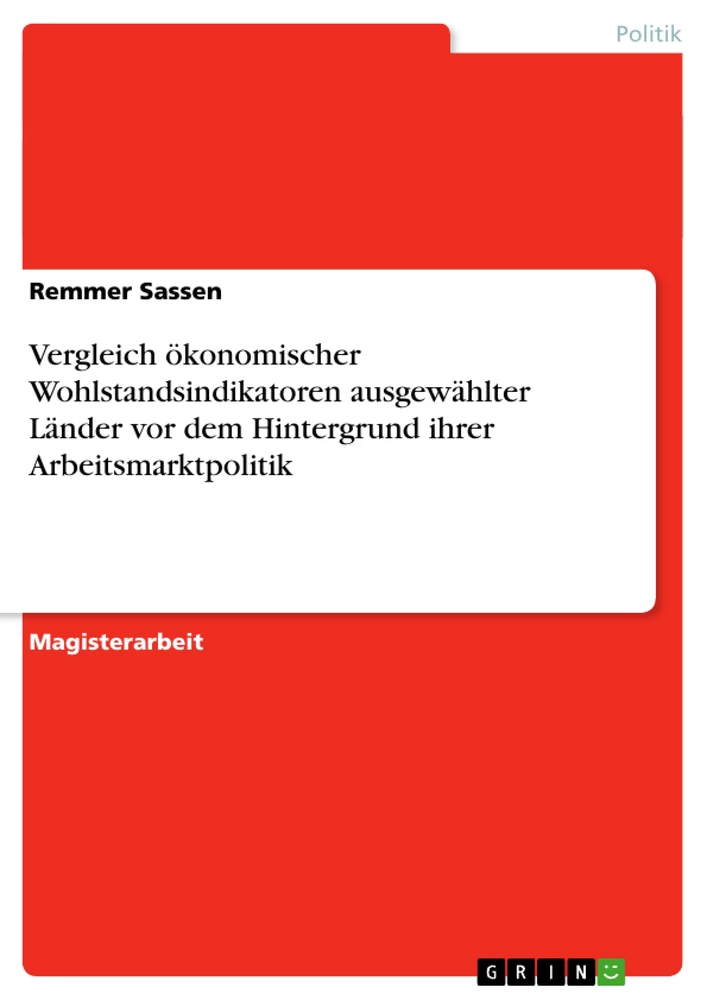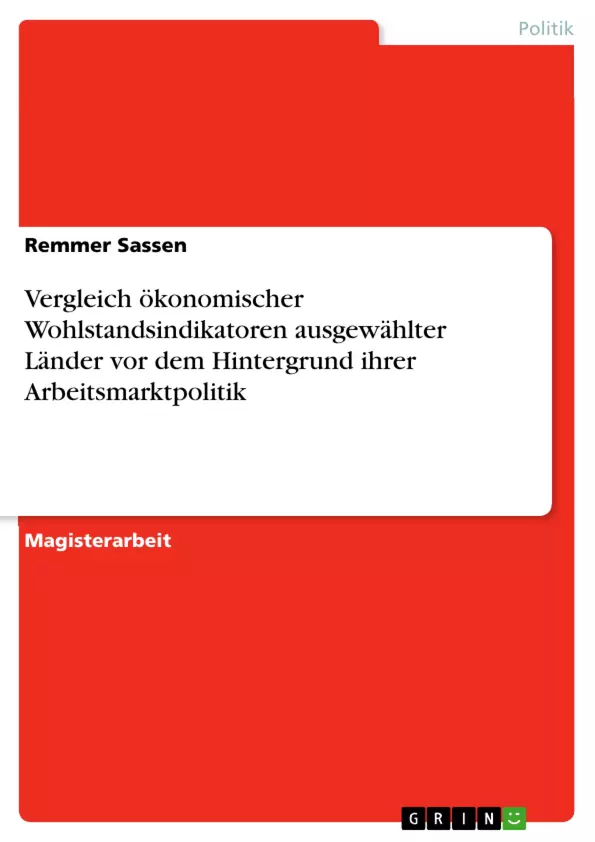„Sozial ist, was Arbeit schafft.“ Diese Aussage suggeriert, dass es den Betroffenen, also den Arbeitslosen, besser geht, wenn sie Arbeit haben. Dies erscheint einleuchtend und trifft in vielen Fällen wahrscheinlich auch zu. Dennoch lohnt es sich Entwicklungen auf Arbeitsmärkten mit der Wohlstandsentwicklung von Gesellschaften zu vergleichen, um diese These zu unterstützen oder ggf. zu entkräften. Ist es wirklich so, dass eine Minderung der Arbeitslosenzahlen zu einer Verbesserung der Wohlstandssituation führt? Anders formuliert: Hat eine bestimmte Arbeitsmarktpolitik mehr Wohlstand oder zumindest weniger Armut zur Folge? Denkbar wäre auch, dass die Wohlstandsentwicklung unabhängig von der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist. In diesem Fall könnte ein Auseinanderdriften der Schere zwischen Arm und Reich systembedingt sein.
Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit wird die Analyse ökonomischer Wohlstandsindikatoren und deren Wirkungszusammenhänge sein. Grundsätzlich sollte man annehmen, dass bei einer sinkenden Arbeitslosigkeit der Wohlstand einer Gesellschaft steigt bzw. im Umkehrschluss bei steigender Arbeitslosigkeit der Wohlstand einer Gesellschaft sinkt. Analog gilt dieser Zusammenhang für das Verhältnis zwischen der Arbeitslosigkeit und der Einkommensungleichheit. Dies führt unmittelbar zur Problematik der Verteilungsgerechtigkeit sowohl des Einkommens als auch des Vermögens.
Zur Beantwortung der Fragen wird ein Ländervergleich vorgenommen, um von Erfolgs- oder Misserfolgs-Modellen lernen zu können. Aus diesem Grund werden einerseits allgemein Tendenzen in den Entwicklungsländern und exemparisch aufgrund statistisch signifikant besserer Daten Tendenzen in den USA und in den Niederlanden betrachtet. In diesem Zusammenhang werden auch mögliche Ursachen von Arbeitslosigkeit aufgezeigt, um zu überprüfen, wie die Arbeitsmarktpolitik der ausgewählten Länder ausgerichtet ist und wie die Wirkung auf die Einkommensverteilung in diesen Ländern ist. Problematisch bleibt in diesem Zusammenhang sicherlich, dass mögliche Therapievorschläge zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in der öffentlichen Diskussion geradezu ideologisch missbraucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ökonomische Wohlstandsindikatoren
- 1.1. Wohlstandsmaße der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
- 1.1.1. Sozialproduktsbegriffe
- 1.1.2. Dreiseitenrechnung
- 1.2. Kritik an der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
- 1.3. Alternativkonzepte zur Wohlstandsmessung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
- 1.3.1. System sozialer Indikatoren
- 1.3.2. Korrekturen am Sozialprodukt
- 1.3.3. Indexmethode
- 1.4. Einkommensverteilung
- 1.4.1. Einkommensbegriffe
- 1.4.2. Verteilungsmaße
- 1.5. Armutskonzepte
- 1.5.1. Relative Armut
- 1.5.2. Absolute Armut
- 1.6. Vermögensverteilung
- 1.6.1. Vermögensbegriff
- 1.6.2. Vermögensbewertung
- 1.6.3. Verteilungsmaße
- 1.7. Arbeitsmarktindikatoren
- 1.1. Wohlstandsmaße der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
- 2. Empirische Fundierung der ökonomischen Wohlstandsindikatoren
- 2.1. BSP- bzw. BIP-abhängige Länderauswahl
- 2.1.1. OECD-Länder
- 2.1.2. Europäische Union
- 2.1.3. Die alte „Zweite und Dritte Welt“
- 2.2. Personelle Einkommensverteilung in den OECD-Ländern
- 2.2.1. Problematik empirischer Studien
- 2.2.2. Vergleich diverser internationaler Studien
- 2.3. Relative Armut in der Europäischen Union
- 2.4. Absolute Armut in den Ländern der alten „Zweiten und Dritten Welt“
- 2.5. Personelle Vermögensverteilung
- 2.6. Arbeitslosenquoten in den OECD-Ländern, der Europäischen Union und in den Ländern der alten „Zweiten und Dritten Welt“
- 2.1. BSP- bzw. BIP-abhängige Länderauswahl
- 3. Empirische Zusammenhänge zwischen den ökonomischen Wohlstandsindikatoren
- 3.1. Vorgehensweise zur Herstellung von Zusammenhängen
- 3.2. Einkommensverteilung und Arbeitslosenquoten in den OECD-Ländern
- 3.3. Armutsgefährdungsquote und Arbeitslosenquoten in der Europäischen Union
- 3.4. Ein-Dollar-Grenze, Gini-Koeffizient und Arbeitslosenquoten in der alten „Zweiten und Dritten Welt“
- 4. Untersuchung über den Zusammenhang zwischen der Arbeitsmarktpolitik und den ökonomischen Wohlstandsindikatoren in den USA und den Niederlanden
- 4.1. Ansätze zur Arbeitsmarktpolitik in der ökonomischen Theorie
- 4.1.1. Neoklassischer Ansatz
- 4.1.2. Keynesianischer Ansatz
- 4.2. Begründung der Länderauswahl
- 4.3. Arbeitsmarktpolitik in den USA
- 4.4. Einflüsse der Arbeitsmarktpolitik auf die Entwicklung der ökonomischen Wohlstandsindikatoren in den USA
- 4.5. Arbeitsmarktpolitik in den Niederlanden
- 4.4. Einflüsse der Arbeitsmarktpolitik auf die Entwicklung der ökonomischen Wohlstandsindikatoren in den Niederlanden
- 4.1. Ansätze zur Arbeitsmarktpolitik in der ökonomischen Theorie
- 5. Forschungsperspektiven
- 5.1. Verbesserung der Datengrundlage
- 5.2. Einkommensmobilität
- 5.3. Ökonomische Wechselwirkungen
- 5.4. Einkommensungleichheit und Wirtschaftswachstum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen ökonomischen Wohlstandsindikatoren und Arbeitsmarktpolitik in ausgewählten Ländern. Ziel ist es, verschiedene Wohlstandsmessungen zu vergleichen und deren Beziehung zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu analysieren.
- Vergleich verschiedener ökonomischer Wohlstandsindikatoren
- Analyse der Einkommens- und Vermögensverteilung
- Untersuchung von Armutskonzepten
- Beziehung zwischen Arbeitsmarktindikatoren und Wohlstand
- Einfluss der Arbeitsmarktpolitik auf ökonomische Wohlstandsindikatoren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ökonomische Wohlstandsindikatoren: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in verschiedene ökonomische Wohlstandsindikatoren, beginnend mit den Maßen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wie Sozialproduktbegriffen und der Dreiseitenrechnung. Es wird kritisch auf die Limitationen der VGR eingegangen und alternative Konzepte wie soziale Indikatoren, Korrekturen am Sozialprodukt und Indexmethoden vorgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einkommens- und Vermögensverteilung sowie verschiedenen Armutskonzepten (relative und absolute Armut), die mit detaillierten Definitionen und Messgrößen erläutert werden. Abschließend werden relevante Arbeitsmarktindikatoren definiert und in den Kontext der Wohlstandsmessung eingeordnet. Die Kapitelstruktur folgt einem logischen Aufbau, der von grundlegenden Definitionen zu komplexeren Konzepten und Kritikpunkten fortschreitet.
2. Empirische Fundierung der ökonomischen Wohlstandsindikatoren: Dieses Kapitel präsentiert die empirische Datenbasis der Arbeit. Es beschreibt die Auswahl der Länder basierend auf dem BIP bzw. BSP und gliedert diese in OECD-Länder, die Europäische Union und die Länder der „alten Zweiten und Dritten Welt“. Die Datenanalyse umfasst die personelle Einkommensverteilung in den OECD-Ländern, die relative Armut in der EU, die absolute Armut in den Entwicklungsländern, die personelle Vermögensverteilung und die Arbeitslosenquoten in allen betrachteten Ländergruppen. Die Kapitelstruktur ist systematisch und gliedert die empirischen Befunde nach den verschiedenen Indikatoren und Ländergruppen, wobei die Herausforderungen bei der Verwendung internationaler Vergleichsdaten angesprochen werden.
3. Empirische Zusammenhänge zwischen den ökonomischen Wohlstandsindikatoren: In diesem Kapitel werden die in Kapitel 2 präsentierten Daten analysiert, um Zusammenhänge zwischen den verschiedenen ökonomischen Wohlstandsindikatoren aufzuzeigen. Die Vorgehensweise zur Herstellung von Zusammenhängen wird detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf den Beziehungen zwischen Einkommensverteilung und Arbeitslosenquoten in den OECD-Ländern, Armutsgefährdungsquote und Arbeitslosenquoten in der EU sowie der Ein-Dollar-Grenze, dem Gini-Koeffizienten und den Arbeitslosenquoten in den Entwicklungsländern. Die Ergebnisse werden kritisch diskutiert und in den Kontext der bestehenden Literatur eingeordnet. Das Kapitel ist durch seine methodische Transparenz und die detaillierte Analyse der empirischen Zusammenhänge gekennzeichnet.
4. Untersuchung über den Zusammenhang zwischen der Arbeitsmarktpolitik und den ökonomischen Wohlstandsindikatoren in den USA und den Niederlanden: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Arbeitsmarktpolitik und ökonomischen Wohlstandsindikatoren anhand eines Ländervergleichs zwischen den USA und den Niederlanden. Es beginnt mit einer Darstellung neoklassischer und keynesianischer Ansätze der Arbeitsmarktpolitik und begründet die Auswahl der beiden Länder. Es werden die jeweiligen Arbeitsmarktpolitiken analysiert und deren Einflüsse auf die Entwicklung der ökonomischen Wohlstandsindikatoren detailliert untersucht. Der Vergleich der beiden Länder ermöglicht eine differenzierte Analyse der Wirkungsweisen unterschiedlicher arbeitsmarktpolitischer Strategien auf die Wohlstandsentwicklung. Die Kapitelstruktur ist systematisch und analysiert die beiden Länder nach einem einheitlichen Schema.
Schlüsselwörter
Ökonomische Wohlstandsindikatoren, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Einkommensverteilung, Vermögensverteilung, Armut, Arbeitsmarktpolitik, OECD-Länder, Europäische Union, Entwicklungsländer, Gini-Koeffizient, Arbeitslosenquote.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Ökonomische Wohlstandsindikatoren und Arbeitsmarktpolitik
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen ökonomischen Wohlstandsindikatoren und Arbeitsmarktpolitik in ausgewählten Ländern. Sie vergleicht verschiedene Wohlstandsmessungen und analysiert deren Beziehung zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen.
Welche ökonomischen Wohlstandsindikatoren werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet eine breite Palette an ökonomischen Wohlstandsindikatoren. Dies umfasst Maße der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) wie Sozialproduktbegriffe und die Dreiseitenrechnung. Darüber hinaus werden alternative Konzepte wie soziale Indikatoren, Korrekturen am Sozialprodukt und Indexmethoden berücksichtigt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einkommens- und Vermögensverteilung sowie verschiedenen Armutskonzepten (relative und absolute Armut) und Arbeitsmarktindikatoren.
Welche Länder werden in der Studie untersucht?
Die Länderauswahl basiert auf dem BIP bzw. BSP. Die Studie umfasst OECD-Länder, die Europäische Union und Länder der „alten Zweiten und Dritten Welt“. Ein detaillierter Ländervergleich wird zwischen den USA und den Niederlanden durchgeführt, um den Einfluss unterschiedlicher Arbeitsmarktpolitiken zu analysieren.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet sowohl deskriptive als auch analytische Methoden. Kapitel 2 präsentiert die empirische Datenbasis, während Kapitel 3 Zusammenhänge zwischen verschiedenen ökonomischen Wohlstandsindikatoren aufzeigt. Kapitel 4 untersucht den Zusammenhang zwischen Arbeitsmarktpolitik und ökonomischen Wohlstandsindikatoren mittels eines Ländervergleichs zwischen den USA und den Niederlanden. Die Vorgehensweise zur Herstellung von Zusammenhängen wird detailliert beschrieben.
Welche sind die zentralen Ergebnisse der Studie?
Die zentralen Ergebnisse der Studie zeigen Zusammenhänge zwischen verschiedenen ökonomischen Wohlstandsindikatoren auf (z.B. Einkommensverteilung und Arbeitslosenquoten). Der Ländervergleich zwischen den USA und den Niederlanden analysiert den Einfluss unterschiedlicher Arbeitsmarktpolitiken auf die Entwicklung der ökonomischen Wohlstandsindikatoren. Die spezifischen Ergebnisse sind detailliert in den Kapiteln 2, 3 und 4 dargestellt.
Welche Limitationen weist die Studie auf?
Die Arbeit thematisiert die Problematik der Verwendung internationaler Vergleichsdaten und mögliche Limitationen der verwendeten Wohlstandsindikatoren. Die Auswahl der Länder und die spezifischen Indikatoren beeinflussen die Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Weiterführende Forschungsperspektiven werden in Kapitel 5 diskutiert.
Welche Forschungsperspektiven werden aufgezeigt?
Zukünftige Forschung sollte sich auf die Verbesserung der Datengrundlage, die Untersuchung der Einkommensmobilität, die Analyse ökonomischer Wechselwirkungen und den Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Wirtschaftswachstum konzentrieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Ökonomische Wohlstandsindikatoren, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Einkommensverteilung, Vermögensverteilung, Armut, Arbeitsmarktpolitik, OECD-Länder, Europäische Union, Entwicklungsländer, Gini-Koeffizient, Arbeitslosenquote.
- Quote paper
- Remmer Sassen (Author), 2006, Vergleich ökonomischer Wohlstandsindikatoren ausgewählter Länder vor dem Hintergrund ihrer Arbeitsmarktpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93100