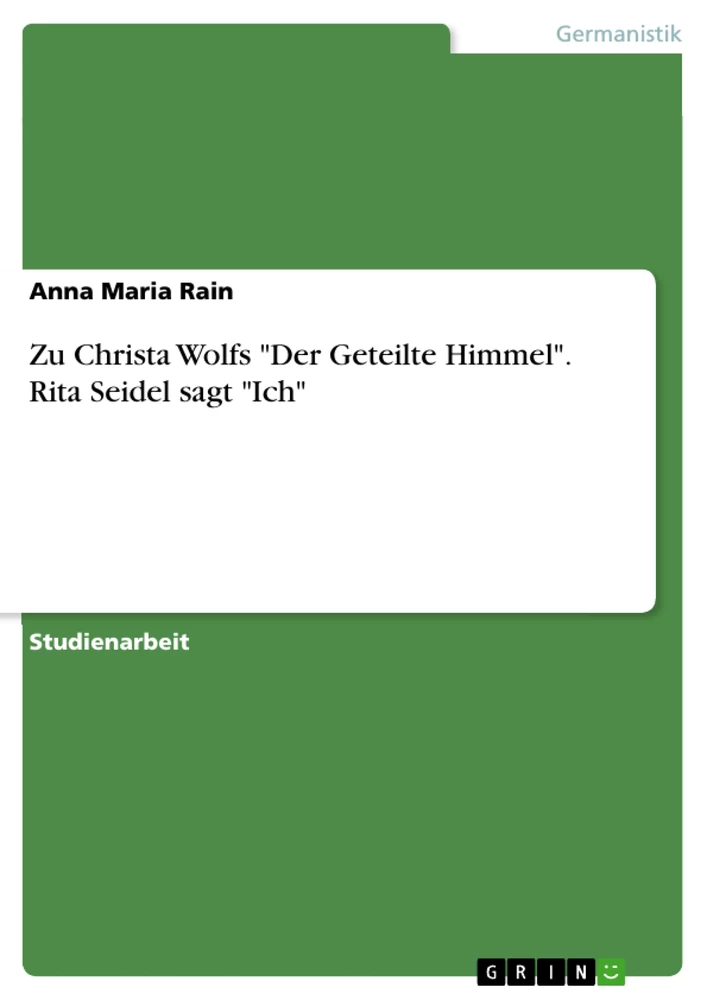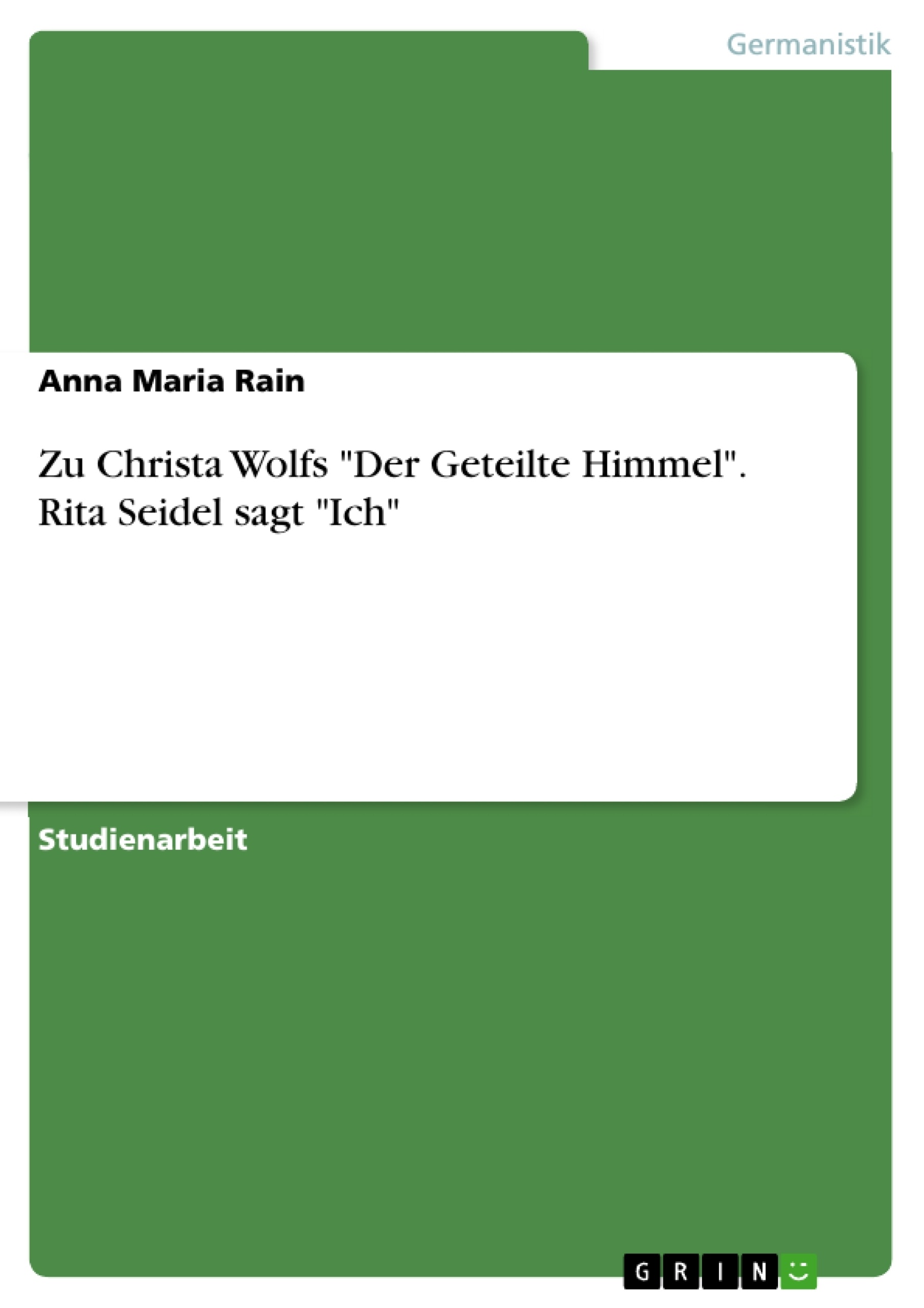Christa Wolfs Der geteilte Himmel, eines ihrer frühen Werke und ihr Durchbruch in West und Ost, ist eine Erzählung, die ihre wahren Inhalte mehr verrät als eigentlich erzählt. Erzählt wird von Rita, die in der Stadt erwachsen werden soll und muss, will sie dem Leben standhalten. Verraten wird Interessanteres: Wolfs politische und gesellschaftliche Ideologie, um nicht zu sagen: Utopie; des weiteren, wie die Autorin Subjekt und Subjektwerdung definiert, und schließlich, worin die Heilsversprechung für den Menschen und speziell für die Frau ihre Erfüllung findet. Aus heutiger Perspektive auf die Geschichte der DDR ist es einfach, die Erzählung als Produkt politischer Verblendung abzutun. Sie ist jedoch mehr als das, muss sicherlich auch als ehrlicher Versuch gelesen werden, dem Sozialismus eine (logische oder emotionale) Rechtfertigung zu verschaffen, und wenigstens das muss ihr zu Gute gehalten werden. Dass sie dabei manipulativ vorgeht, ist verzeihbar, das kann immerhin als ein Vorrecht der Literatur gelten. Dass die so sorgfältig zusammengezimmerte Logik allerdings, auf der die Legitimation beruht, nicht stringent, also gar nicht logisch im eigentlichen Sinne ist und notwendig zu einer anderen als der gewünschten Schlussfolgerung führt, verrät die Schwachstelle: wenn anstelle der logischen die gewünschte Schlussfolgerung steht, oder anders, wenn die gewünschte nicht die sich logisch ergebende Schlussfolgerung ist, hat die Argumentation versagt. Gerade für eine Erzählung, die sich als derart missionarisch herausstellt, ist dies ein verheerender Mangel, auch ein ästhetischer. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort und Nachwort als Metanarrativ
- Rita in der Stadt: Suche nach Orientierung und Identität
- Ritas Krise: Psychologische und feministische Aspekte
- Ritas Wissen: Intuition und das Unheimliche
- Ritas Zusammenbruch und die Mauer
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Christa Wolfs "Der geteilte Himmel" unter besonderer Berücksichtigung der Figur Rita Seidel. Die Zielsetzung besteht darin, die narrative Logik des Romans zu untersuchen und aufzuzeigen, wie Ritas Entwicklung und ihr Scheitern zur zentralen Aussage des Werkes beitragen. Die Analyse berücksichtigt dabei psychologische, feministische und gesellschaftlich-politische Aspekte.
- Ritas Suche nach Identität und Selbstbestimmung in der geteilten Gesellschaft
- Das Verhältnis zwischen individueller Erfahrung und politischer Ideologie
- Die Darstellung von Weiblichkeit und die Rolle der Frau im sozialistischen Kontext
- Die Grenzen der Erzählbarkeit und die Unzuverlässigkeit der Erinnerung
- Die Funktion von Intuition und dem Unbewussten in Ritas Erfahrungswelt
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort und Nachwort als Metanarrativ: Die Rahmenerzählung aus Vorwort und Nachwort bildet ein Metanarrativ, das auf das abstrakte Leben rekurriert und einen frühromantischen Meta-Mythos installiert. Das Vorwort beschreibt abgewendete Gefahren und die Rückversicherung des normalen Lebens durch den Naturkreislauf. Das Nachwort wiederholt diese Rückversicherung, die nun als "erarbeitet" gilt. Die Gefahr ist gebannt durch die relative Unmöglichkeit des Ausgehens des "seltsamen Stoffes Leben".
Rita in der Stadt: Suche nach Orientierung und Identität: Der Roman beschreibt Ritas Ankunft in der Stadt als eine Erfahrung der emotionalen Fremde. Das vertraute Dorf steht im Kontrast zur urbanen Anonymität. Manfred dient als Orientierungshilfe, ermöglicht Rita den Zugang zur Stadt und zu sich selbst. Ihre Abhängigkeit von ihm wird jedoch als problematisch dargestellt, da sie ihre Selbstständigkeit beeinträchtigt. Ritas Sehnsucht nach Harmonie und Einheit mit der Welt und mit Manfred ist in der Stadt als Unmöglichkeit angelegt.
Ritas Krise: Psychologische und feministische Aspekte: Ritas Krise wird entlang der Linien des Erwachsenwerdens als Bruch- und Verlusterfahrung dargestellt. Der Roman beleuchtet psychologische und feministische Fragen, die sich nicht auf einfache Heimat-Fremde-Gegensätze reduzieren lassen. Ritas Beziehung zu Manfred ist von Abhängigkeit geprägt, Manfred reflektiert Rita zwar, erklärt ihr aber auch, was sie sieht, anstatt eine einfache Spiegelung zu bieten. Die Beziehung wird als schädlich dargestellt, da Manfreds Verzweiflung Ritas optimistische Ideale beeinträchtigt.
Ritas Wissen: Intuition und das Unheimliche: Rita verfügt über ein ungewöhnliches Wissen um die menschliche Natur und kommende Ereignisse. Dieses Wissen wird als Mischung aus verdrängtem Wissen und einer mystischen Komponente beschrieben. Die Rückkehr des verdrängten Wissens manifestiert sich als "unheimlich", während der andere Teil des Wissens eher esoterisch wirkt. Der Text lässt Raum für Interpretationen, ob Ritas Wissen aus einer "external reality", unterbewusstem Wissen oder gar einem mystischen Einfluss resultiert.
Ritas Zusammenbruch und die Mauer: Ritas Zusammenbruch wird durch verschiedene Faktoren herbeigeführt, darunter die zunehmende Sprachlosigkeit, Erschöpfung und ein Übermaß an Trauer. Die Abwesenheit der Mauer im Text wird als strukturelles Element interpretiert, welches Ritas Wahrnehmung der Welt und die Entwicklung ihres Selbstverständnisses prägt. Nach ihrer Krise erlangt Rita eine neue Klarheit, die als Überwindung der Krise und Erwachsenwerden interpretiert wird. Der Verlust, den sie mit diesem neuen Selbstgefühl verbindet, ist nicht nur der Verlust der Liebe, sondern auch der Verlust eines Teils ihrer selbst als Bedingung der Ich-Werdung.
Schlüsselwörter
Christa Wolf, Der geteilte Himmel, Rita Seidel, Identitätssuche, Selbstbestimmung, Sozialismus, DDR, Heimat, Fremde, Psychologie, Feminismus, Erinnerung, Unheimliches, Mauerbau, Ich-Werdung, Abhängigkeit, Menschwerdung.
Häufig gestellte Fragen zu Christa Wolfs "Der geteilte Himmel"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über Christa Wolfs Roman "Der geteilte Himmel". Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung der Analyse, eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Figur Rita Seidel und ihrer Entwicklung im Roman.
Welche Themen werden im Roman "Der geteilte Himmel" behandelt?
Der Roman behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter Ritas Suche nach Identität und Selbstbestimmung in der geteilten Gesellschaft der DDR, das Verhältnis zwischen individueller Erfahrung und politischer Ideologie, die Darstellung von Weiblichkeit im sozialistischen Kontext, die Grenzen der Erzählbarkeit und die Unzuverlässigkeit der Erinnerung, sowie die Rolle von Intuition und dem Unbewussten in Ritas Leben. Psychologische und feministische Aspekte spielen eine zentrale Rolle.
Wie wird die Figur Rita Seidel im Roman dargestellt?
Rita Seidel ist die zentrale Figur des Romans. Ihre Ankunft in der Stadt wird als Erfahrung der emotionalen Fremde beschrieben. Ihre Beziehung zu Manfred ist von Abhängigkeit geprägt. Der Roman zeigt Ritas Krise und ihren Zusammenbruch, aber auch ihren Weg zur Selbstfindung und ihre Entwicklung als Persönlichkeit. Ihre Intuition und ihr Zugang zu einem ungewöhnlichen Wissen um menschliche Natur und zukünftige Ereignisse spielen eine wichtige Rolle.
Welche Rolle spielt die Mauer im Roman?
Die Mauer ist zwar nicht physisch im Roman präsent, hat aber dennoch einen starken Einfluss auf Ritas Wahrnehmung der Welt und die Gestaltung ihrer Identität. Die Abwesenheit der Mauer als konkretes Element wird als strukturelles Moment interpretiert, das Ritas Selbstverständnis beeinflusst.
Welche Kapitel umfasst die Zusammenfassung?
Die Zusammenfassung umfasst die folgenden Kapitel: Vorwort und Nachwort als Metanarrativ, Rita in der Stadt: Suche nach Orientierung und Identität, Ritas Krise: Psychologische und feministische Aspekte, Ritas Wissen: Intuition und das Unheimliche, Ritas Zusammenbruch und die Mauer, und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Roman?
Schlüsselwörter, die den Roman beschreiben, sind: Christa Wolf, Der geteilte Himmel, Rita Seidel, Identitätssuche, Selbstbestimmung, Sozialismus, DDR, Heimat, Fremde, Psychologie, Feminismus, Erinnerung, Unheimliches, Mauerbau, Ich-Werdung, Abhängigkeit, Menschwerdung.
Was ist die Zielsetzung der Analyse in der HTML-Datei?
Die Zielsetzung der Analyse ist es, die narrative Logik von "Der geteilte Himmel" zu untersuchen und aufzuzeigen, wie Ritas Entwicklung und ihr Scheitern zur zentralen Aussage des Werkes beitragen. Die Analyse berücksichtigt psychologische, feministische und gesellschaftlich-politische Aspekte.
Wie wird das Vorwort und das Nachwort interpretiert?
Das Vorwort und das Nachwort werden als Metanarrativ interpretiert, welches auf das abstrakte Leben rekurriert und einen frühromantischen Meta-Mythos installiert. Sie beschreiben abgewendete Gefahren und die Rückversicherung des normalen Lebens durch den Naturkreislauf.
- Quote paper
- Anna Maria Rain (Author), 2007, Zu Christa Wolfs "Der Geteilte Himmel". Rita Seidel sagt "Ich", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93071