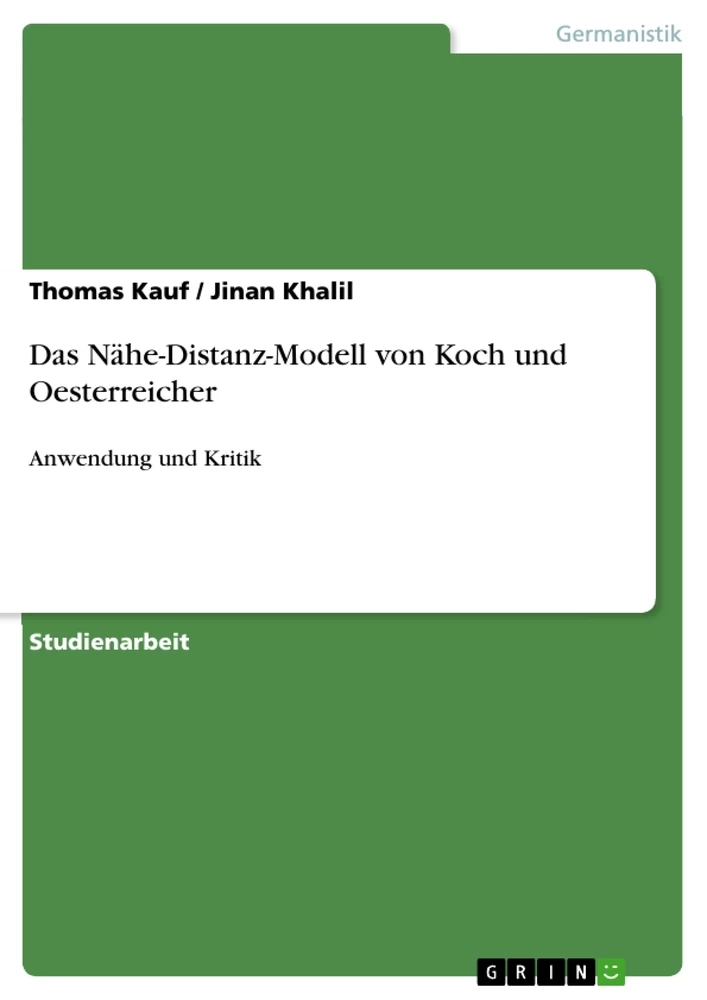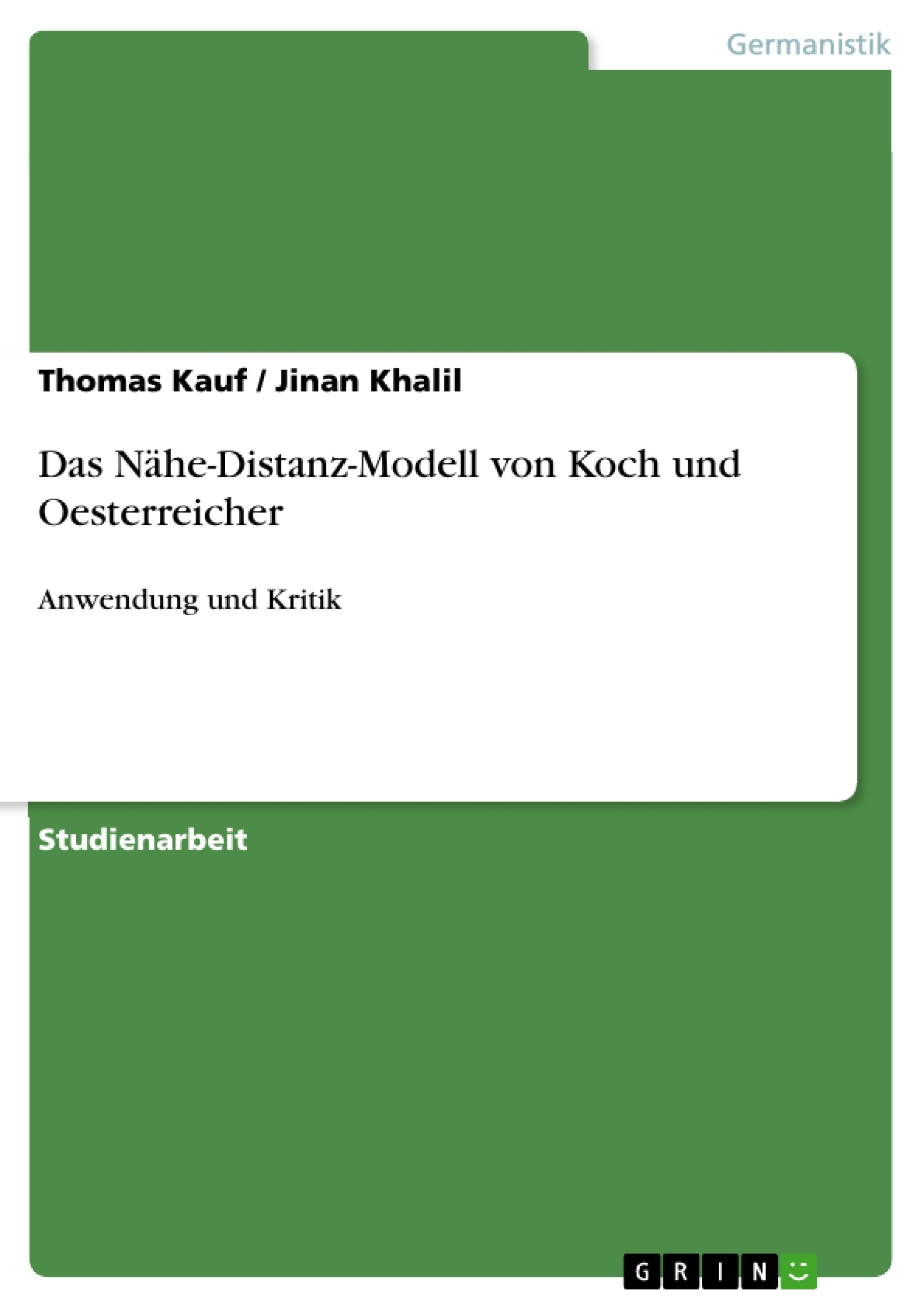Bei der sprachwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Texten spielt die Unterscheidung zwischen konzeptionell geschriebener und konzeptionell gesprochener Sprache eine grundlegende Rolle. Im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst das diese Unterscheidung thematisierende Modell sprachlicher Nähe und Distanz von Koch und Oesterreicher umrissen. Daran anschließend wird als Beispiel für die praktische Nutzung dieses Modells eine Darstellung der Monographie „Textgliederung. Einheitenbildung im geschriebenen und gesprochenen Deutsch“ von Stephan Stein gegeben, in der die Theorie von Koch und Oesterreicher als Basis der weitergehenden Untersuchung von Textgliederungsmitteln und Texteinheiten dient.
Schließlich wird die Monographie „Grammatik aus Nähe und Distanz. Theorie und Praxis am Beispiel von Nähetexten 1650 – 2000“ von Vilmos Ágel und Mathilde Hennnig vorgestellt, in der das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher diskutiert und auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse ein differenzierteres Modell entworfen wird. Als Grundlage dieser Arbeit dienten die beiden angesprochenen Monographien sowie der Aufsatz „Schriftlichkeit und Sprache“ von Peter Koch und Wulf Oesterreicher.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Modell von Koch und Oesterreicher: Schriftlichkeit als Medium und Konzept
- 3. Anwendung des Konzepts durch Stephan Stein
- 3.1 Übersicht
- 3.2 Darstellung des Inhalts
- 3.2.1 Grundlagen
- 3.2.2 Textgliederung unter Bedingungen kommunikativer Distanz
- 3.2.3 Textgliederung unter Bedingungen kommunikativer Nähe
- 3.2.4 Bilanz
- 4. Kritik des Konzepts
- 4.1 „Grammatik aus Nähe und Distanz“ von Vilmos Ágel und Mathilde Hennig
- 4.2 Ausgangspunkt
- 4.3 Kritik am Modell von Koch/Oesterreicher und anderen Ansätzen
- 4.4 Das Modell des Nähe- und Distanzsprechens
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher zur Unterscheidung von konzeptionell mündlicher und schriftlicher Sprache. Sie analysiert die Anwendung des Modells in der Praxis anhand von Stephan Steins Monographie zur Textgliederung und kritisch anhand der Arbeit von Ágel und Hennig. Das Ziel ist es, das Modell zu verstehen, seine Anwendung zu veranschaulichen und seine Stärken und Schwächen zu beleuchten.
- Das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher
- Anwendung des Modells in der Textanalyse
- Kritik und Weiterentwicklung des Modells
- Konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- Textgliederung im geschriebenen und gesprochenen Deutsch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sprachwissenschaftlichen Unterscheidung zwischen konzeptionell mündlicher und schriftlicher Sprache ein. Sie stellt das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher als zentralen Gegenstand der Arbeit vor und kündigt die Analyse von Stephan Steins Monographie zur Textgliederung sowie die kritische Auseinandersetzung mit dem Modell anhand der Arbeit von Ágel und Hennig an. Die Einleitung bettet die Arbeit in den Kontext der sprachwissenschaftlichen Forschung ein und umreißt die methodische Vorgehensweise.
2. Das Modell von Koch und Oesterreicher: Schriftlichkeit als Medium und Konzept: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das von Koch und Oesterreicher entwickelte Nähe-Distanz-Modell. Es erläutert die Unterscheidung zwischen medialem und konzeptionellem Aspekt von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, wobei letztere als ein Kontinuum dargestellt wird. Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Parameter, die konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit bestimmen, wie räumlich-zeitliche Nähe oder Distanz, Öffentlichkeit, Vertrautheit und Emotionalität. Es wird zudem die Unterscheidung zwischen drei Ebenen der sprachtheoretischen Analyse (universal, historisch, aktuell) eingeführt. Die zentrale Argumentation liegt in der Komplexität des Begriffspaares "mündlich" und "schriftlich", das über eine simple mediale Unterscheidung hinausgeht und komplexe konzeptionelle Aspekte umfasst.
3. Anwendung des Konzepts durch Stephan Stein: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Anwendung des Nähe-Distanz-Modells in Stephan Steins Monographie "Textgliederung". Es gibt eine Übersicht über Steins Arbeit, die sich in vier Teile gliedert und die Gliederungsmittel und -einheiten in geschriebenen und gesprochenen Texten untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Anwendung des Modells als theoretische Grundlage für die Analyse verschiedener Textsorten und -typen. Die Zusammenfassung beschreibt, wie Stein das Modell nutzt um Unterschiede in der Textgliederung unter Bedingungen kommunikativer Nähe und Distanz zu untersuchen und wie er damit die verschiedenen Gliederungseinheiten analysiert. Die Diskussion der unterschiedlichen Handhabung konzeptionell geschriebener und gesprochener Texte in Bezug auf Gliederungseinheiten wird hervorgehoben.
4. Kritik des Konzepts: Dieses Kapitel präsentiert eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nähe-Distanz-Modell, unter Einbezug der Arbeit von Ágel und Hennig. Es wird der Ausgangspunkt der Kritik erläutert und die Argumentationslinien von Ágel und Hennig dargestellt, die ein differenzierteres Modell entwickeln. Das Kapitel vergleicht kritisch das Modell von Koch/Oesterreicher mit anderen Ansätzen und zeigt die Stärken und Schwächen des ursprünglichen Modells auf. Ein wichtiger Aspekt der Kritik ist die Darstellung des alternativen Modells und die Begründung für dessen Notwendigkeit. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit den Limitationen des ursprünglichen Modells und den vorgeschlagenen Verbesserungen.
Schlüsselwörter
Nähe-Distanz-Modell, Koch und Oesterreicher, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, konzeptionelle Mündlichkeit, konzeptionelle Schriftlichkeit, Textgliederung, Stephan Stein, Vilmos Ágel, Mathilde Hennig, Kommunikationsanalyse, Sprachwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher zur Unterscheidung von konzeptionell mündlicher und schriftlicher Sprache. Sie analysiert die Anwendung dieses Modells anhand von Stephan Steins Monographie zur Textgliederung und kritisch anhand der Arbeit von Ágel und Hennig. Ziel ist das Verständnis, die Veranschaulichung der Anwendung und die Beleuchtung der Stärken und Schwächen des Modells.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher, seine Anwendung in der Textanalyse (am Beispiel von Stephan Stein), Kritik und Weiterentwicklung des Modells, konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit sowie Textgliederung im geschriebenen und gesprochenen Deutsch.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Darstellung des Modells von Koch und Oesterreicher, Anwendung des Modells bei Stephan Stein (inkl. Unterkapitel zu Grundlagen, Textgliederung unter Bedingungen kommunikativer Distanz und Nähe sowie einer Bilanz), Kritik des Konzepts (inkl. Auseinandersetzung mit Ágel und Hennig und deren alternativem Modell) und Schlussfolgerung. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Was ist das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher?
Das Modell unterscheidet zwischen medialem und konzeptionellem Aspekt von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Konzeptionelle Schriftlichkeit wird als Kontinuum dargestellt, bestimmt durch Parameter wie räumlich-zeitliche Nähe/Distanz, Öffentlichkeit, Vertrautheit und Emotionalität. Es berücksichtigt drei Ebenen der sprachtheoretischen Analyse: universal, historisch, aktuell. Der Fokus liegt auf der Komplexität des Begriffspaares "mündlich" und "schriftlich" über eine simple mediale Unterscheidung hinaus.
Wie wird das Modell von Stephan Stein angewendet?
Stephan Stein wendet das Modell in seiner Monographie zur Textgliederung an. Die Arbeit analysiert Gliederungsmittel und -einheiten in geschriebenen und gesprochenen Texten und untersucht Unterschiede in der Textgliederung unter Bedingungen kommunikativer Nähe und Distanz. Stein nutzt das Modell als theoretische Grundlage zur Analyse verschiedener Textsorten und -typen.
Welche Kritik wird am Modell von Koch und Oesterreicher geübt?
Die Arbeit von Ágel und Hennig übt Kritik am Modell von Koch und Oesterreicher. Ihre Kritikpunkte und ein alternatives, differenzierteres Modell werden ausführlich dargestellt und mit dem ursprünglichen Modell verglichen. Die Diskussion konzentriert sich auf die Limitationen des ursprünglichen Modells und die vorgeschlagenen Verbesserungen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Nähe-Distanz-Modell, Koch und Oesterreicher, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, konzeptionelle Mündlichkeit, konzeptionelle Schriftlichkeit, Textgliederung, Stephan Stein, Vilmos Ágel, Mathilde Hennig, Kommunikationsanalyse, Sprachwissenschaft.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die zentralen Inhalte und Argumentationslinien jedes Abschnitts beschreibt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler und Studierende der Sprachwissenschaft, die sich mit der Unterscheidung zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache, Textanalyse und Kommunikationsmodellen auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Thomas Kauf (Autor:in), Jinan Khalil (Autor:in), 2006, Das Nähe-Distanz-Modell von Koch und Oesterreicher, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93024