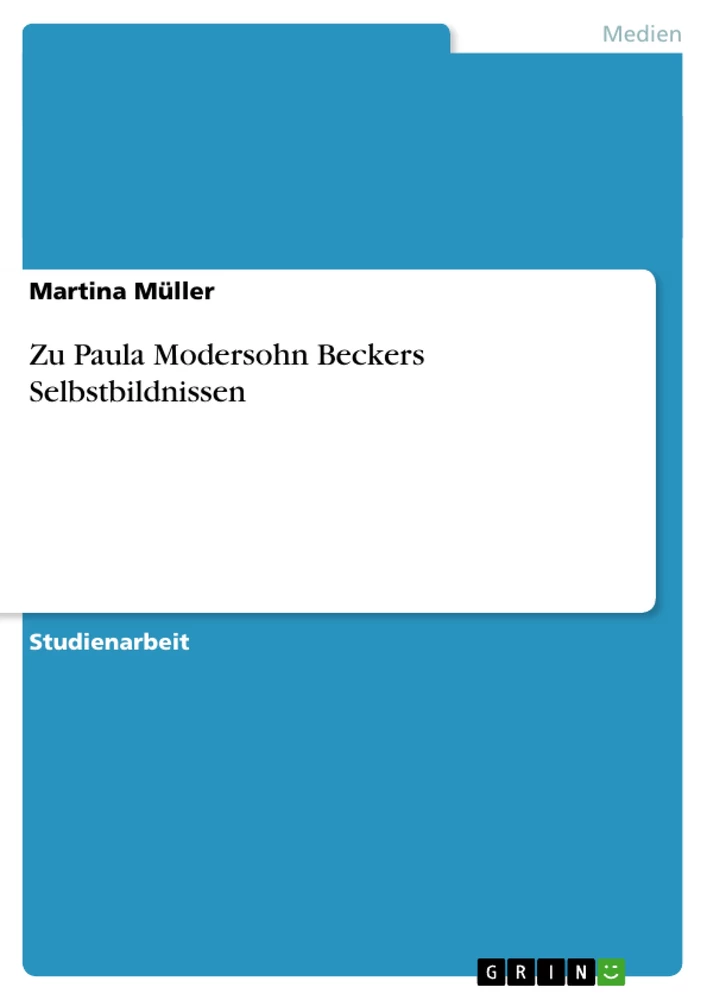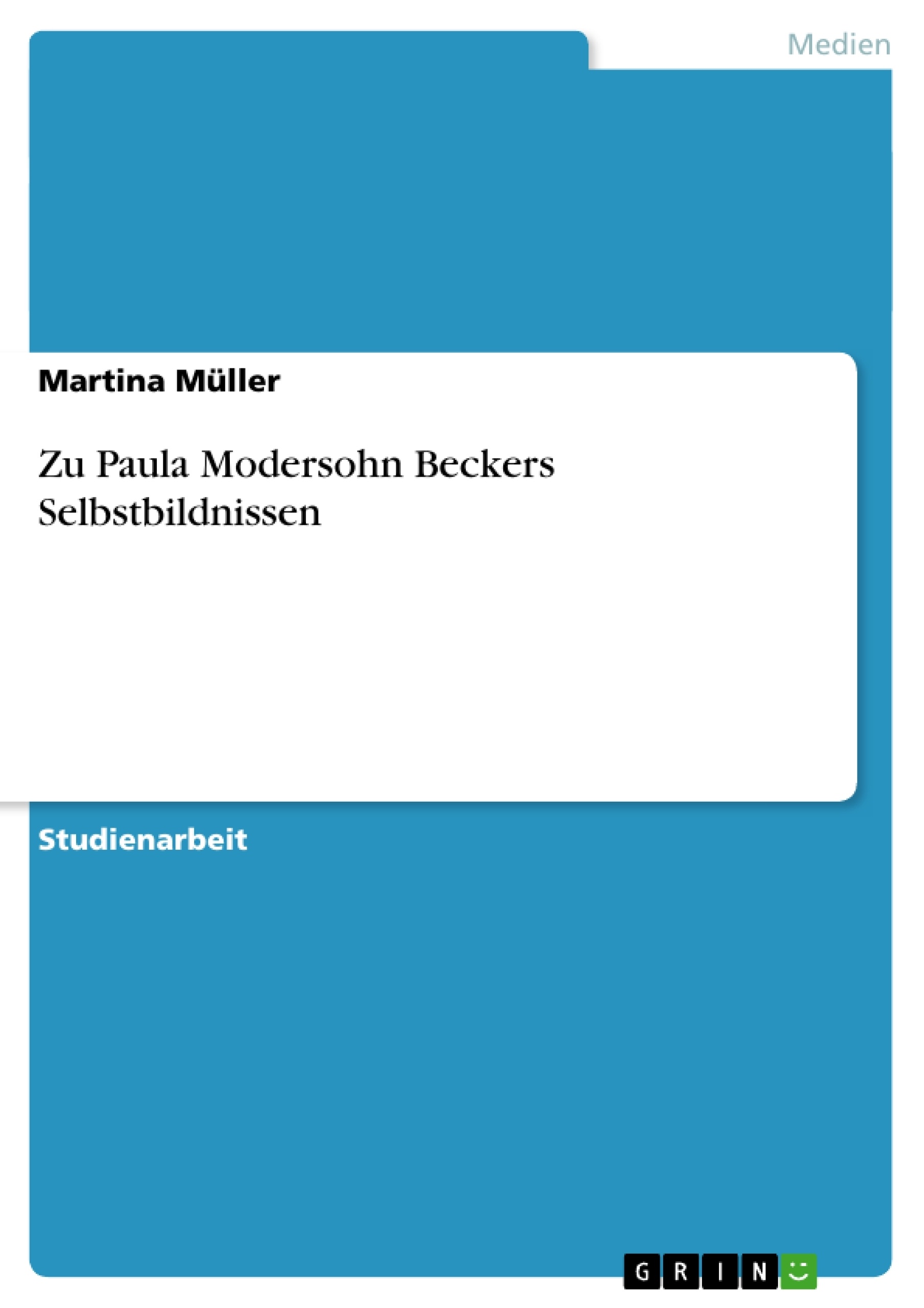Die vorliegende Arbeit befasst sich mit drei ausgewählten Selbstbildnissen der Künstlerin Paula Modersohn-Becker: „Selbstbildnis vor blühenden Bäumen“ von 1902, „Selbstbildnis“ von 1906 und „Selbstbildnis mit Kamelienzweig“ von 1907. Eine kurze Einführung in die Gattungsmerkmale der Porträtmalerei und die Besonderheiten des Selbstbildnisses bilden den Ausgangspunkt der folgenden Werkanalyse und führen auf die leitende Hauptfragestellung hin, ob es sich um autonome Porträtdarstellungen handelt.
Das Porträt thematisiert die Darstellung eines oder mehrerer Menschen mit der Zielsetzung, eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Werk und den porträtierten Personen herzustellen. Der Abbildcharakter allein genügt aber nicht als hinreichendes Kriterium zur Bestimmung eines Porträts. Um zu einer genaueren Bestimmung des Porträtbegriffes zu gelangen, sollte auch die Frage der Porträtindividualität untersucht werden. Im Verlauf der historischen Entwicklungen wurde immer mehr zum Ziel der Darstellung, die individuelle Persönlichkeit und die Seele des Menschen im Bild sichtbar zu machen. Mit der zunehmenden autonomen Stellung des Künstlers, bekam dieser auch mehr Gestaltungsfreiheit und konnte zusätzlich individuelle Vorstellungen in das Bild einbauen. Eine Besonderheit beim Selbstporträt ist die Tatsache, dass Darstellender und Dargestellter ein und dieselbe Person ist. Das ist mithin das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zum Porträt.
Da es zahlreiche Selbstbildnisse von Paula Modersohn-Becker gibt, kann man davon ausgehen, dass in diesen Gemälden Wandlungen ihrer Person zum Ausdruck gebracht werden.
Vor diesen Gesichtspunkten sollen drei Selbstbildnisse der Malerin Paula Modersohn-Becker näher beschrieben und untersucht werden. Als erstes werden die Bilder auf der vorikonographischen Ebene beschrieben. Danach erfolgt die Beschreibung auf der ikonographischen Ebene, die sich mit dem Bedeutungsgehalt der einzelnen Bildelemente befasst und anschließend Beschreibungen auf der ikonischen Ebene. In einem Vergleich werden die Bilder gegenübergestellt und Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet.
Bei der Beschreibung und Analyse von Bildnissen stellt sich die Frage, um welche Art der Porträtdarstellung es sich genau handelt. Zu untersuchen wäre, ob man bei den Selbstbildnissen der Malerin Paula Modersohn-Becker von Individualporträts sprechen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung in die Thematik
- 2. Selbstbildnis vor blühenden Bäumen (1902)
- 2.1 Vorikonographische Beschreibung
- 2.2 Ikonographische Beschreibung und Ikonik
- 3. Selbstbildnis (1906)
- 3.1 Vorikonographische Beschreibung
- 3.2 Ikonographische Beschreibung und Ikonik
- 4. Selbstbildnis mit Kamelienzweig (1907)
- 4.1 Vorikonographische Beschreibung
- 4.2 Ikonographische Beschreibung und Ikonik
- 5. Vergleich der Selbstbildnisse
- 6. Bildanalyse in Hinblick auf die formulierte Fragestellung
- 7. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert drei ausgewählte Selbstbildnisse von Paula Modersohn-Becker, um deren künstlerische Entwicklung und die Frage nach der Autonomie dieser Porträtdarstellungen zu untersuchen. Die Analyse betrachtet vorikonographische, ikonographische und ikonische Ebenen der Bilder.
- Entwicklung der künstlerischen Darstellung bei Paula Modersohn-Becker
- Analyse der ikonographischen Elemente in den Selbstbildnissen
- Untersuchung der Frage nach der Autonomie der Porträtdarstellungen
- Vergleich der drei Selbstbildnisse hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschieden
- Interpretation der Selbstbildnisse im Kontext des künstlerischen Schaffens von Paula Modersohn-Becker
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung in die Thematik: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die drei ausgewählten Selbstbildnisse von Paula Modersohn-Becker vor: „Selbstbildnis vor blühenden Bäumen“ (1902), „Selbstbildnis“ (1906) und „Selbstbildnis mit Kamelienzweig“ (1907). Sie definiert den Begriff des Porträts und des Selbstbildnisses, untersucht die Entwicklung des Porträtbegriffs in der Kunstgeschichte und hebt die besondere Bedeutung des Selbstbildnisses für die Künstlerin hervor. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der eine vorikonographische, ikonographische und ikonische Bildanalyse umfasst, um die Frage nach der Autonomie der Porträtdarstellungen zu beantworten.
2. Selbstbildnis vor blühenden Bäumen (1902): Dieses Kapitel beschreibt und analysiert das Selbstbildnis von 1902 auf verschiedenen Ebenen. Die vorikonographische Beschreibung befasst sich mit formalen Aspekten wie Größe, Material und Komposition. Die ikonographische Beschreibung analysiert die Bedeutung der einzelnen Bildelemente, wie Kleidung, Mimik und die Landschaft im Hintergrund. Die ikonische Analyse untersucht die Wirkung des Bildes auf den Betrachter und die künstlerischen Mittel, die Modersohn-Becker einsetzt, um ihre Persönlichkeit auszudrücken. Das Kapitel beleuchtet die frühen Merkmale des künstlerischen Stils der Malerin.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Selbstbildnisse von Paula Modersohn-Becker
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert drei Selbstbildnisse von Paula Modersohn-Becker ("Selbstbildnis vor blühenden Bäumen" (1902), "Selbstbildnis" (1906) und "Selbstbildnis mit Kamelienzweig" (1907)), um ihre künstlerische Entwicklung und die Autonomie dieser Porträts zu untersuchen. Die Analyse erfolgt auf vorikonographischer, ikonographischer und ikonischer Ebene.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung der künstlerischen Darstellung bei Modersohn-Becker, die Analyse der ikonographischen Elemente in den Selbstbildnissen, die Untersuchung der Autonomie der Porträts, einen Vergleich der drei Bilder hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschieden sowie deren Interpretation im Kontext ihres künstlerischen Schaffens.
Welche Methode wird angewendet?
Die Analyse der Selbstbildnisse erfolgt dreistufig: vorikonographisch (formale Aspekte wie Größe, Material, Komposition), ikonographisch (Bedeutung der Bildelemente wie Kleidung, Mimik, Landschaft) und ikonisch (Wirkung des Bildes auf den Betrachter und eingesetzte künstlerische Mittel).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Analyse des Selbstbildnisses von 1902 (inklusive vorikonographischer, ikonographischer und ikonischer Beschreibung), Analyse des Selbstbildnisses von 1906 (ebenfalls dreistufig), Analyse des Selbstbildnisses von 1907 (ebenfalls dreistufig), Vergleich der Selbstbildnisse, Bildanalyse in Bezug auf die Forschungsfrage und Schlussfolgerungen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die drei ausgewählten Selbstbildnisse vor, definiert die Begriffe Porträt und Selbstbildnis, beleuchtet die Entwicklung des Porträtbegriffs in der Kunstgeschichte, hebt die Bedeutung des Selbstbildnisses für Modersohn-Becker hervor und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
Wie werden die einzelnen Selbstbildnisse analysiert?
Jedes Selbstbildnis wird in drei Abschnitten analysiert: Vorikonographische Beschreibung (formale Aspekte), Ikonographische Beschreibung (Bedeutung der Bildelemente) und Ikonische Analyse (Wirkung und künstlerische Mittel). Dabei wird jeweils der künstlerische Stil und die Persönlichkeit der Künstlerin beleuchtet.
Was ist das Ergebnis des Vergleichs der Selbstbildnisse?
Der Text enthält einen Vergleich der drei Selbstbildnisse, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede im künstlerischen Stil und der Darstellung der Künstlerin aufzuzeigen. Die genauen Ergebnisse des Vergleichs sind im Text selbst nachzulesen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit beziehen sich auf die Fragestellung nach der künstlerischen Entwicklung und der Autonomie der Selbstbildnisse von Paula Modersohn-Becker. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Text selbst nachzulesen.
- Quote paper
- Martina Müller (Author), 2007, Zu Paula Modersohn Beckers Selbstbildnissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92860