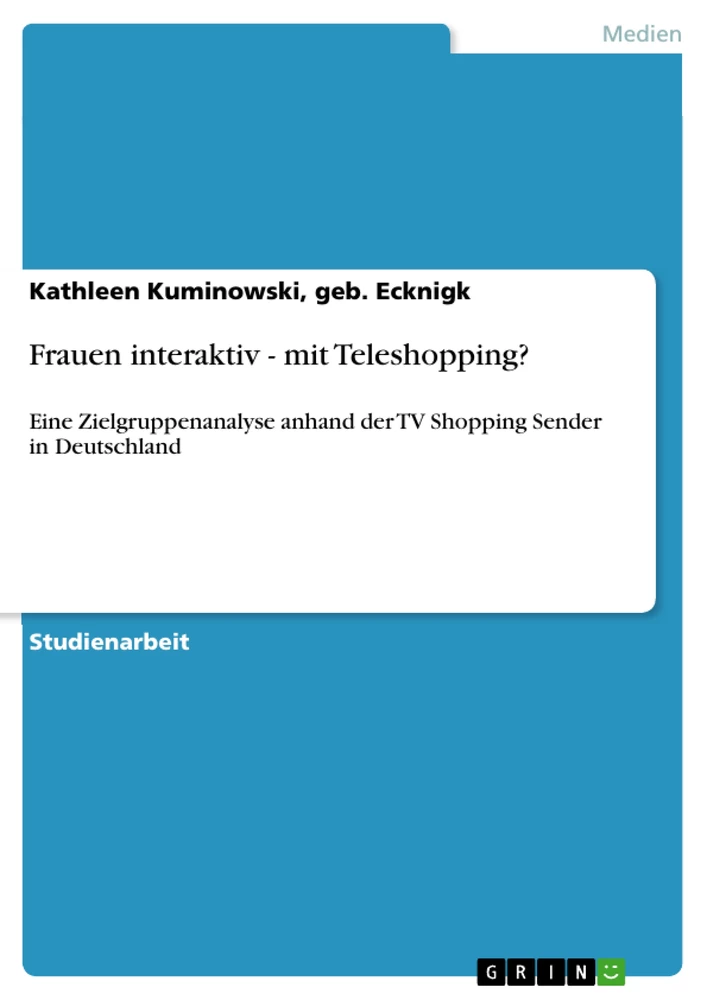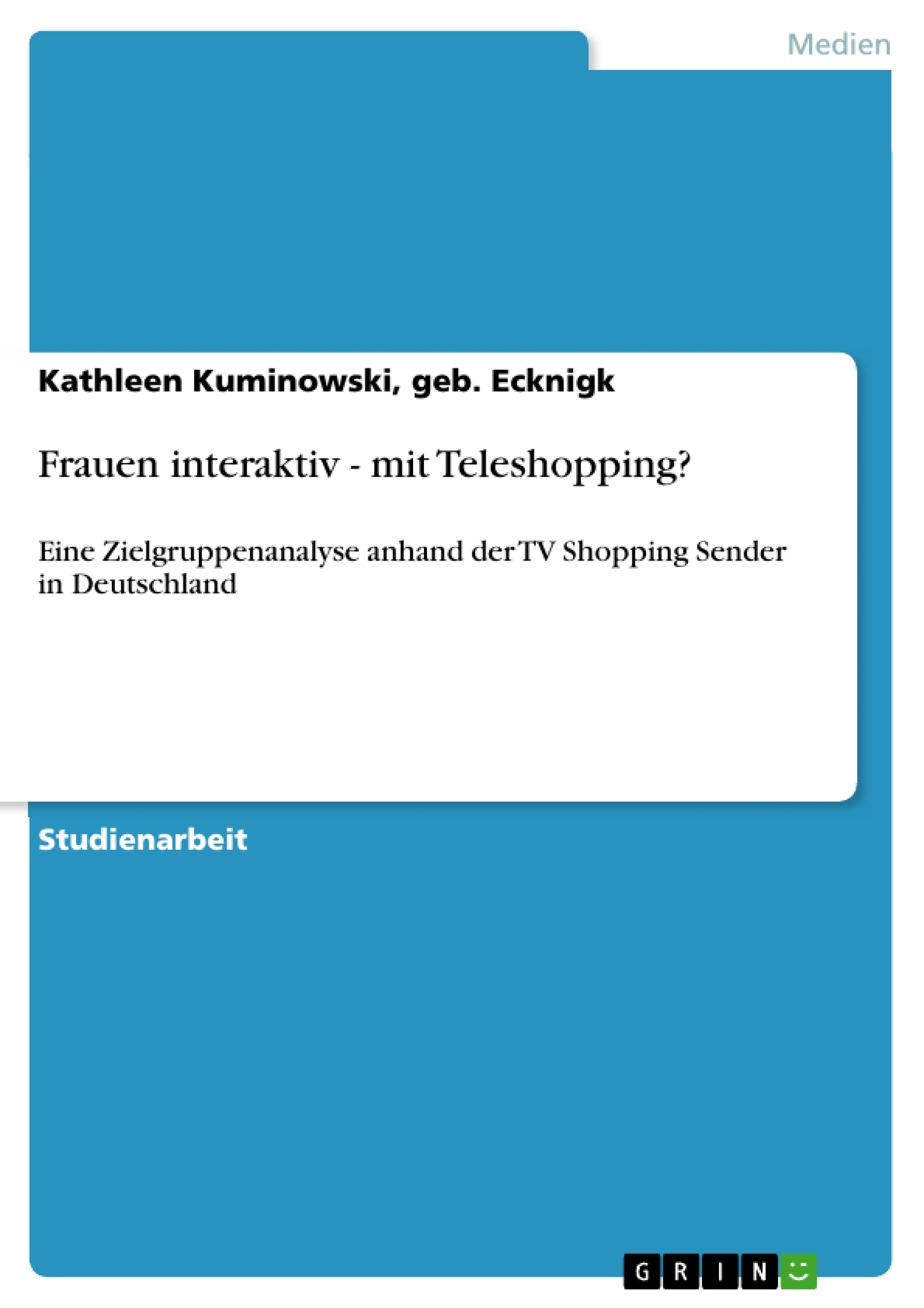[...]
Für den Medienmacher bedeutet eine große Beteiligung eine Steigerung seines Gewinns. Nicht nur durch die zusätzlichen Einnahmen aus dem Telefondienst, sondern auch durch die große Reichweite und die daraus resultierenden Mehreinnahmen aus der Werbung können erzielt werden. Allein diese Form von Nebengeschäft aus Telefongebühren hatte im Jahr 2003 der RTL Group in Deutschland einen Anteil von 15% des Gesamtumsatzes beschert.
Aber nicht nur cross-mediale Interaktion entwickelte sich weiter, auch Video-on-demand und Pay-TV entstand aus der Entwicklung der Digitalisierung des Fernsehens. Bei Video-on-demand kann ein Kunde bzw. der Nutzer einen bestimmten Film aus einer Datenbank herunterladen und bezahlt nur für den bestellten Film. Die Funktionsweise kommt dem der Videothek am nächsten, nur das der Kunde dazu nicht aus dem Haus gehen braucht. Allerdings ist diese Form noch an das Internet gekoppelt und wird bisher nicht vom klassischen Fernseher übertragen. Das Pay-TV-Modell wurde in Deutschland bis jetzt nur von Premiere umgesetzt. Der Premierekunde kann verschiedene Kanäle mit inhaltlichen Schwerpunkten kaufen, wobei er eine monatliche Abonnementgebühr zu entrichten hat. Mittlerweile biete Premiere ihren Kunden Sportübertragungen extra als Paket an. Der Premierekunde hat die Möglichkeit sein Programm von Filmen auf aktuelle Sportberichterstattung zu erweitern. Nachteilig erscheint nur, dass beispielsweise ein Fussballfan eher weniger bereit dafür sei, auch für andere Sportarten, die dieses Paket beinhaltet, zu bezahlen und sich dann eher gegen die Anschaffung von Pay-TV entscheidet. Vorteil sind die Sportübertragungen, die vorrangig von Premiere übertragen werden.
Weitere Anwendungen wie der Videotext und auch das Teleshopping lassen sich unter die Kategorie des interaktiven Fernsehens fassen. Auf das Letztere wird im folgenden noch detaillierter eingegangen.
Wie man sieht, gibt es verschiedene Formen und Grade von aktiver Beteiligung eines Zuschauers an einer TV-Sendung. Was aber ist nun genau interaktives Fernsehen? Ist es der Anruf in einer Quizsendung oder doch mehr das Auswählen einer Sendung? Für die Beantwortung zur Interaktivität im TV, werde ich mich im folgenden auf verschiedene Literatur stützen, um anschließend der hauptsächlichen Frage nachzugehen, wer interaktive Angebote überhaupt nutzt und wie diese mögliche Nutzergruppe charakterisiert ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Interaktivität?
- 3. Das Interesse der Medien
- 4. Weibliches Interesse zu medialen Programmen
- 5. Teleshopping – umsatzstärkste Branche?
- 5.1. Historische Entwicklung
- 5.2. Umsatzstarke Entwicklung
- 5.3. Teleshoppingsender = Frauensender? Am Beispiel Deutschland
- 5.4. Die Käuferschicht
- 6. Fazit - Zukunft Teleshopping
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, warum Frauen über vierzig Jahren eine interessante Zielgruppe für Teleshopping darstellen. Es wird sowohl die Anbieter- als auch die Rezipientenseite betrachtet, um Interessen und Nutzungsverhalten zu analysieren und deren Bedeutung für die Zukunft des TV-Shopping und des interaktiven Fernsehens zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des interaktiven Fernsehens und den verschiedenen Formen der Zuschauerbeteiligung.
- Analyse der Zielgruppe von Teleshopping, insbesondere Frauen über 40.
- Untersuchung des Nutzungsverhaltens und der Interessen der weiblichen Rezipienten.
- Bewertung der Bedeutung von Interaktivität für den Erfolg von Teleshopping.
- Prognose der Zukunftsaussichten von Teleshopping und interaktivem Fernsehen.
- Diskussion verschiedener Formen der Interaktivität im Fernsehen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Teleshoppings und seiner Zielgruppe ein. Ausgehend von der These, dass knapp 80% der Teleshopping-Kunden weiblich sind und die Altersgruppe 40+ eine wichtige Rolle spielt, wird die Forschungsfrage nach den Gründen für dieses Phänomen formuliert. Die Arbeit soll sowohl die Anbieter- als auch die Rezipientenseite beleuchten, um die Bedeutung für die Zukunft des TV-Shopping und des interaktiven Fernsehens zu analysieren. Der Kontext der sich verändernden Medienlandschaft und die Entwicklung verschiedener interaktiver Fernsehformate wird ebenfalls angesprochen.
2. Interaktivität?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Interaktivität im Kontext des Fernsehens. Es wird zwischen verschiedenen Stufen der Interaktivität unterschieden, von der einfachen Ein-/Ausschaltung bis hin zu komplexen Simulationen. Die Arbeit analysiert verschiedene Formen interaktiver Fernsehangebote und diskutiert deren Auswirkungen auf die Zuschauerbeteiligung und den wirtschaftlichen Erfolg der Sender. Die Definitionen aus der Fachliteratur werden herangezogen und miteinander verglichen, um ein umfassendes Bild des Begriffs "Interaktives Fernsehen" zu zeichnen.
3. Das Interesse der Medien: (Anmerkung: Kapitel 3, 4 und 5.1-5.4 fehlen im bereitgestellten Text und können daher nicht zusammengefasst werden.)
Schlüsselwörter
Teleshopping, Interaktives Fernsehen, Zielgruppenanalyse, Frauen, Altersgruppe 40+, Nutzungsverhalten, Medienlandschaft, Interaktivität, Zuschauerbeteiligung, TV-Shopping, Mediennutzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Teleshoppings und seiner weiblichen Zielgruppe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, warum Frauen über 40 eine besonders attraktive Zielgruppe für Teleshopping darstellen. Sie analysiert sowohl die Perspektive der Anbieter als auch die der Zuschauerinnen, um Nutzungsverhalten und Interessen zu verstehen und deren Bedeutung für die Zukunft des Fernsehens und interaktiven Fernsehens zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Analyse der Zielgruppe (insbesondere Frauen über 40), die Untersuchung ihres Nutzungsverhaltens und ihrer Interessen, die Bewertung der Bedeutung von Interaktivität für den Erfolg von Teleshopping, eine Prognose der Zukunftsaussichten von Teleshopping und interaktivem Fernsehen sowie eine Diskussion verschiedener Formen der Interaktivität im Fernsehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält folgende Kapitel: Einleitung, Interaktivität?, Das Interesse der Medien, Weibliches Interesse zu medialen Programmen, Teleshopping – umsatzstärkste Branche? (mit Unterkapiteln zur historischen Entwicklung, umsatzstarken Entwicklung, Teleshoppingsender als Frauensender am Beispiel Deutschlands und der Käuferschicht), und Fazit - Zukunft Teleshopping. Leider sind die Kapitel 3, 4 und die Unterkapitel von Kapitel 5 im vorliegenden Text nicht enthalten.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Frage ist, warum Frauen über 40 eine so wichtige Zielgruppe für Teleshopping darstellen. Die Arbeit sucht nach den Gründen für dieses Phänomen, indem sie sowohl die Anbieter- als auch die Rezipientenseite betrachtet.
Wie wird Interaktivität definiert?
Kapitel 2 befasst sich mit der Definition von Interaktivität im Fernsehen. Es unterscheidet verschiedene Stufen der Interaktivität, von einfachen Handlungen bis hin zu komplexen Interaktionen und analysiert verschiedene Formen interaktiver Fernsehangebote und deren Auswirkungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Teleshopping, Interaktives Fernsehen, Zielgruppenanalyse, Frauen, Altersgruppe 40+, Nutzungsverhalten, Medienlandschaft, Interaktivität, Zuschauerbeteiligung, TV-Shopping, Mediennutzung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Gründe für den Erfolg von Teleshopping bei Frauen über 40 zu verstehen und die Bedeutung dieses Trends für die Zukunft des Fernsehens und des interaktiven Fernsehens zu bewerten.
Welche Aspekte der Medienlandschaft werden berührt?
Die Arbeit betrachtet den Kontext der sich verändernden Medienlandschaft und die Entwicklung verschiedener interaktiver Fernsehformate.
- Quote paper
- Kathleen Kuminowski, geb. Ecknigk (Author), 2005, Frauen interaktiv - mit Teleshopping?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92837