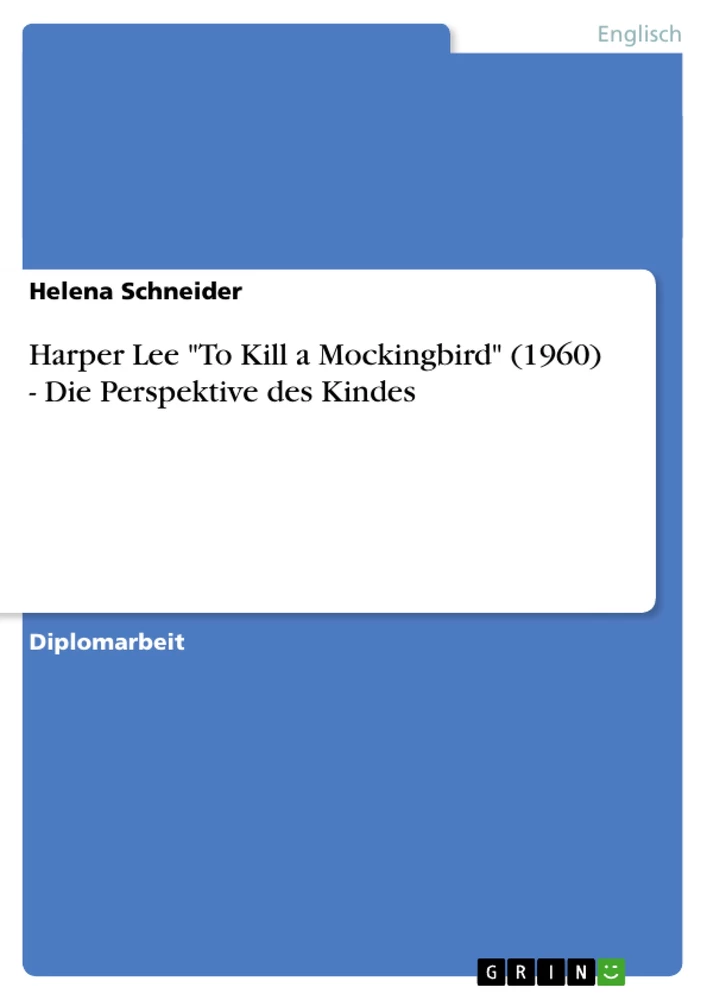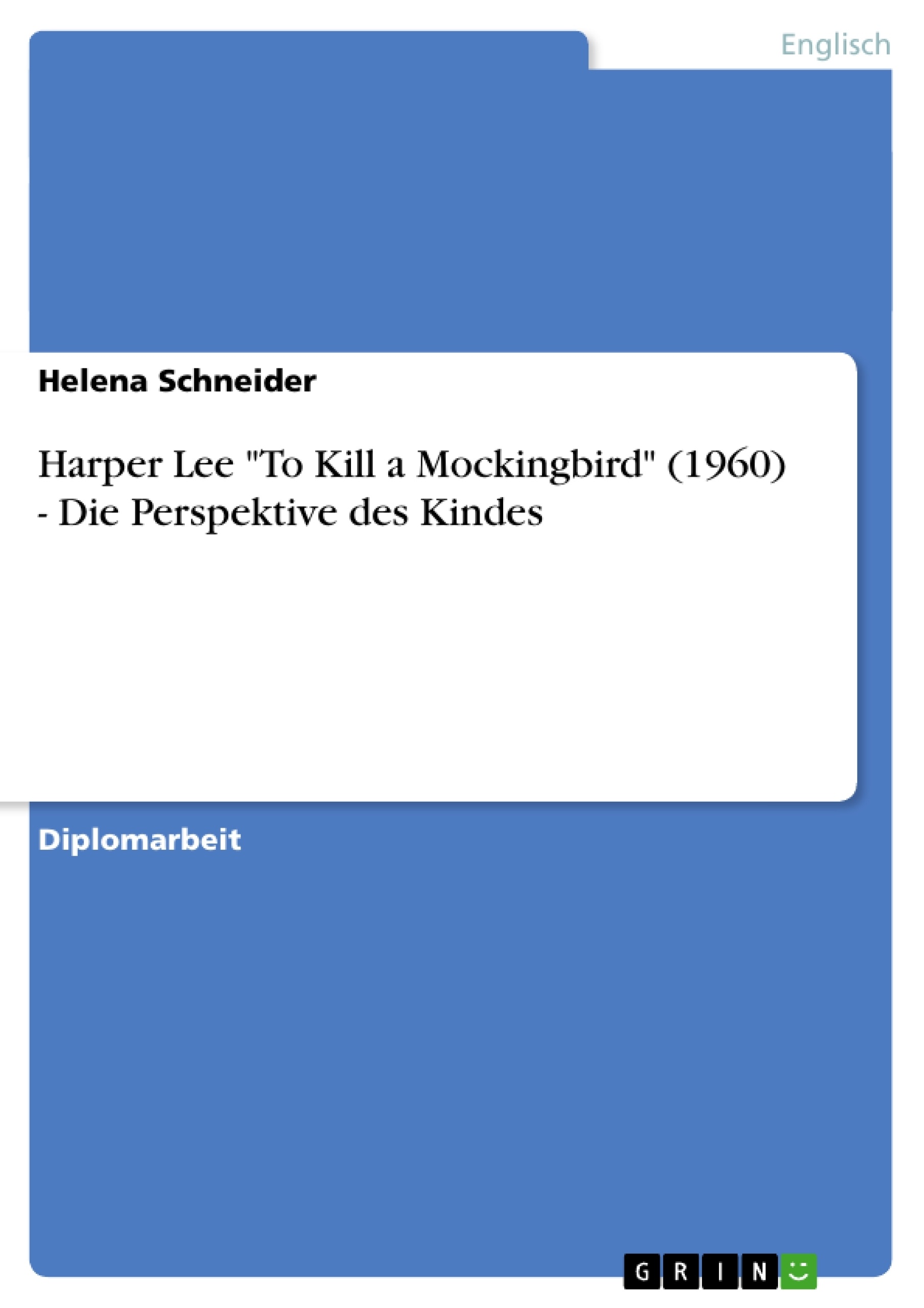Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung der kindlichen Perspektive in der Literatur. Das Werk, in der dieses Phänomen untersucht werden soll, ist der Roman To Kill a Mockingbird (1960) von Harper Lee (1926). Das Ziel der Untersuchung besteht darin, neben formalen Aspekten vor allem die Funktionen, die die Art und Weise des Schreibens aus kindlicher Sicht haben kann, herauszuarbeiten bzw. herauszufinden, welche Absichten ein Autor mit der Wahl dieser Perspektive verfolgt. Die vorliegende Untersuchung ist von daher nicht pädagogisch oder psychologisch, sondern in erster Linie erzähltheoretisch orientiert. Nicht die psychische Entwicklung der Kindergestalt, aus deren Sicht der Roman geschrieben ist, steht im Vordergrund, sondern die erzählerischen Mittel, die beim literarischen Erzählen aus der Sicht eines Kindes eine Rolle spielen, sowie die Wirkung, die durch diese Mittel erzielt wird.
To Kill a Mockingbird hat sich für die Untersuchung der Kinderperspektive aus mehreren Gründen als besonders geeignet erwiesen. Entscheidend bei der Wahl des Romans war zunächst, dass dieser in den Südstaaten der USA angesiedelt ist, d.h. in einem Kulturkreis, in dem es eine verhältnismäßig große Anzahl von Erzählwerken gibt, die aus der Sicht eines kindlichen bzw. jugendlichen Protagonisten geschrieben sind. Hinzu kam jedoch noch ein weiterer Umstand, der die Analyse der Erzählperspektive in diesem Roman äußerst interessant gemacht hat. Die Tatsache, dass To Kill a Mockingbird zu den Werken gehört, die aus den Augen eines Kindes bzw. Jugendlichen erzählt wird, ist nämlich aufgrund der Verfilmung des Romans von 1962 etwas in Vergessenheit geraten. So steht in dieser nicht nur der Vergewaltigungsprozess, der über die Hälfte der Filmzeit in Anspruch nimmt, im Mittelpunkt der Handlung, sondern auch der erwachsene Protagonist Atticus Finch. In der Romanvorlage hingegen, in der dem Prozess lediglich ein Viertel aller Seiten gewidmet sind, steht bei näherem Hinsehen eindeutig die kindliche Figur Jean Louise, genannt Scout, und ihr Blick auf die Welt der Erwachsenen im Vordergrund.1 Dieser Fokuswechsel im Film, der bei vielen Zuschauern sicherlich nicht immer richtige Rückschlüsse hinsichtlich der Erzählperspektive des Originals zugelassen hat, war ein Anreiz, sich näher mit der Sichtweise, aus der das Buch geschrieben ist, auseinander zu setzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Kinderperspektive in der Literatur: Geschichtlicher und erzähltechnischer Hintergrund
- Das europäische Kinderbild: Ein historischer Überblick
- Die Begriffe „Kind“ und „Kindheit“ vom Mittelalter bis zur Romantik
- Das Kind im zwanzigsten Jahrhundert
- Das amerikanische Kinderbild
- Der europäische und der transzendentalistische Einfluss auf das amerikanische Kinderbild
- Der amerikanische Kult um den jugendlichen Helden
- Erzähltheoretische Grundlagen
- Was versteht man unter „Erzählen“?
- Erzählmodus
- Erzählform
- Erzählperspektive
- Erzählverhalten
- Das europäische Kinderbild: Ein historischer Überblick
- Interpretation des Romans vor dem literaturhistorischen und erzähltheoretischen Hintergrund
- Die Autorin
- Einordnung des Romans in den literaturhistorischen Kontext: Die Besonderheiten der Südstaatenliteratur
- Untersuchung der einzelnen Erzählkategorien im Roman
- Erzählmodus
- Erzählform
- Erzählperspektive
- Erzählverhalten
- Funktionen der Kinderperspektive
- Die Funktionen der Kinderperspektive im Roman
- Allgemeine Funktionen der Kinderperspektive
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung der kindlichen Perspektive in Harper Lees Roman "To Kill a Mockingbird" (1960). Ziel ist die Herausarbeitung der Funktionen und Absichten der Autorin bei der Wahl dieser Perspektive, wobei der Fokus auf erzähltheoretischen Aspekten liegt. Die psychologische Entwicklung der kindlichen Protagonistin tritt hinter die Analyse der erzählerischen Mittel und deren Wirkung zurück.
- Die historische Entwicklung des Kinderbildes in Europa und Amerika
- Erzähltheoretische Grundlagen und deren Anwendung im Roman
- Die Funktionen der Kinderperspektive in "To Kill a Mockingbird"
- Der Vergleich zwischen Roman und Verfilmung hinsichtlich der Erzählperspektive
- Die Einordnung des Romans in den Kontext der Südstaatenliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Wahl von Harper Lees "To Kill a Mockingbird" als Untersuchungsgegenstand. Sie betont den erzähltheoretischen Fokus der Analyse und hebt den Unterschied zwischen der Romanvorlage und der Verfilmung hinsichtlich der Gewichtung der kindlichen Perspektive hervor. Die Einleitung begründet die Notwendigkeit der Untersuchung der historischen Entwicklung des Kinderbildes in Europa und Amerika als Grundlage für das Verständnis der erzählerischen Strategien im Roman. Die Bedeutung der Südstaatenliteratur als Kontext wird ebenfalls angesprochen.
Die Kinderperspektive in der Literatur: Geschichtlicher und erzähltechnischer Hintergrund: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über das europäische und amerikanische Kinderbild. Es beleuchtet die Entwicklung des Verständnisses von Kindheit und Kindsein über verschiedene Epochen hinweg, zeigt die Unterschiede zwischen europäischen und amerikanischen Vorstellungen auf und legt den Grundstein für das Verständnis der erzähltechnischen Mittel, die mit der kindlichen Perspektive in Verbindung stehen. Der Abschnitt verbindet historische Entwicklungen mit der Erzähltheorie, um den Kontext für die Analyse von "To Kill a Mockingbird" zu schaffen.
Interpretation des Romans vor dem literaturhistorischen und erzähltheoretischen Hintergrund: Dieses Kapitel analysiert "To Kill a Mockingbird" unter Berücksichtigung der vorherigen Kapitel. Es untersucht die erzählerischen Kategorien (Modus, Form, Perspektive, Verhalten) im Roman und setzt diese in Beziehung zum historischen und erzähltheoretischen Hintergrund. Die Einordnung des Romans in den Kontext der Südstaatenliteratur wird detailliert beleuchtet, um die spezifischen kulturellen Einflüsse auf die Darstellung der kindlichen Perspektive zu verstehen. Die Analyse fokussiert darauf, wie die erzählerischen Mittel die Wahrnehmung und Darstellung der Ereignisse beeinflussen.
Funktionen der Kinderperspektive: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Funktionen der kindlichen Perspektive im Roman "To Kill a Mockingbird" und im Allgemeinen. Es untersucht, wie die Wahl dieser Perspektive die Erzählung strukturiert, die Interpretation der Ereignisse beeinflusst und die Wirkung auf den Leser erzielt. Es werden spezifische Beispiele aus dem Roman herangezogen um diese Funktionen zu illustrieren und ihre Bedeutung im Kontext der Gesamtgeschichte zu erläutern. Die allgemeine Relevanz dieser Erzählperspektive in der Literatur wird ebenso diskutiert.
Schlüsselwörter
Kinderperspektive, Erzähltheorie, Harper Lee, To Kill a Mockingbird, Südstaatenliteratur, amerikanisches Kinderbild, europäisches Kinderbild, Romananalyse, Erzählmodus, Erzählform, Erzählperspektive, Erzählverhalten, Jugendlicher Protagonist.
Häufig gestellte Fragen zu "To Kill a Mockingbird": Eine Analyse der Kinderperspektive
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung der kindlichen Perspektive in Harper Lees Roman "To Kill a Mockingbird" (1960). Der Fokus liegt auf den erzähltheoretischen Aspekten und den Funktionen der Autorin bei der Wahl dieser Perspektive. Die psychologische Entwicklung der Protagonistin tritt dabei in den Hintergrund.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Kinderbildes in Europa und Amerika, erzähltheoretische Grundlagen und deren Anwendung im Roman, die Funktionen der Kinderperspektive in "To Kill a Mockingbird", einen Vergleich zwischen Roman und Verfilmung, sowie die Einordnung des Romans in den Kontext der Südstaatenliteratur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen und erzähltechnischen Hintergrund der Kinderperspektive in der Literatur (einschließlich europäischer und amerikanischer Perspektiven), ein Kapitel zur Interpretation des Romans vor dem literaturhistorischen und erzähltheoretischen Hintergrund, ein Kapitel zu den Funktionen der Kinderperspektive und ein Schlusswort. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet.
Welche erzähltheoretischen Aspekte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene erzähltheoretische Kategorien, darunter Erzählmodus, Erzählform, Erzählperspektive und Erzählverhalten. Diese werden sowohl im Allgemeinen erläutert als auch im Kontext des Romans "To Kill a Mockingbird" analysiert, um deren Beitrag zur Darstellung der kindlichen Perspektive zu verstehen.
Wie wird der Roman in den Kontext eingeordnet?
Der Roman wird sowohl in den literaturhistorischen Kontext der Südstaatenliteratur eingeordnet als auch in den Kontext der historischen Entwicklung des Kinderbildes in Europa und Amerika. Diese Einordnungen dienen dazu, die erzählerischen Strategien und die Wahl der Kinderperspektive besser zu verstehen.
Welchen Unterschied gibt es zwischen Roman und Verfilmung?
Die Arbeit hebt den Unterschied zwischen der Romanvorlage und der Verfilmung hinsichtlich der Gewichtung der kindlichen Perspektive hervor. Ein detaillierter Vergleich wird jedoch nicht explizit im Inhaltsverzeichnis genannt. Es ist anzunehmen, dass dieser Vergleich eher implizit im Kontext der Analyse erfolgt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderperspektive, Erzähltheorie, Harper Lee, To Kill a Mockingbird, Südstaatenliteratur, amerikanisches Kinderbild, europäisches Kinderbild, Romananalyse, Erzählmodus, Erzählform, Erzählperspektive, Erzählverhalten, Jugendlicher Protagonist.
Wie ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, die Funktionen und Absichten der Autorin bei der Wahl der kindlichen Perspektive in "To Kill a Mockingbird" herauszuarbeiten. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der erzählerischen Mittel und deren Wirkung.
- Quote paper
- Diplomübersetzerin Helena Schneider (Author), 2004, Harper Lee "To Kill a Mockingbird" (1960) - Die Perspektive des Kindes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92778