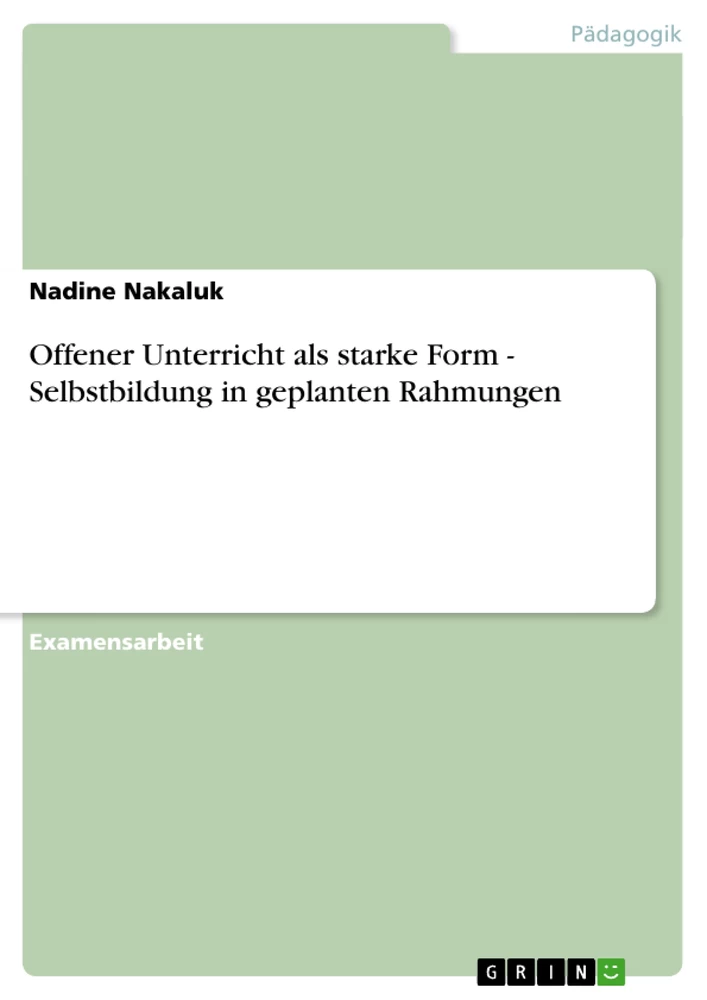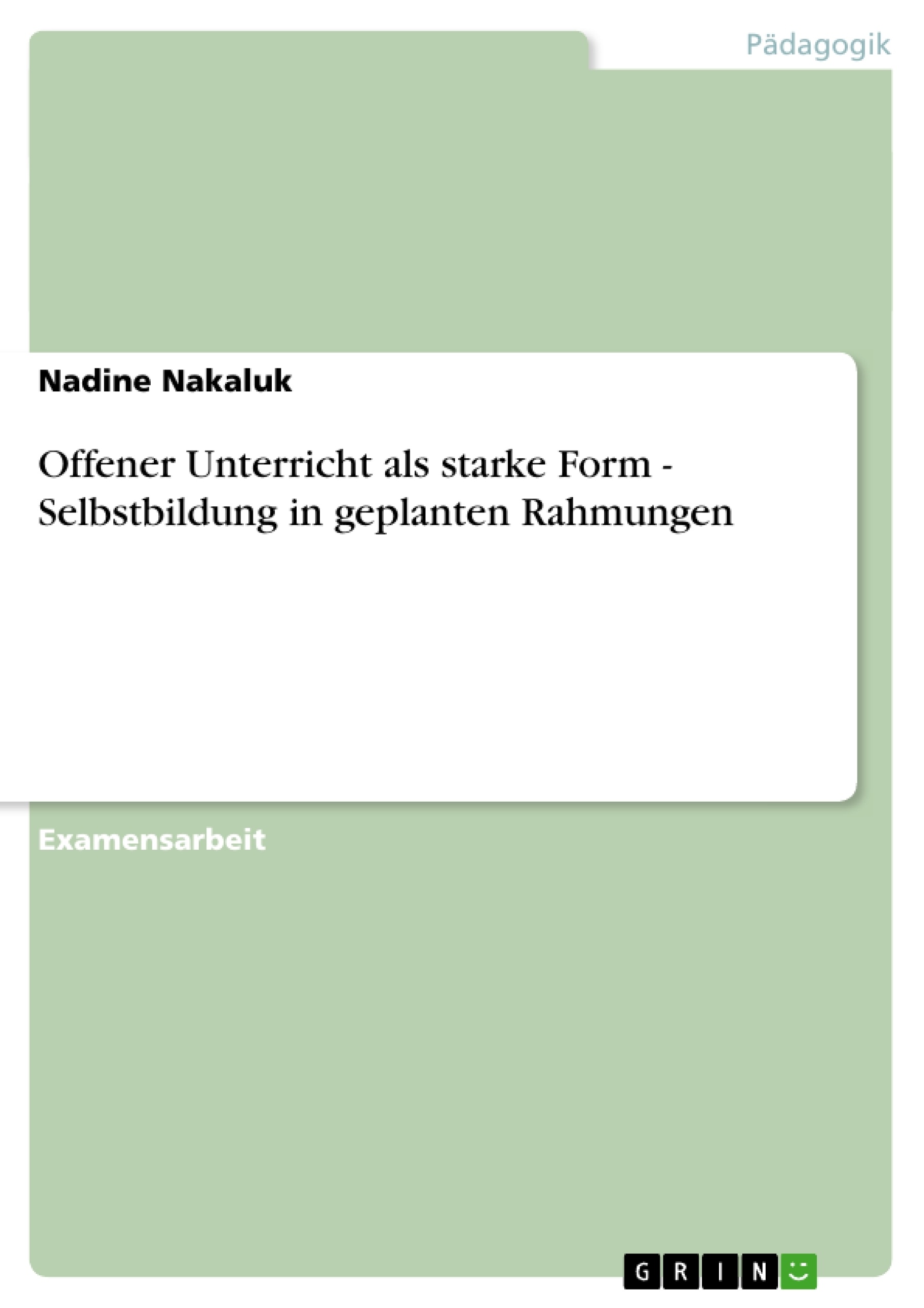In der vorliegenden Arbeit befasse ich mich mit dem Begriff „Offener Unterricht“ und zeige auf, welche Chancen er birgt, wenn er wohl überlegt, gründlich geplant ist und eine angemessene Struktur hat.
Welche Motivation habe ich über dieses Thema zu schreiben? Ich bin der Ansicht, dass man Kindern, damit sie sich frei und natürlich entwickeln, viel Freiraum lassen sollte, ohne dabei auf einen Rahmen zu verzichten. Innerhalb dieses Rahmens können sie sich frei bewegen. Er bietet ihnen Möglichkeiten und Gelegenheiten, sich eigenaktiv und selbstbestimmt auszuprobieren und gleichzeitig Orientierung, Unterstützung und Halt.
Die Kernfrage, die sich mir stellt ist, wie viel Anleitung bzw. Anregung darf sein, so dass trotzdem noch oder gerade deshalb Selbstbildung eines jeden Schülers erfolgen kann. Und wie viel Anleitung muss zugleich sein, damit sich der Schüler nicht verloren und überfordert fühlt von einer Fülle von Möglichkeiten? Im Grunde beschäftigt mich die klassische Problemstellung, wie kann durch Unterricht Selbstbildung stattfinden? Und wie kann man als Lehrer den Kindern zu Wissen und gleichzeitig zu einer ‚gesunden’ Menschenbildung verhelfen?
Meiner Meinung nach wäre eine Kombination aus vermittelndem Unterricht und selbstverantwortlichem Lernen wünschenswert. Um nicht zu viel vorwegzunehmen, verweise ich auf ein Beispiel aus der Praxis von Heide Bambach, auf das ich im Verlauf meiner Arbeit näher eingehe. In ihrem Unterrichtskonzept, die ‚Versammlung’, ist die Vorlesesituation an sich geschlossen und die Kinder können den Inhalt nicht auswählen, trotzdem bietet dieses Konzept viel Raum für Individualität und Auseinandersetzung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Diskussion um den „Offenen Unterricht“
- 2.1 „Offener Unterricht“ in der aktuellen Bildungsdiskussion
- 2.2 Was soll geöffnet werden?
- 2.3 Schwierigkeit einer einheitlichen Definition für „Offenen Unterricht“
- 3. Formen des „Offenen Unterrichts“
- 3.1 Wochenplan
- 3.2 Freiarbeit / Freie Arbeit
- 3.3 Projektunterricht
- 3.4 Werkstattunterricht
- 3.5 Arbeit an Stationen / Stationslernen
- 3.6 Offener Unterricht
- 3.7 Fazit
- 4. Der methodisch-didaktische Rahmen
- 4.1 Grundlegende Gestaltungsprinzipien
- 4.1.1 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung im Offenen Unterricht (nach Falko Peschel)
- 4.1.2 Organisation des Schullebens
- 4.1.3 Funktionalität der Räume
- 4.1.4 Rhythmisierung des Schultages
- 4.1.5 Material
- 4.2 Rolle des Lehrers im Offenen Unterricht
- 4.2.1 Veränderte Aufgaben und Unterrichtsvorbereitung
- 4.2.2 Anforderungen
- 4.2.2.1 Reflexion
- 5. Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit der Schüler
- 5.1 Selbsttätigkeit der Schüler im Zusammenhang mit dem Öffnungsgrad der einzelnen Formen Offenen Unterrichts
- 5.2 Anforderungen an die Schüler
- 5.3 Selbstbildung
- 5.3.1 Stärkung des eigenen Ichs – das Selbstwertgefühl
- 6. Beurteilung der Arbeitsergebnisse der Schüler/ Leistungsentwicklung der Kinder
- 6.1 Welche Maßstäbe / Kriterien gibt es?
- 6.2 Rückmelden und Bewerten durch die Schüler selbst
- 6.3 Rückmelden und Bewerten durch den Lehrer
- 7. Offene Arbeitsformen an Beispielen
- 7.1 Heide Bambachs „Versammlung“
- 7.2 „Lesen- und Schreibenlernen im Anfangsunterricht“ bei Falko Peschel
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den „Offenen Unterricht“ und seine Möglichkeiten, Kindern Freiraum für selbstbestimmtes Lernen zu bieten. Es wird erforscht, wie ein solcher Unterricht gestaltet werden kann, um sowohl Freiheiten als auch eine angemessene Struktur zu gewährleisten und somit Selbstbildung zu fördern. Die zentrale Frage ist, wie viel Anleitung notwendig ist, um Selbstbildung zu ermöglichen, ohne die Schüler zu überfordern.
- Definition und verschiedene Formen des Offenen Unterrichts
- Methodisch-didaktischer Rahmen des Offenen Unterrichts
- Rolle des Lehrers im Offenen Unterricht
- Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit der Schüler
- Beurteilung der Schülerleistungen im Offenen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin, sich mit dem Offenen Unterricht auseinanderzusetzen. Sie betont die Wichtigkeit von Freiraum für die kindliche Entwicklung, verbunden mit einer klaren Struktur. Die zentrale Frage nach dem optimalen Maß an Anleitung für Selbstbildung wird formuliert, sowie die Problematik, wie Unterricht Selbstbildung ermöglichen kann. Die Autorin verweist auf ein Beispiel aus der Praxis von Heide Bambach, welches später genauer erläutert wird, und skizziert den Aufbau ihrer Arbeit.
2. Die Diskussion um den „Offenen Unterricht“: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle Bildungsdiskussion um den Offenen Unterricht und die Schwierigkeiten, eine einheitliche Definition zu finden. Es werden verschiedene Perspektiven auf das Konzept des „Öffnens“ im Unterricht dargestellt und die Herausforderungen bei der Umsetzung diskutiert. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Interpretationen und der damit verbundenen Bandbreite an möglichen Ausprägungen des Offenen Unterrichts.
3. Formen des „Offenen Unterrichts“: Hier werden verschiedene Formen des Offenen Unterrichts vorgestellt und hinsichtlich ihres Öffnungsgrades und ihres Potenzials für Selbstbildung analysiert. Methoden wie Wochenpläne, Freiarbeit, Projektunterricht, Werkstattunterricht, Stationslernen und weitere Ansätze werden im Detail beschrieben und miteinander verglichen, um die Vielfalt der Möglichkeiten aufzuzeigen.
4. Der methodisch-didaktische Rahmen: Dieses Kapitel befasst sich mit den grundlegenden Gestaltungsprinzipien des Offenen Unterrichts. Es werden die Rolle des Lehrers, die Organisation des Schullebens, die Raumgestaltung, die Rhythmisierung des Schultages und die Bereitstellung von Materialien ausführlich behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf den veränderten Aufgaben und Anforderungen an den Lehrer im Kontext des Offenen Unterrichts.
5. Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit der Schüler: Dieses Kapitel untersucht die Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit der Schüler im Offenen Unterricht. Es wird der Zusammenhang zwischen dem Öffnungsgrad der verschiedenen Unterrichtsformen und der Selbsttätigkeit der Schüler beleuchtet. Die Anforderungen an die Schüler sowie der Beitrag des Offenen Unterrichts zur Selbstbildung und Stärkung des Selbstwertgefühls werden detailliert diskutiert.
6. Beurteilung der Arbeitsergebnisse der Schüler/ Leistungsentwicklung der Kinder: Hier wird die Beurteilung der Schülerleistungen im Offenen Unterricht thematisiert. Es werden verschiedene Maßstäbe und Kriterien zur Bewertung der Schülerarbeit vorgestellt, und die Rolle von Selbst- und Lehrerbewertung wird ausführlich erörtert. Der Fokus liegt auf der Anpassung der Beurteilungskriterien an die veränderte Unterrichtsform.
7. Offene Arbeitsformen an Beispielen: Dieses Kapitel präsentiert zwei Beispiele für offene Arbeitsformen im Deutschunterricht der Grundschule: Heide Bambachs „Versammlung“ und ein Konzept von Falko Peschel zum Lesen- und Schreibenlernen. Die Beispiele dienen der Veranschaulichung der theoretischen Ausführungen und zeigen konkrete Umsetzungsmöglichkeiten des Offenen Unterrichts.
Schlüsselwörter
Offener Unterricht, Selbstbildung, Selbsttätigkeit, Selbstbestimmung, methodisch-didaktischer Rahmen, Lehrerrolle, Schülerzentrierung, Leistungsbeurteilung, Grundschule, Freiarbeit, Projektunterricht, Heide Bambach, Falko Peschel.
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Offener Unterricht"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den "Offenen Unterricht" und seine Möglichkeiten, Kindern Freiraum für selbstbestimmtes Lernen zu bieten. Sie erforscht die Gestaltung eines solchen Unterrichts, der Freiheiten und Struktur vereint, um Selbstbildung zu fördern. Ein zentraler Aspekt ist die Frage nach dem optimalen Maß an Anleitung für Selbstbildung.
Welche Aspekte des Offenen Unterrichts werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Facetten des Offenen Unterrichts, darunter seine Definition und unterschiedliche Formen (Wochenplan, Freiarbeit, Projektunterricht etc.), den methodisch-didaktischen Rahmen, die Rolle des Lehrers, die Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit der Schüler sowie die Beurteilung der Schülerleistungen.
Welche verschiedenen Formen des Offenen Unterrichts werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Formen des Offenen Unterrichts vor und analysiert ihren Öffnungsgrad und ihr Potenzial für Selbstbildung. Dazu gehören Wochenpläne, Freiarbeit, Projektunterricht, Werkstattunterricht, Stationslernen und weitere Ansätze. Diese werden detailliert beschrieben und verglichen.
Welche Rolle spielt der Lehrer im Offenen Unterricht?
Die Arbeit beschreibt die veränderten Aufgaben und Anforderungen an den Lehrer im Offenen Unterricht. Es werden die Unterrichtsvorbereitung, die Organisation des Schullebens, die Raumgestaltung, die Rhythmisierung des Schultages und die Materialbereitstellung thematisiert. Die Notwendigkeit der Reflexion der Lehrerrolle wird hervorgehoben.
Wie wird die Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit der Schüler gefördert?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem Öffnungsgrad der verschiedenen Unterrichtsformen und der Selbsttätigkeit der Schüler. Die Anforderungen an die Schüler und der Beitrag des Offenen Unterrichts zur Selbstbildung und Stärkung des Selbstwertgefühls werden diskutiert.
Wie werden die Arbeitsergebnisse der Schüler beurteilt?
Die Arbeit thematisiert die Beurteilung der Schülerleistungen im Offenen Unterricht. Verschiedene Maßstäbe und Kriterien zur Bewertung werden vorgestellt, und die Rolle von Selbst- und Lehrerbewertung wird erörtert. Die Anpassung der Beurteilungskriterien an die veränderte Unterrichtsform steht im Fokus.
Welche Beispiele für offenen Unterricht werden genannt?
Die Arbeit präsentiert zwei Beispiele für offene Arbeitsformen im Deutschunterricht der Grundschule: Heide Bambachs "Versammlung" und ein Konzept von Falko Peschel zum Lesen- und Schreibenlernen. Diese Beispiele veranschaulichen die theoretischen Ausführungen und zeigen konkrete Umsetzungsmöglichkeiten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Offener Unterricht, Selbstbildung, Selbsttätigkeit, Selbstbestimmung, methodisch-didaktischer Rahmen, Lehrerrolle, Schülerzentrierung, Leistungsbeurteilung, Grundschule, Freiarbeit, Projektunterricht, Heide Bambach, Falko Peschel.
Welche zentrale Frage wird in der Arbeit gestellt?
Die zentrale Frage der Arbeit lautet: Wie viel Anleitung ist notwendig, um Selbstbildung zu ermöglichen, ohne die Schüler zu überfordern?
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und einer Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte. Es folgen Kapitel zu den verschiedenen Aspekten des Offenen Unterrichts, Beispiele aus der Praxis und eine Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel erleichtern die Orientierung.
- Quote paper
- Nadine Nakaluk (Author), 2007, Offener Unterricht als starke Form - Selbstbildung in geplanten Rahmungen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92732