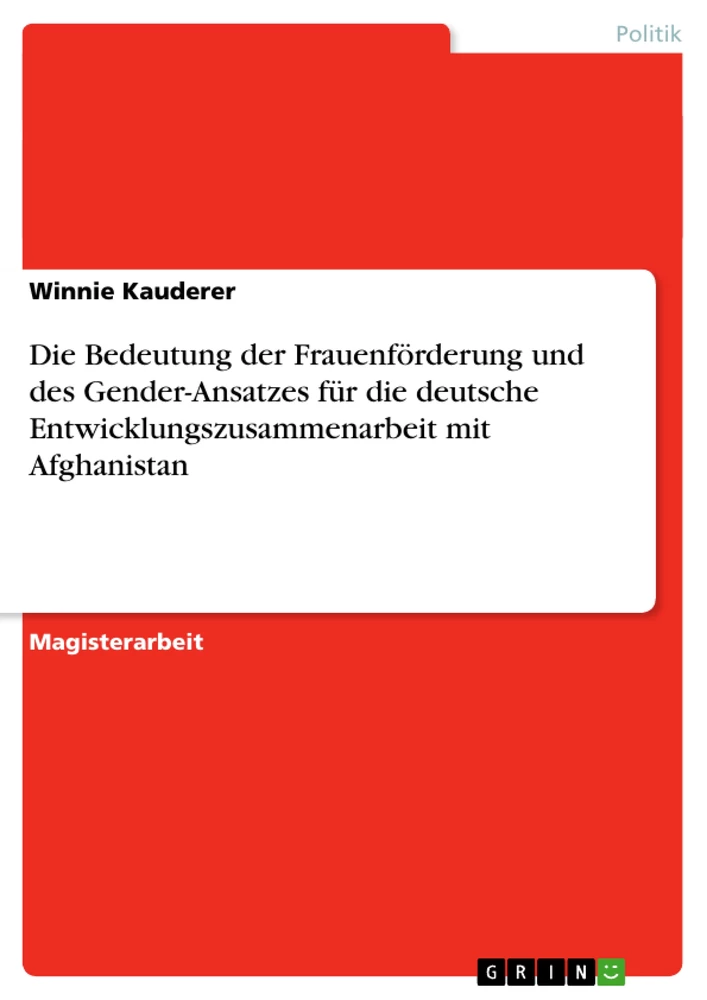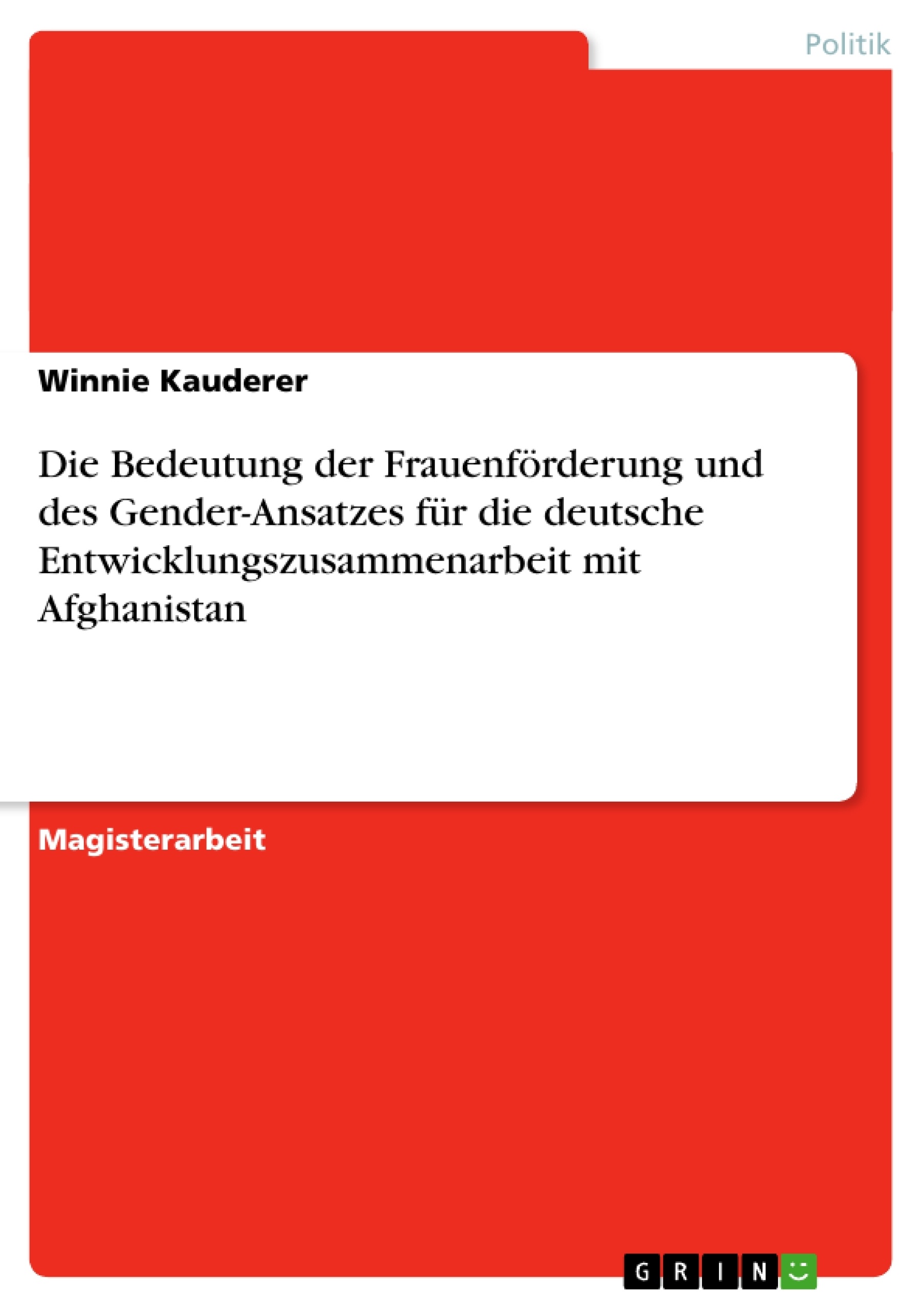Afghanistan stellt für das internationale Engagement eine besondere Herausforderung dar. Nach 23 Jahren Bürgerkrieg, auf welchen auch immer wieder ausländische Kräfte Einfluss nahmen, gehört es zu den ärmsten Ländern der Welt. Es ist gekennzeichnet durch eine weit¬gehende Zerstörung der physischen Infrastruktur, soziale Fragmentierung und einen Zusammenbruch der bisherigen staatlichen Strukturen sowie eine Gewalt- und Drogenökonomie.
Seit dem Ende der Taliban-Herrschaft im Winter 2001 stehen die afghanischen Frauen im Fokus der Weltöffentlichkeit und gelten seither häufig als Messlatte für den Erfolg der internationalen Wiederaufbauhilfe in Afghanistan. Dabei ist die Beurteilung der Geschlechtervehältnisse in Afghanistan insbesondere in den Medien des Nordens von Vorurteilen gekenzeichnet. Im Allgemeinen gilt die Burqa, die Ganzkörperverschleierung, als Symbol für die Unterdrückung der afghanischen Frau. Als Schlussfolgerung daraus wird das Ablegen der Burqa mit „Frauenbefreiung“ gleichgesetzt. Diese Position wird in Afghanistan selbst nur von wenigen, der westlich orientierten Oberschicht angehörenden, Frauen vertreten. Für die meisten afghanischen Frauen liegen die Prioritäten zurzeit eher auf Fragen der Bildung, der menschlichen Sicherheit und einer funktionierenden Regierung, die „Burqafrage“ sehen sie als zweitrangig an.
Tatsächlich stellt sich die Situation der Afghaninnen bis heute ambivalent dar. Der Einfluss der afghanischen Zentralregierung und der internationalen Akteure reicht über Kabul und die übrigen Großstädte kaum hinaus. Der Gesetzgebung, welche eine Gleichberechtigung der Geschlechter garantiert, stehen vornehmlich in den ländlichen Regionen traditionelle und tribale Regelungen gegenüber. Insbesondere im Süden des Landes ist der Schulbesuch von Mädchen noch immer für weite Teile der Bevölkerung inakzeptabel und die Müttersterblichkeitsrate in Afghanistan gehört zu den höchsten weltweit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemaufriss
- 1.2. Literatur und Forschungsstand
- 1.3. Vorgehensweise
- 1.4. Geschichte der Frauen- und Geschlechterpolitik in der EZ
- 1.4.1. Wohlfahrtsansatz
- 1.4.2. Gleichheitsansatz, Armutsbekämpfungsansatz und Effizienzansatz
- 1.4.3. Empowerment Ansatz
- 1.4.4. Gender Ansatz
- 1.4.5. Gender und Millennium-Entwicklungsziele
- 2. Rahmenbedingungen des entwicklungspolitischen Engagements in Afghanistan
- 2.1. Allgemeine innerafghanische Ausgangslage
- 2.2. Situation der afghanischen Frauen
- 2.2.1. Geschichte der Frauenförderung in Afghanistan
- 3. Die EZ zwischen der BRD und Afghanistan im Gender-Bereich
- 3.1. Konzeptionelle Ansätze der deutschen EZ mit Afghanistan
- 3.1.1. Post-Konflikt-Regelungen und multilaterale Instrumente des Wiederaufbaus
- 3.1.1.1. Das Petersberg-Abkommen
- 3.1.1.2. Der Petersberg-Prozess
- 3.1.1.3. Die „afghanisierten“ MEZ
- 3.1.1.4. Die Interim-Afghanistan National Development Strategy
- 3.1.1.5. Der Afghanistan Compact
- 3.1.2. Konzeptionelle Ansätze der BRD
- 3.1.2.1. Das Afghanistan-Konzept der Bundesregierung
- 3.1.2.2. Die Provincial Reconstruction Teams
- 3.2. Genderpolitische Wirkungen der deutschen EZ mit Afghanistan
- 3.2.1. Projekte der KfW Entwicklungsbank
- 3.2.1.1. Aufbau der Infrastruktur
- 3.2.1.2. Aufbau der „First Microfinance Bank“
- 3.2.2. Projekte der GTZ
- 3.2.2.1. Entwicklungsorientierte Nothilfe
- 3.2.2.2. Beschäftigungsförderung von Frauen
- 3.2.2.3. Förderung der Rechtsstaatlichkeit
- 3.2.2.4. Gender Mainstreaming
- 3.2.2.5. Aufbau der Infrastruktur
- 3.2.2.6. Wirtschaftsreform und Aufbau der Marktwirtschaft
- 3.2.2.7. Verbesserung der Grundbildung
- 3.2.3. Projekte des DED
- 3.2.3.1. Medienarbeit
- 3.2.3.2. Unterstützung afghanischer Parlamentarierinnen
- 3.2.3.3. Unterstützung der afghanischen Menschenrechtskommission
- 3.2.4. Bewertung der deutschen EZ im Gender-Bereich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Bedeutung von Frauenförderung und Gender-Ansätzen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan. Sie analysiert die konzeptionellen Ansätze und die praktischen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Situation afghanischer Frauen. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Erfolge als auch die Herausforderungen dieser Zusammenarbeit.
- Die Rolle der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan
- Die konzeptionellen Ansätze der Frauenförderung und Gender Mainstreaming
- Die Auswirkungen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit auf die Situation afghanischer Frauen
- Herausforderungen und Limitationen der Frauenförderung in Afghanistan
- Empfehlungen für zukünftige Entwicklungsprojekte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den Problemaufriss, indem sie die komplexe Situation Afghanistans nach Jahren des Bürgerkriegs und die ambivalente Situation afghanischer Frauen beschreibt. Sie hebt die Bedeutung der Frauenförderung als Messlatte für den Erfolg der internationalen Wiederaufbauhilfe hervor, warnt aber vor vereinfachenden Darstellungen und betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung. Die Einleitung führt in die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise ein und gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Frauen- und Geschlechterpolitik in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
2. Rahmenbedingungen des entwicklungspolitischen Engagements in Afghanistan: Dieses Kapitel analysiert die allgemeinen innerafghanischen Rahmenbedingungen und die spezifische Situation afghanischer Frauen. Es beleuchtet die Geschichte der Frauenförderung im Land und die Herausforderungen, denen sich Frauen in verschiedenen Bereichen, wie Bildung, Sicherheit und politischer Teilhabe gegenübersehen. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der Komplexität des Kontextes, in dem die deutsche Entwicklungszusammenarbeit operiert.
3. Die EZ zwischen der BRD und Afghanistan im Gender-Bereich: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es untersucht die konzeptionellen Ansätze der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) mit Afghanistan im Gender-Bereich, analysiert verschiedene Projekte der KfW, GTZ und des DED und deren Auswirkungen auf die Situation afghanischer Frauen. Es beleuchtet die Strategien und Maßnahmen, die zur Förderung von Frauen und zur Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt werden und bewertet deren Wirksamkeit. Die Kapitel analysiert die Projekte im Hinblick auf ihren Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen afghanischer Frauen und den Umgang mit den Herausforderungen wie kulturellen Normen und Sicherheitslage.
Schlüsselwörter
Frauenförderung, Gender-Ansatz, Entwicklungszusammenarbeit, Afghanistan, Geschlechtergleichstellung, Wiederaufbau, Konflikt, Armut, Bildung, Menschenrechte, KfW, GTZ, DED, Wirtschaftsentwicklung, politische Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Frauenförderung und Gender-Ansätze in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Bedeutung von Frauenförderung und Gender-Ansätzen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) mit Afghanistan. Sie analysiert die konzeptionellen Ansätze und die praktischen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Situation afghanischer Frauen, beleuchtet Erfolge und Herausforderungen und gibt Empfehlungen für zukünftige Projekte.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der deutschen EZ in Afghanistan, die konzeptionellen Ansätze der Frauenförderung und des Gender Mainstreaming, die Auswirkungen der EZ auf die Situation afghanischer Frauen, Herausforderungen und Limitationen der Frauenförderung in Afghanistan sowie Empfehlungen für zukünftige Entwicklungsprojekte. Sie analysiert verschiedene Projekte der KfW, GTZ und des DED und deren Auswirkungen auf die Situation afghanischer Frauen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt den Problemaufriss, den Forschungsstand und die methodische Vorgehensweise. Kapitel 2 analysiert die Rahmenbedingungen des entwicklungspolitischen Engagements in Afghanistan, inklusive der Situation afghanischer Frauen. Kapitel 3 untersucht die EZ zwischen der BRD und Afghanistan im Gender-Bereich, analysiert Projekte verschiedener Organisationen und bewertet deren Wirksamkeit.
Welche Organisationen werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit analysiert Projekte der KfW Entwicklungsbank, der GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) und des DED (Deutscher Entwicklungsdienst), um die Auswirkungen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit auf die Situation afghanischer Frauen zu untersuchen.
Welche konkreten Projekte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht eine Vielzahl von Projekten, darunter Infrastrukturprojekte der KfW, den Aufbau der „First Microfinance Bank“, entwicklungsorientierte Nothilfe, Beschäftigungsförderung von Frauen, die Förderung der Rechtsstaatlichkeit, Gender Mainstreaming, Wirtschaftsreformen, Verbesserung der Grundbildung, Medienarbeit, Unterstützung afghanischer Parlamentarierinnen und die Unterstützung der afghanischen Menschenrechtskommission.
Welche Herausforderungen werden in der Arbeit thematisiert?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen, denen sich Frauen in Afghanistan gegenübersehen, wie kulturelle Normen, Sicherheitslage und die komplexe politische Situation. Sie beleuchtet auch die Herausforderungen und Limitationen der Frauenförderung im Kontext des Wiederaufbaus nach dem Bürgerkrieg.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Gender-Bereich in Afghanistan und gibt Empfehlungen für zukünftige Projekte, um die Situation afghanischer Frauen nachhaltig zu verbessern. Die konkreten Schlussfolgerungen werden im Kapitel zur Bewertung der deutschen EZ im Gender-Bereich detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauenförderung, Gender-Ansatz, Entwicklungszusammenarbeit, Afghanistan, Geschlechtergleichstellung, Wiederaufbau, Konflikt, Armut, Bildung, Menschenrechte, KfW, GTZ, DED, Wirtschaftsentwicklung, politische Teilhabe.
Wo finde ich detailliertere Informationen zum Aufbau der Arbeit?
Das Inhaltsverzeichnis im HTML-Dokument bietet einen detaillierten Überblick über die Struktur und die einzelnen Unterkapitel der Arbeit.
- Quote paper
- Winnie Kauderer (Author), 2007, Die Bedeutung der Frauenförderung und des Gender-Ansatzes für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92615