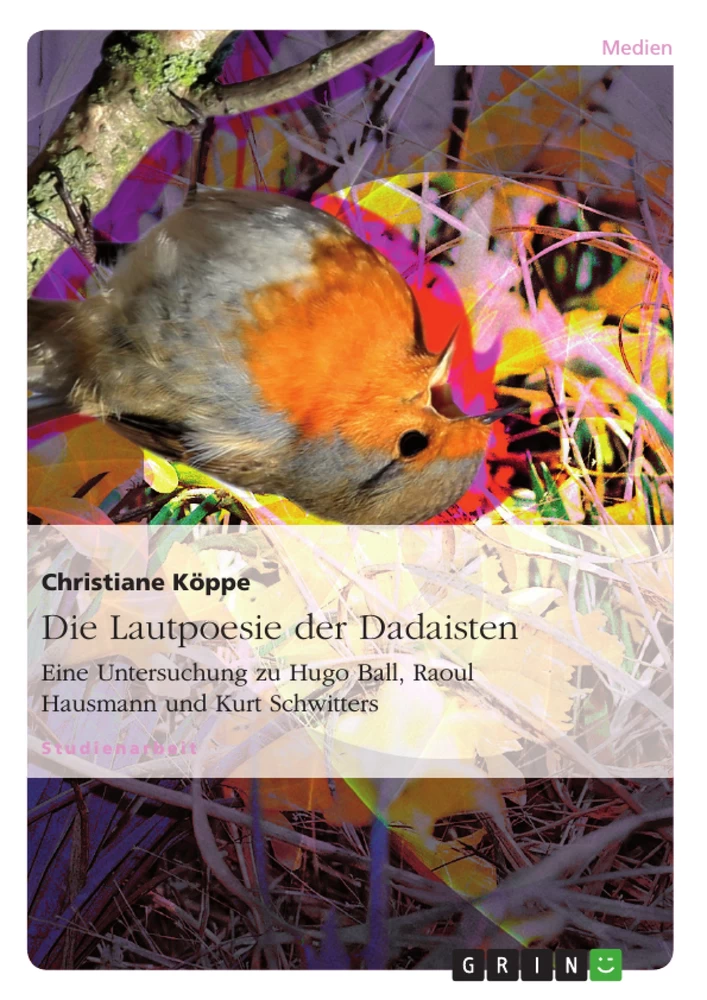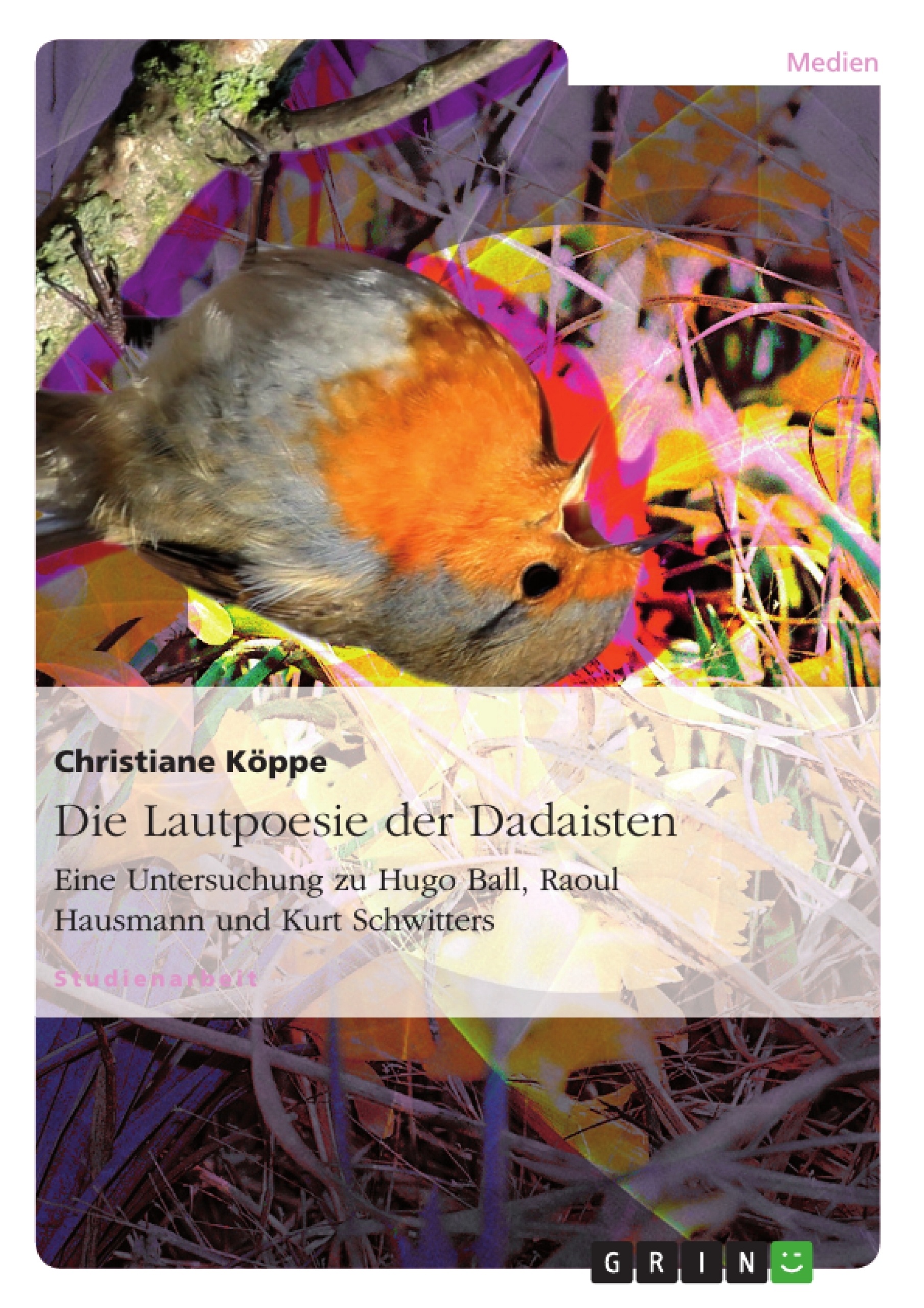Diese Arbeit führt eine Untersuchung zur Lautpoesie der Avantgarde durch, speziell zu den Dadaisten Hugo Ball, Raoul Hausmann und Kurt Schwitters. Es werden Lautgedichte untersucht und der Frage nachgegangen, inwiefern man von Lautpoesie sprechen kann.
Die künstlerische und literarische Bewegung Dada wurde 1916 in Zürich gegründet und endete ca. 1923. Sie entstand unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs und wendete sich gegen die herkömmlichen Lebens- und Kunstvorstellungen. Heute wird der Dadaismus meist in Verbindung mit der Kunst gebraucht, die literarischen Werke finden wenig Beachtung. Dabei findet sich gerade in ihnen - sowohl der Dichtung als auch der Prosa - das, was den Protest, die Revolte am Konventionellen deutlich macht: Der Sinn soll entstellt werden, die Syntax gesprengt und jede Semantik verloren gehen.
Das dadaistische literarische Werk hat eine eigene Sprachautonomie. Diese Autonomie zeigt sich in der Lyrik in zwei verschiedenen Typen: dem surrealistischen Gedicht und der Lautpoesie.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich intensiv mit dem zweiten Gedichttypus, dem „Silben-, Klang-, Ton- oder Lautgedicht.“ Hierbei beschränke ich mich auf die Bezeichnung Laut- und Klanggedicht, da nur diese Bezeichnungen von den von mir angeführten Künstlern auch benutzt werden. Der Gegenstand der Untersuchung ist aber nicht das Lautgedicht allgemein, sondern dessen dadaistische Entwicklung. Diese versuche ich anhand dreier Künstler nachzuvollziehen: dem Mitbegründer des Züricher Dadaismus Hugo Ball, dem „Dadasophen“ Raoul Hausmann und dem Merz-Künstler Kurt Schwitters.
Raoul Hausmann selbst hat eine Geschichte des Lautgedichts verfasst, welche ich an passenden Stellen mit einbeziehe. Diese Geschichte beginnt bereits vor 1910, diese Arbeit jedoch fängt erst mit dem sich selbst so bezeichnenden Erfinder des Lautgedichts, Hugo Ball, an. Deshalb soll an dieser Stelle kurz auf die Vorgänger der Lautpoesie, welche Hausmann richtig nennt, eingegangen werden. Hausmann erwähnt Scheerbart (1897) und Morgenstern (1905), welche beide nur ein einziges Lautgedicht verfassten. Er ordnet beide Gedichte der
Kategorie „Finden durch Zufall“ zu, sieht in ihnen also keine neue Kunstform.
Der zweiten Kategorie „Schöpfung einer neuen Art Dichtung“ ordnet er die Dichtung der Dadaisten zu, welche, so Hausmann, „unabhängig von den Forschungen und phonetischen Erfindungen einiger russischer Dichter wie Khlebnikov, Khrutchenykh und Iliazd“ entstanden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hugo Ball und das Lautgedicht
- Der Verzicht auf die Sprache: Die Erfindung des Lautgedichts
- Hugo Ball: Karawane – Analyse eines Lautgedichts
- „Dadasoph“ Raoul Hausmann und die optophonetische Poesie
- ,,Das Ziel und der endgültige Sinn der Phonie war: die Optophonetik.“- Vom Lautgedicht zur optophonetischen Poesie
- Das Optophon
- fmsbwtözäu / pggiv-..?mü – Untersuchung eines Plakatgedichts
- Kurt Schwitters - Die Ursonate als Laut(?)-Dichtung
- Von fmsbw zu fümms bö wö – Die Sonate in Urlauten
- Zur Problematik des (Ur-)Lauts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Lautpoesie im Dadaismus anhand von Hugo Ball, Raoul Hausmann und Kurt Schwitters. Sie beleuchtet die Entstehung des Lautgedichts, seine Definition und Performance sowie die Verbindung von Akustik und Optik in der optophonetischen Poesie. Der Fokus liegt auf der Analyse konkreter Beispiele wie Balls "Karawane", Hausmanns "fmsbwtözäu" und Schwitters' "Ursonate".
- Die Entstehung des Lautgedichts im Dadaismus
- Die Definition des Lautgedichts und seine Performanz
- Die optophonetische Poesie und die Verbindung von Akustik und Optik
- Die Entwicklung vom Plakatgedicht zur Ursonate
- Die Problematik des (Ur-)Lauts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Dadaismus und seine literarische Entwicklung vor, insbesondere den Fokus auf die Lautpoesie. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der lautpoetischen Werke von Hugo Ball, Raoul Hausmann und Kurt Schwitters.
- Hugo Ball und das Lautgedicht: Dieses Kapitel befasst sich mit Hugo Balls Rolle als Erfinder des Lautgedichts und seiner Definition sowie der Performance dieser Gedichtform. Das bekannte Gedicht "Karawane" dient als Beispiel für die Analyse.
- „Dadasoph“ Raoul Hausmann und die optophonetische Poesie: Dieses Kapitel behandelt Raoul Hausmanns Beitrag zur optophonetischen Poesie, die eine Verbindung von Akustik und Optik darstellt. Der Unterschied zum Lautgedicht Balls wird herausgestellt, das Optophon vorgestellt und das Plakatgedicht "fmsbwtözäu" unter optophonetischen Aspekten analysiert.
- Kurt Schwitters - Die Ursonate als Laut(?)-Dichtung: Dieses Kapitel untersucht den Übergang vom Plakatgedicht Hausmanns zur Ursonate Schwitters und beleuchtet die Problematik des (Ur-)Lauts in Bezug auf diese Komposition.
Schlüsselwörter
Lautpoesie, Dadaismus, Hugo Ball, Raoul Hausmann, Kurt Schwitters, optophonetische Poesie, Plakatgedicht, Ursonate, Akustik, Optik, Performance, Sprache, Syntax, Semantik.
- Quote paper
- Christiane Köppe (Author), 2007, Die Lautpoesie der Dadaisten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92557