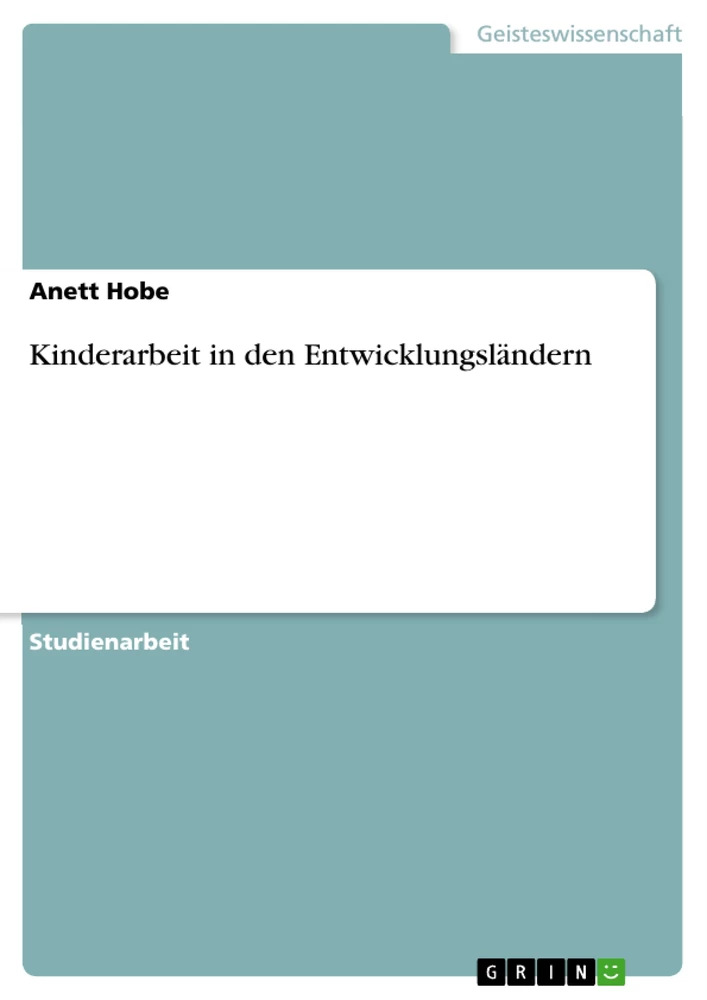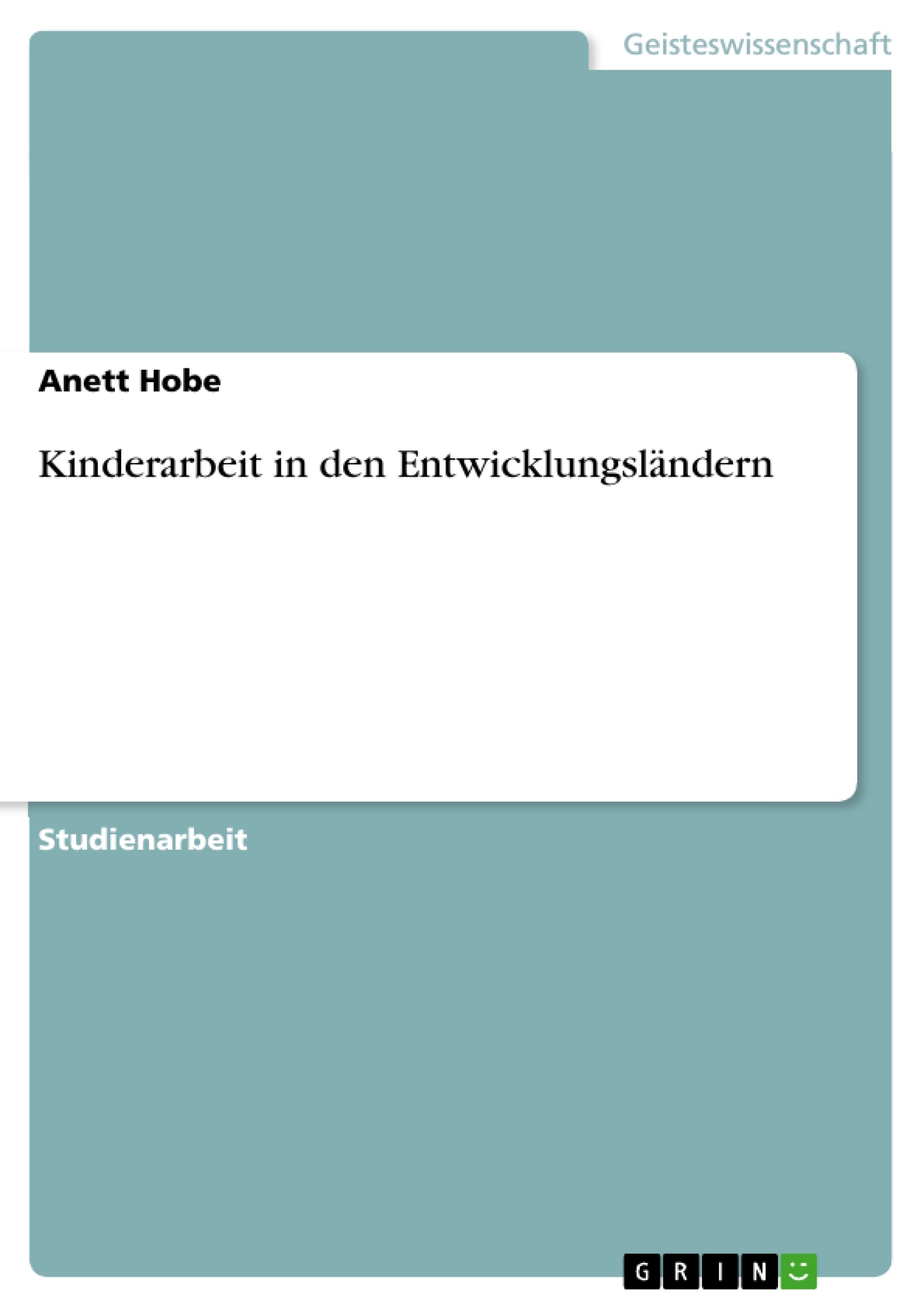Im Rahmen der Vorlesung „Soziologie der Entwicklungsländer“ beschäftigte ich mich mit dem Thema Kinderarbeit.
In unterschiedlichsten Kulturen und nahezu jeder Zeitspanne arbeiteten Kinder und Eltern gemeinschaftlich, sobald ein bestimmtes Alter erreicht war. Beispielsweise leisteten Kinder bereits im Mittelelter Frondienste . Mit der Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert nahm Kinderarbeit in Europa und den USA stark zu. So arbeiteten Minderjährige in England in Baumwollmanufakturen oder anderen Fabriken zehn bis sechzehn Sunden täglich. Neben den gesundheitlichen Beeinträchtigungen mangelte es den Kindern auch an Schulbildung. Viele konnten weder lesen noch schreiben. Für die Familien bedeutete die Arbeit jedoch ein zusätzliches oft notwendiges Einkommen.
Auch heute noch ist Kinderarbeit ein vielschichtiges Problem und hat erhebliche „Auswirkungen auf die psychische und intellektuelle Entwicklung eines Kindes“ . Infolge dessen wurde am 2. September die Un-Konvention für die Rechte des Kindes in Kraft gesetzt. Seit 150 Jahren wird Kinderarbeit als großes Problem anerkannt und bekämpft. Jedoch gibt es noch in vielen Entwicklungsländern Formen von Kinderarbeit.
Im Folgenden werde ich näher beleuchten, was unter dem Begriff „Kinderarbeit“ im Wesentlichen zu verstehen ist und werde ihre Ursachen näher erläutern. Am Ende gehe ich auf das Beispiel Indien näher ein. Es ist sehr schwer eine einheitliche Definition für den Begriff „Kinderarbeit“ zu finden. Wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind, unter denen Kinder Arbeit leisten müssen, wird deutlich, wenn man z.B. die Arbeit eines sechsjährigen Jungen aus Indien, der in der Schuldknechtschaft Teppiche knüpft, mit der eines dreizehnjährigen Mädchens vergleicht, das in Managua bei ihren Eltern wohnt, zeitweise zur Schule geht und trotzdem noch als Straßenhändlerin tätig ist.
Vergleicht man jedoch die verschiedenen Erläuterungsansätze kann man sagen:
Kinderarbeit bezeichnet die Beschäftigung von Minderjährigen im Allgemeinen, im Besonderen aber ihre Beschäftigung unter Bedingungen, die einen Schulbesuch ausschließen, sich physisch oder psychisch als schädlich erweisen und/oder auf der Grundlage wirtschaftlicher Ausbeutung beruhen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung „Kinderarbeit“
- Ausmaß der Kinderarbeit
- Überblick über Kinderarbeit nach Regionen
- Kinderarbeit nach Wirtschaftssektoren
- Formen der Kinderarbeit
- Die ländliche Kinderarbeit
- Kinderarbeit in privaten Haushalten
- Kinderarbeit auf der Straße
- Ursachen für Kinderarbeit
- Sozioökonomische Ursachen
- Kulturelle Faktoren
- Familiärer Kontext
- Kinderarbeit am Beispiel von Indien
- Die Schuldknechtschaft
- Die Rolle der Mädchen
- Fallbeispiel: Lagani, 11 Jahre
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, das Thema Kinderarbeit in den Entwicklungsländern zu beleuchten und dessen vielschichtige Problematik zu analysieren. Neben einer umfassenden Begriffsklärung werden das Ausmaß und die verschiedenen Formen der Kinderarbeit näher betrachtet. Zudem werden die sozioökonomischen, kulturellen und familiären Ursachen für Kinderarbeit untersucht.
- Definition von Kinderarbeit und ihre unterschiedlichen Ausprägungen
- Das globale Ausmaß von Kinderarbeit in verschiedenen Regionen und Sektoren
- Die Auswirkungen von Kinderarbeit auf die Entwicklung von Kindern
- Ursachen und Faktoren, die Kinderarbeit begünstigen
- Das Beispiel Indien: Schuldknechtschaft, die Rolle der Mädchen und Fallbeispiele
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Kinderarbeit ein und beleuchtet den historischen Kontext. In Kapitel 2 wird der Begriff „Kinderarbeit“ im Kontext der unterschiedlichen Bedingungen, unter denen Kinder Arbeit leisten, definiert und seine Bedeutung im Hinblick auf die Entwicklung eines Kindes diskutiert. Kapitel 3 gibt einen Überblick über das Ausmaß der Kinderarbeit in verschiedenen Regionen und Wirtschaftssektoren. Kapitel 4 beschreibt die verschiedenen Formen der Kinderarbeit, darunter die ländliche Kinderarbeit, Kinderarbeit in privaten Haushalten und Kinderarbeit auf der Straße. In Kapitel 5 werden die sozioökonomischen, kulturellen und familiären Ursachen für Kinderarbeit analysiert. Kapitel 6 befasst sich mit dem Beispiel Indien, wobei die Schuldknechtschaft, die Rolle der Mädchen und ein Fallbeispiel im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Kinderarbeit, Entwicklungsländer, Sozioökonomische Ursachen, Kulturelle Faktoren, Familiärer Kontext, Ausbeutung, Schuldknechtschaft, Internationale Arbeitsorganisationen, UNICEF, ILO, Entwicklung des Kindes, Gesundheitliche Folgen, Bildungschancen.
- Quote paper
- Anett Hobe (Author), 2004, Kinderarbeit in den Entwicklungsländern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92495