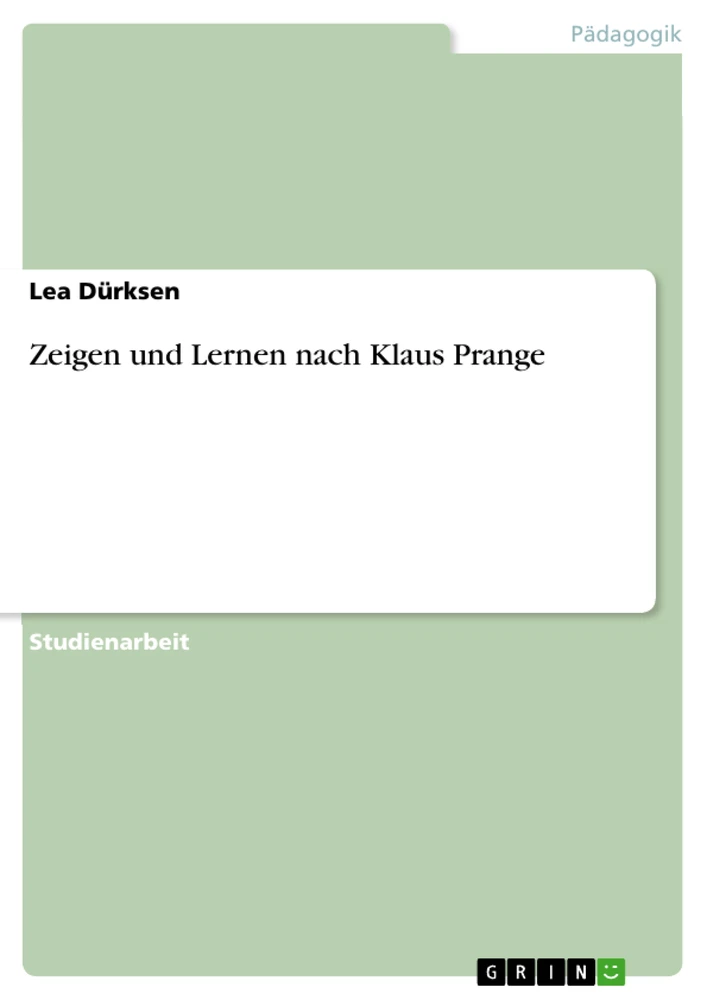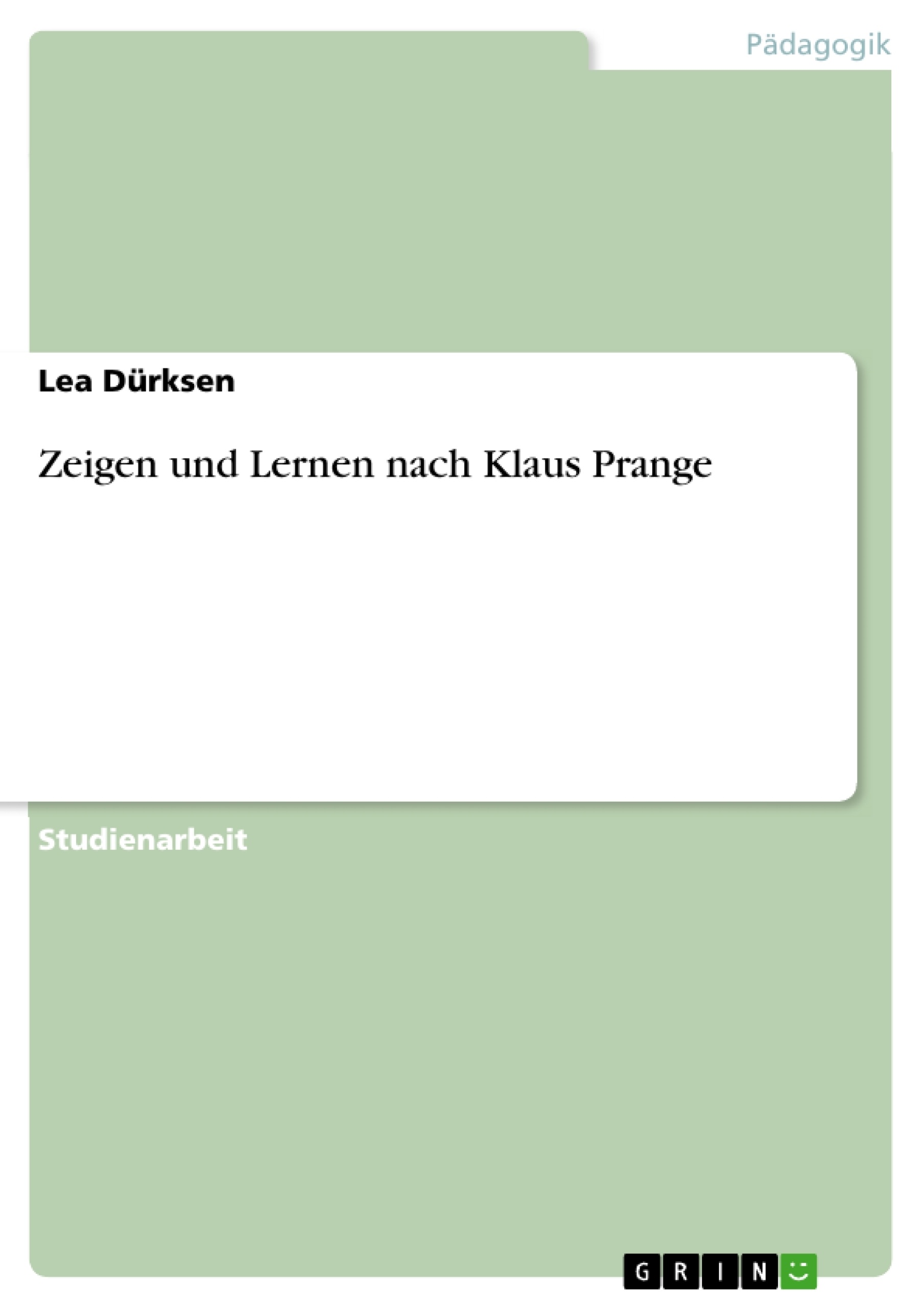In dieser Arbeit soll es um die Begriffsdefinition des Zeigens bzw. Lernens nach Prange gehen. Diese Begriffe sind mitunter der Grundstock der Erziehung, denn es gibt keine Erziehung ohne Interaktion und kaum eine Interaktion, also ein aufeinander bezogenes Handeln von zwei oder mehr Personen, wobei das Zeigen nicht zur Geltung kommt. Dabei stellt sich die Frage, wie Zeigen und Lernen nach Prange zu verstehen sind und wie sie in Beziehung zueinander stehen.
In der Erziehungswissenschaft gibt es viele Begriffe, die von großer Bedeutung sind und die es deshalb zu definieren gilt. So sollen Sachverhalte erfasst, von anderen Begriffen abgegrenzt und in Beziehung zueinander gesetzt werden. Jedoch findet man selten eine Definition, an der man sich genauestens orientieren kann. Jeder Erziehungswissenschaftler bzw. Pädagoge definiert sich seinen eigenen Begriff und versucht dabei zu erläutern, was er für richtig hält. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Definitionen, aber auch komplett gegensätzliche Ansichten. Bei all den unterschiedlichen Definitionen fällt es schwer herauszufinden, welche Begriffsdefinition für einen die richtige ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Erziehung
- 2.1 Das Lernen
- 2.2 Die pädagogische Differenz
- 3. Das Zeigen
- 3.1 Die Macht des Zeigens
- 3.2 Die Rolle der Hand
- 4. Die elementaren Formen des Zeigens
- 4.1 Das ostensive Zeigen: die Übung
- 4.2 Das repräsentative Zeigen: die Darstellung
- 4.3 Das direktive Zeigen: die Aufforderung
- 4.4 Das reaktive Zeigen: die Rückmeldung
- 5. Die Koordination von Zeigen und Lernen
- 6. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Begriffsdefinitionen von Zeigen und Lernen nach Klaus Prange und deren Beziehung zueinander im Kontext der Erziehung. Ziel ist es, die Konzepte zu erläutern und ihre Interaktion im pädagogischen Prozess zu beleuchten.
- Der Begriff der Erziehung nach Prange
- Das Lernen als unbestimmte und nur bedingt bestimmbare Größe
- Die pädagogische Differenz zwischen Erziehen und Lernen
- Das Zeigen als elementare Gebärde und seine vier Variationen
- Die Koordination von Zeigen und Lernen in der Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Schwierigkeit, in der Erziehungswissenschaft eindeutige Begriffsdefinitionen zu finden. Sie fokussiert auf die Arbeit von Klaus Prange zum Zeigen und Lernen und deren Bedeutung für die Interaktion in der Erziehung. Die Arbeit kündigt den Aufbau an, der von einer Erläuterung der Begriffe Erziehung und Lernen über die pädagogische Differenz bis hin zu den verschiedenen Formen des Zeigens und ihrer Koordination reicht.
2. Die Erziehung: Dieses Kapitel erläutert Prange's Verständnis von Erziehung nicht als rein moralischen Prozess, sondern als komplexes Geschehen der Darstellung und Erklärung der Welt. Es betont die Zwei-Seiten-Struktur von Erziehen und Lernen und führt die "pädagogische Differenz" als wesentliches Merkmal ein. Die Komplexität resultiert aus der Schwierigkeit, beide Seiten zu verbinden, obwohl sie in gemeinsamen Situationen stattfinden. Die Einführung des Begriffs der pädagogischen Differenz legt den Grundstein für die spätere Betrachtung der Interaktion von Zeigen und Lernen.
2.1 Das Lernen: Dieses Unterkapitel beschreibt Lernen nach Prange als unbestimmte und nur bedingt bestimmbare Größe, die nicht vollständig kontrollierbar ist. Kinder lernen durch Nachahmung, sowohl positive als auch negative Aspekte. Der Lernprozess wird zwar versucht zu lenken, doch die Selbstverantwortung des Lernenden bleibt zentral. Die Schwierigkeit, Lernen präzise zu definieren, wird betont und die Annahme des Lernens als gegebene Voraussetzung für pädagogisches Handeln hervorgehoben.
2.2 Die pädagogische Differenz: Dieses Unterkapitel vertieft den Unterschied zwischen Lernen und Erziehen. Lernen geschieht auch ohne Erziehen, während Erziehen immer Lernen voraussetzt. Die Unsicherheit im pädagogischen Handeln, ob die Bemühungen erfolgreich sind, wird hervorgehoben, da jeder Mensch individuell reagiert. Der Zusammenhang zwischen Erziehen, Lernen und dem "Zeigen" als elementare Gebärde wird angedeutet.
3. Das Zeigen: Das Kapitel behandelt das Zeigen als grundlegende Gebärde in der Darstellung der Welt für Kinder. Es verspricht eine nähere Untersuchung der Macht des Zeigens und der Rolle der Hand in diesem Kontext, wobei eine detailliertere Auseinandersetzung in den Unterkapiteln angekündigt wird. Hier wird der Fokus auf den praktischen Aspekt des Vermittelns von Wissen und Erfahrungen durch das Zeigen gelegt.
Schlüsselwörter
Zeigen, Lernen, Erziehung, Klaus Prange, Pädagogische Differenz, Ostensives Zeigen, Repräsentatives Zeigen, Direktives Zeigen, Reaktives Zeigen, Interaktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Zeigen und Lernen nach Klaus Prange im Kontext der Erziehung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Konzepte von „Zeigen“ und „Lernen“ nach Klaus Prange und deren Zusammenspiel im Erziehungsprozess. Sie untersucht die Begriffsdefinitionen, erläutert deren Interaktion und beleuchtet die pädagogische Differenz zwischen Erziehen und Lernen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition von Erziehung nach Prange, das Lernen als unbestimmte Größe, die pädagogische Differenz zwischen Erziehen und Lernen, die vier Variationen des Zeigens (ostensiv, repräsentativ, direktiv, reaktiv) und die Koordination von Zeigen und Lernen in der Erziehung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Kapitel zur Erziehung (inkl. Lernen und pädagogischer Differenz), Kapitel zum Zeigen (inkl. der Rolle der Hand und den verschiedenen Formen des Zeigens), Kapitel zur Koordination von Zeigen und Lernen und abschließende Zusammenfassung und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Was versteht die Arbeit unter "Erziehung" nach Prange?
Erziehung wird nicht als rein moralischer Prozess verstanden, sondern als komplexes Geschehen der Darstellung und Erklärung der Welt. Es wird die Zwei-Seiten-Struktur von Erziehen und Lernen betont, mit der „pädagogischen Differenz“ als Kernmerkmal.
Wie wird "Lernen" definiert?
Lernen wird als unbestimmte und nur bedingt bestimmbare Größe beschrieben, die nicht vollständig kontrollierbar ist. Es geschieht durch Nachahmung, sowohl positiver als auch negativer Aspekte, und betont die Selbstverantwortung des Lernenden.
Was ist die "pädagogische Differenz"?
Die pädagogische Differenz beschreibt den Unterschied zwischen Lernen und Erziehen. Lernen findet auch ohne Erziehen statt, während Erziehen immer Lernen voraussetzt. Sie verdeutlicht die Unsicherheit im pädagogischen Handeln aufgrund individueller Reaktionen.
Welche Arten des "Zeigens" werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen ostensivem (Übung), repräsentativem (Darstellung), direktivem (Aufforderung) und reativem (Rückmeldung) Zeigen als elementare Gebärden.
Welche Rolle spielt das "Zeigen" in der Erziehung?
Das Zeigen wird als grundlegende Gebärde in der Darstellung der Welt für Kinder betrachtet. Es wird untersucht, welche Macht das Zeigen hat und welche Rolle die Hand dabei spielt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zeigen, Lernen, Erziehung, Klaus Prange, Pädagogische Differenz, Ostensives Zeigen, Repräsentatives Zeigen, Direktives Zeigen, Reaktives Zeigen, Interaktion.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel im HTML-Dokument liefert einen detaillierteren Einblick in die jeweiligen Inhalte und Argumentationslinien.
- Quote paper
- Lea Dürksen (Author), 2020, Zeigen und Lernen nach Klaus Prange, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/924847