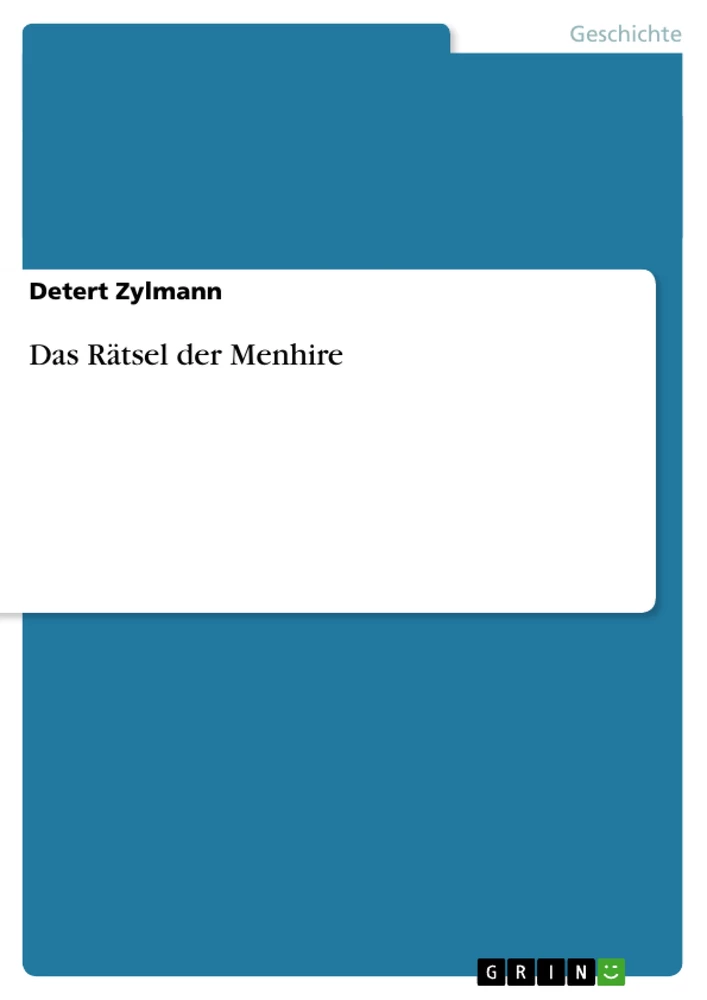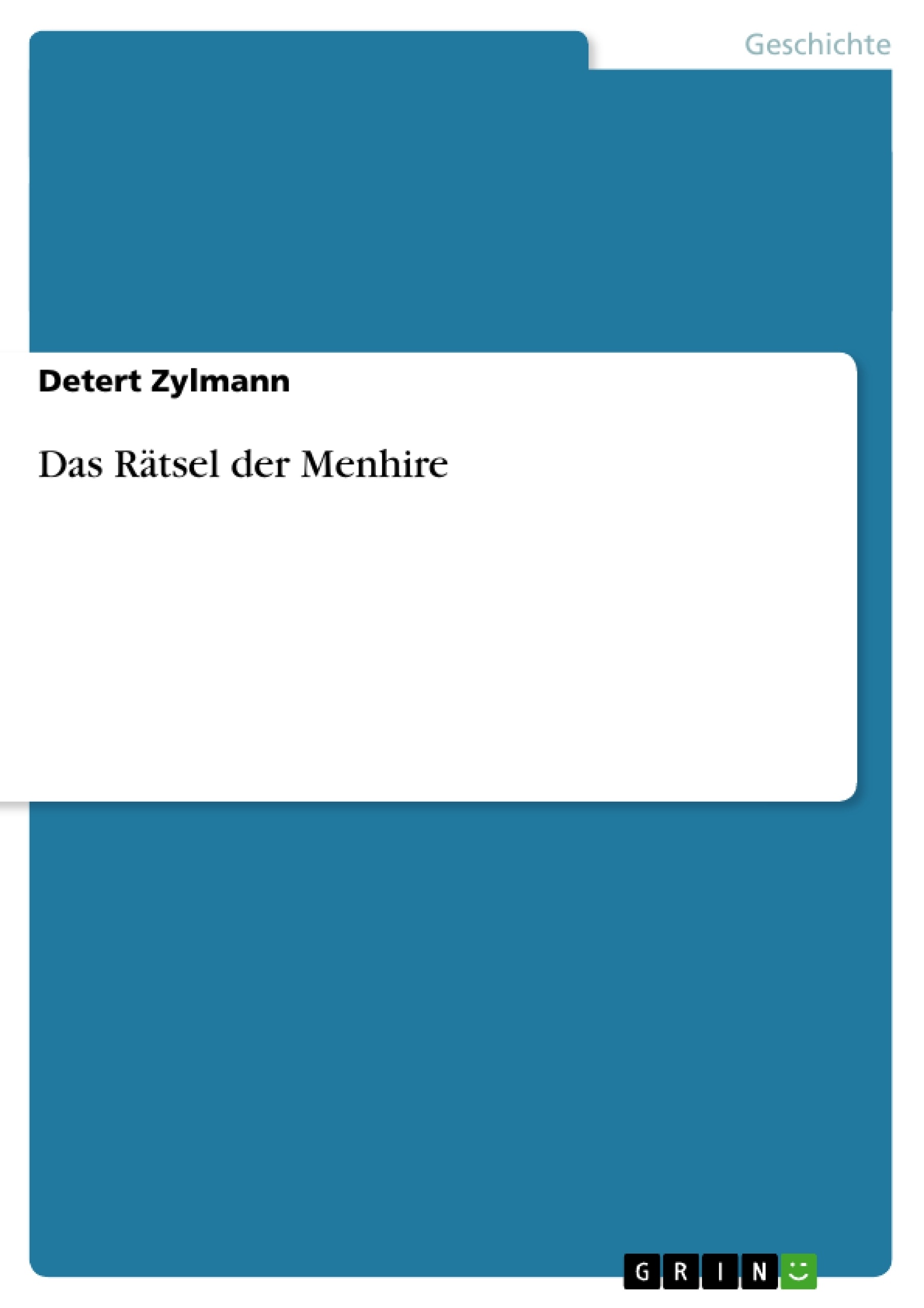Was hat die Menschen der jüngeren Steinzeit ab Mitte des 5. Jahrtausends v.Chr. bewogen, tonnenschwere und bis zu 21 Meter hohe Steinmale, die Menhire oder „Hinkelsteine“, zu errichten? Wie schaffte man es, diese Kolosse zu transportieren und aufzustellen? Welchen Zweck hatten die meistens freistehend, einzeln, in Kreisen oder manchmal sogar zu Tausenden in Reihen angeordneten Kolosse? Mit solchen Fragen befasst sich der Mainzer Archäologe Dr. Detert Zylmann in seinem Buch „Das Rätsel der Menhire“.
Obwohl Wissenschaftler sie sorgfältig untersuchten und mancherlei Fantasten glaubten, das Rätsel um diese Steine gelöst zu haben, blieben die Menhire bis heute von Geheimnissen umwittert. Unbestritten ist nur, dass sie eine kultisch-religiöse Funktion hatten. Vielleicht dienten diese eindrucksvollen Steinmale einst als Götteridole, phallische Kultdenkmäler, Opferpfähle, Gerichtsstätten, Ahnenkultmale, Ruhesitze für umherschwebende Seelen oder als „Ersatzleiber“ Verstorbener, an denen die Hinterbliebenen Abschied nehmen konnten.
Über Jahrtausende hinweg – von der Steinzeit bis in die Gegenwart – zogen Menhire immer wieder Menschen in ihren Bann. Einige der mysteriösen Steinmale konnten sich angeblich zu hohen Feiertagen drehen oder sie gaben Weh- und Klagelaute von sich, wenn jemand sein Ohr an sie legte. Von anderen erhofften sich Abergläubische durch ihre Berührung einen segensreichen Einfluss auf die Liebe und den Kindersegen oder die Heilung von Krankheiten.
Menhire hat man zu unterschiedlichen Zeiten in Europa, Asien, Afrika und Amerika aufgestellt. Besonders eindrucksvoll wirken die Menhir-Alleen von Ménec, Kermario und Kerlescan im französischen Departement Morbihan auf Betrachter. In Deutschland können die letzten steinernen Zeugen eines unbekannten prähistorischen Kultes in Baden-Württemberg, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern bewundert werden.
Der Archäologe Detert Zylmann wurde 1944 in Hamburg geboren. Nach dem Studium der Vor- und Frühgeschichte, Ethnologie und Anthropologie in Hamburg und Mainz promovierte er 1980 in Mainz. Nach zweijähriger Tätigkeit am Institut für Denkmalpflege in Hannover, Dezernat Inventarisation, übernahm er 1983 die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters bei der Archäologischen Denkmalpflege Mainz. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorbemerkungen
- 2. Was ist ein Menhir?
- 3. Das archäologische Umfeld
- 4. Megalithische Steinmonumente
- 5. Die Gewinnung des Baumaterials
- 6. Der Transport der Steine
- 7. Das Aufrichten der Steine
- 8. Deutungsversuche
- 9. Menhire in Glauben und Brauchtum
- 10. Menhire in Legenden, Märchen und Sagen
- 11. Menhire als Orte der Kraft?
- 12. Menhire und Comic
- 13. Megalithe und Menhire in der Bildenden Kunst
- 14. Datierung der Menhire
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Phänomen der Menhire. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte dieser steinernen Monumente zu beleuchten, von ihrer Definition und archäologischen Einordnung bis hin zu den Deutungsversuchen und ihrer Rolle in Glauben, Brauchtum und Kunst. Die Grenzen zwischen wissenschaftlicher Archäologie und esoterischen Interpretationen werden dabei kritisch untersucht.
- Definition und Verbreitung von Menhiren
- Archäologisches Umfeld und Megalithkultur
- Gewinnung, Transport und Aufrichtung der Steine
- Deutungsversuche und ihre wissenschaftliche Fundiertheit
- Menhire in Kultur, Glauben und Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorbemerkungen: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und betont die Faszination und das anhaltende Interesse an Menhiren. Es thematisiert die Schwierigkeiten bei der Deutung dieser Monumente und warnt vor überzogenen Spekulationen und ideologischer Instrumentalisierung, wie sie im Dritten Reich stattfand. Der Fokus liegt auf einer sachlichen Betrachtung und der Aufdeckung des geschichtlichen Informationswertes dieser Kulturdenkmäler.
2. Was ist ein Menhir?: Der Begriff „Menhir“ wird etymologisch erklärt und seine verschiedenen volkstümlichen Bezeichnungen werden vorgestellt. Die Anordnung, Form, Größe und Material der Menhire werden beschrieben, wobei der Menhir von Kerloas und der „Grand Menhir Brisé“ als Beispiele für außergewöhnliche Exemplare dienen. Die bevorzugte Lage der Menhire in der Landschaft wird ebenfalls diskutiert, und Flurnamen als Indikatoren für verlorengegangene Menhire werden erwähnt. Der „Lange Stein“ von Einselthum wird als Beispiel für eine alte urkundliche Erwähnung vorgestellt.
3. Das archäologische Umfeld: Dieses Kapitel stellt den Zusammenhang von Menhiren mit anderen Megalithbauten wie Großsteingräbern, Steinreihen und Megalithtempeln her. Es wird die Megalithkultur als Sammelbegriff für verschiedene Kulturgruppen definiert und die Diskussion um ihren Ursprung und ihre Verbreitung behandelt. Die Jungsteinzeit (Neolithikum) als Epoche der Megalithkultur wird erläutert, wobei die „Neolithische Revolution“ und ihre Auswirkungen auf Lebensweise, Technik und religiöse Vorstellungen thematisiert werden.
4. Megalithische Steinmonumente: Dieser Abschnitt beschreibt verschiedene Arten megalithischer Steinmonumente, insbesondere Großsteingräber, Steinsetzungen und Megalithtempel. Die Konstruktionsprinzipien der Großsteingräber werden erklärt, und ihr kultureller Kontext im Zusammenhang mit der Trichterbecherkultur wird dargestellt. Stonehenge und die Steinalleen von Carnac werden als herausragende Beispiele für megalithische Anlagen ausführlich beschrieben.
5. Die Gewinnung des Baumaterials: Die Gewinnung des Baumaterials für megalithische Monumente wird untersucht. Es werden die Methoden der Steingewinnung beschrieben, wobei die Rolle von Feuer und Wasser sowie die Verwendung von Werkzeugen aus organischem Material hervorgehoben werden. Die experimentelle Archäologie wird als Methode zur Überprüfung von Theorien über die steinzeitlichen Techniken eingeführt und anhand von Beispielen wie den Versuchen von A. H. Pitt-Rivers erläutert. Die enorme Arbeitsleistung, die zum Bearbeiten und Polieren großer Steine erforderlich war, wird am Beispiel ägyptischer Obelisken und Stonehenge verdeutlicht.
6. Der Transport der Steine: Dieses Kapitel behandelt den Transport schwerer Steine in vorgeschichtlicher Zeit. Es wird die Entwicklung der Hypothesen über den Transport von der Vorstellung riesiger Kräfte bis hin zu experimentellen Nachweisen mit einfachen Mitteln diskutiert. Der Transport einer Alabasterstatue im Alten Ägypten dient als Beispiel für die Organisation und das Wissen, das für den Transport schwerer Steine erforderlich war. Der Transport der Steine für Stonehenge wird ausführlich beschrieben, wobei verschiedene Transportwege und die logistischen Herausforderungen beleuchtet werden.
7. Das Aufrichten der Steine: Das Aufrichten von Megalithen wird behandelt. Es werden verschiedene Methoden wie Rampen, Gruben und Gerüste diskutiert, und anhand von Experimenten auf der Osterinsel und mit Modellen von Stonehenge werden die Verfahren veranschaulicht. Die enorme Organisation und das Wissen, das zum Aufrichten schwerer Steine erforderlich war, werden hervorgehoben.
8. Deutungsversuche: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Deutungsversuche für die Funktion der Menhire. Es wird betont, dass es keine einheitliche Deutung gibt und dass viele Deutungen spekulativer Natur sind. Es werden verschiedene Theorien wie kultisch-religiöse Funktionen, Totengedenkmäler, Gerichtsstätten oder astronomische Zwecke diskutiert.
9. Menhire in Glauben und Brauchtum: Die Rolle der Menhire im Glauben und Brauchtum wird erläutert. Die Verfolgung des Steinkults durch die christliche Kirche und die Versuche, die Menhire durch „Christianisierung“ in den christlichen Glauben zu integrieren, werden beschrieben. Der Bezug zu Masseben im Alten Testament und ihre unterschiedliche Bewertung in verschiedenen religiösen Epochen wird hergestellt. Beispiele für die Integration von Menhiren in den christlichen Glauben werden gegeben. Es wird der fortbestehende Glaube an die magischen Kräfte der Menhire bis in die heutige Zeit dargestellt.
10. Menhire in Legenden, Märchen und Sagen: Dieses Kapitel behandelt Legenden und Sagen im Zusammenhang mit Menhiren. Die Diskussion der mündlichen Überlieferung und ihrer zeitlichen Reichweite wird angesprochen. Verschiedene Sagen werden vorgestellt: Versteinerungssagen, Sagen von Menhiren als Wurfgeschosse und Sagen, die Menhire mit Schätzen oder übernatürlichen Kräften verbinden.
11. Menhire als Orte der Kraft?: Die esoterische Deutung von Menhiren als Kraftorte wird behandelt. Es wird die Geomantie als esoterische Lehre erklärt und die Vorstellung von Erdenergien und Kraftlinien im Zusammenhang mit der Platzierung von Menhiren dargestellt. Der kritische Umgang mit solchen esoterischen Interpretationen wird betont, und die Unterschiede zwischen wissenschaftlicher Archäologie und esoterischen Ansätzen werden herausgestellt.
12. Menhire und Comic: Die Darstellung von Menhiren im Comic, insbesondere in den Asterix-Geschichten, wird analysiert. Die Figur Obelix und seine Rolle als Menhirproduzent werden diskutiert, wobei die Mischung von historischen Fakten und künstlerischer Freiheit im Comic hervorgehoben wird. Die didaktische Möglichkeit des Comics zur Vermittlung von Geschichtswissen wird betrachtet.
13. Megalithe und Menhire in der Bildenden Kunst: Die Darstellung von Megalithen und Menhiren in der bildenden Kunst wird untersucht. Die Entwicklung der künstlerischen Auseinandersetzung mit diesen Monumenten vom Mittelalter bis zur Gegenwart wird beschrieben, wobei ausgewählte Künstler wie William Andrews Nesfield, Caspar David Friedrich, John Constable, Henry Moore, Barbara Hepworth, Chihiro Shimotani, und Joseph Beuys vorgestellt werden. Die Rolle von Megalithen in der Land Art von Richard Long wird erläutert.
14. Datierung der Menhire: Die Datierung der Menhire und die Schwierigkeiten dabei werden behandelt. Die Fehlinterpretation der Verbindung von Menhiren mit den Kelten wird korrigiert. Die meisten Menhire stammen aus dem späten Neolithikum, aber eine genaue Datierung ist oft schwierig aufgrund des Mangels an eindeutigen Begleitfunden. Beispiele für Datierungen von Menhiren werden gegeben, wobei die Unsicherheiten bei der zeitlichen Einordnung betont werden.
Schlüsselwörter
Menhire, Megalithkultur, Jungsteinzeit, Bronzezeit, Archäologie, Ethnologie, Religionsgeschichte, Volksglaube, Experimentelle Archäologie, Kunstgeschichte, Datierung, Stonehenge, Carnac.
Häufig gestellte Fragen (FAQs): Menhire - Ein umfassender Überblick
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über Menhire, von ihrer Definition und archäologischen Einordnung bis hin zu ihrer Rolle in Glauben, Brauchtum und Kunst. Er behandelt Themen wie die Gewinnung und den Transport der Steine, Deutungsversuche, die Darstellung in Legenden und der bildenden Kunst sowie die Datierung dieser steinernen Monumente. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Was sind Menhire?
Der Text erklärt den Begriff „Menhir“ etymologisch und beschreibt verschiedene volkstümliche Bezeichnungen. Er beschreibt ihre Anordnung, Form, Größe und das verwendete Material, wobei Beispiele wie der Menhir von Kerloas und der „Grand Menhir Brisé“ genannt werden. Die bevorzugte Lage in der Landschaft und die Bedeutung von Flurnamen als Indikatoren für verlorengegangene Menhire werden ebenfalls behandelt.
Welches archäologische Umfeld umgibt Menhire?
Der Text stellt den Zusammenhang von Menhiren mit anderen Megalithbauten wie Großsteingräbern, Steinreihen und Megalithtempeln her. Die Megalithkultur wird als Sammelbegriff für verschiedene Kulturgruppen definiert, und der Ursprung und die Verbreitung dieser Kultur werden diskutiert. Die Jungsteinzeit (Neolithikum) als Epoche der Megalithkultur wird erläutert, inklusive der „Neolithischen Revolution“ und ihren Auswirkungen.
Wie wurden Menhire hergestellt und transportiert?
Der Text beschreibt die Methoden der Steingewinnung, den Transport schwerer Steine in vorgeschichtlicher Zeit und das Aufrichten der Megalithen. Er beleuchtet die verwendeten Techniken, die logistischen Herausforderungen und die enorme Arbeitsleistung, die für die Bearbeitung, den Transport und das Aufrichten der Steine notwendig war. Experimentelle Archäologie wird als Methode zur Überprüfung von Theorien vorgestellt.
Welche Deutungen gibt es für die Funktion von Menhiren?
Der Text behandelt verschiedene Deutungsversuche, von kultisch-religiösen Funktionen über Totengedenkmäler und Gerichtsstätten bis hin zu astronomischen Zwecken. Es wird betont, dass es keine einheitliche Deutung gibt und viele Deutungen spekulativer Natur sind. Die kritische Auseinandersetzung mit esoterischen Interpretationen wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielten Menhire in Glauben, Brauchtum, Legenden und Kunst?
Der Text erläutert die Rolle der Menhire im Glauben und Brauchtum, die Verfolgung des Steinkults durch die christliche Kirche und den fortbestehenden Glauben an magische Kräfte. Legenden und Sagen im Zusammenhang mit Menhiren werden vorgestellt. Die Darstellung von Menhiren im Comic und in der bildenden Kunst wird analysiert, wobei verschiedene Künstler und ihre Werke genannt werden.
Wie werden Menhire datiert?
Der Text behandelt die Datierung von Menhiren und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Die Fehlinterpretation der Verbindung mit den Kelten wird korrigiert. Es wird betont, dass die meisten Menhire aus dem späten Neolithikum stammen, eine genaue Datierung aber oft schwierig ist.
- Quote paper
- Detert Zylmann (Author), 2003, Das Rätsel der Menhire, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92304