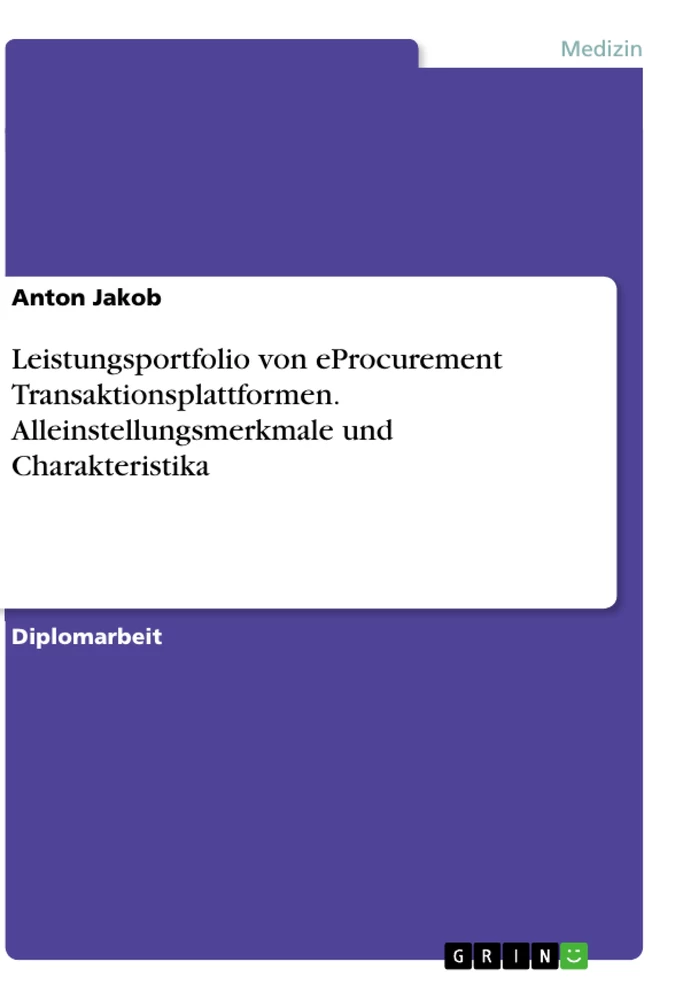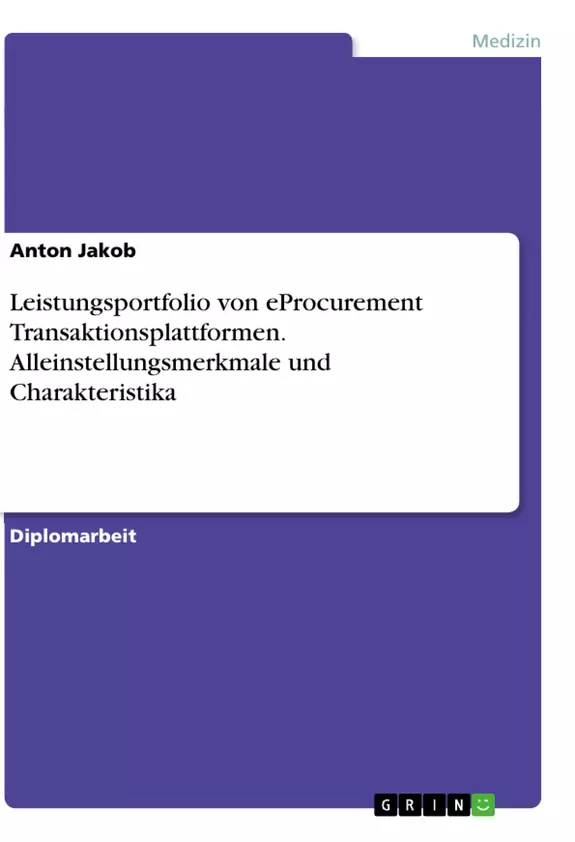In dieser Arbeit werden die Leistungsportfolios der größten Transaktionsplattformen im deutschen Gesundheitswesen - Global Healthcare Exchange (GHX), Gesellschaft für Standardprozesse im Gesundheitswesen (GSG), Health Business Solutions (HBS) und Medical Columbus (MC) - dargestellt und kritisch analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die untersuchten Dienstleister der Transaktionsplattformen zwar eine geringe Differenzierung im Kerngeschäft aufweisen, jedoch einige erhebliche Unterschiede in der Abwicklung von Geschäftsprozessen, Datenmanagement, technischen Aspekten und nicht zuletzt auch Kosten zu beobachten sind.
Die Ausweitung zur Internetnutzung ermöglicht es, immer mehr Krankenhäusern und ihren Lieferanten, ihre Beschaffungs- und Absatzaktivitäten elektronisch durchzuführen. Die gesamte Supply Chain von den Lieferanten über die Logistiker bis zu den Krankenhäusern wird dadurch effizienter gestaltet und kann durch die resultierende Transparenz bedarfsgerecht gesteuert werden. Gerade der Erfolg des eProcurement, mit enormen Potentialen zur Reduktion der Bestellabwicklungskosten, hat gezeigt, dass es bezüglich der absoluten Transaktionskosten ungünstig ist, mit jedem einzelnen Geschäftspartner eine eigenständige Vereinbarung hinsichtlich der eBusiness-Nutzung zu treffen. Derzeit verfolgen fast alle Geschäftspartner im Gesundheitswesen eine Strategie, bei der sie den Provider einer Transaktionsplattform als einen zusätzlichen
Intermediär akzeptieren. Die bestehenden Transaktionsplattformen orientieren sich stark an den individuellen Bedürfnissen der Gesundheitsbranche und versuchen, sich als ein unverzichtbares Informations- und Transaktionsmedium zu etablieren. Über unterschiedliche Schnittstellen der Transaktionsplattformen können die Teilnehmer mit unterschiedlichen Materialwirtschaftssystemen auf bestimmte Funktionen, wie z.B. Beschaffung (Procurement), Absatz (Commerce) oder Mehrwertdienste (Value Added Services) zugreifen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz der Arbeit
- Grundlagen des Electronic Business im Gesundheitswesen
- Begriffszusammenhänge
- Ausprägungsformen
- Bedeutung
- Supply Chain Management im Gesundheitswesen
- Grundlagen
- Supply Chain Modelle
- SCOR (Supply Chain Operations Reference Modell)
- GSCF (Global Supply Chain Forum)
- Supply Chain Modell von eBusiness im Gesundheitswesen
- Voraussetzungen des Electronic Business
- Datengenauigkeit
- Prozessautomatisierung
- Datenübertragung und Integration
- Elektronische Marktplätze
- Grundlagen
- Formen Elektronischer Marktplätze
- Elektronische Marktplätze im Gesundheitswesen
- Bedeutung
- Entwicklung und Status Quo
- Die Rolle der Einkaufsgemeinschaften
- Kooperationstypen
- Beispiel: P.E.G.
- Ziel der Arbeit
- Methode
- Informationsrecherchen im Vorfeld
- Webseitenanalyse der Plattformbetreiber
- Forschungsmethode
- Auswahl des Erhebungsinstruments
- Entwicklung des Leitfadens
- Das Experteninterview
- Durchführung und Auswertung des Interviews
- Resultate
- Health Business Solutions
- Geschäftsmodell
- Produkte und Dienstleistungen
- Technische Aspekte
- Gesellschaft für Standardprozesse im Gesundheitswesen
- Geschäftsmodell
- Produkte und Dienstleistungen
- Technische Aspekte
- Global Healthcare Exchange
- Geschäftsmodell
- Produkte und Dienstleistungen
- Technische Aspekte
- Medical Columbus
- Geschäftsmodell
- Produkte und Dienstleistungen
- Technische Aspekte
- Diskussion
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
- Abwicklung von Geschäftsprozessen
- Datenmanagement
- Kosten
- Technische Aspekte
- „Neutralität“ der Transaktionsplattformanbieter
- Schlussfolgerung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Leistungsportfolios von eProcurement-Transaktionsplattformen im deutschen Gesundheitswesen. Sie zielt darauf ab, die Alleinstellungsmerkmale und Charakteristika dieser Plattformen zu analysieren, um so einen Überblick über die Funktionsweise und den Mehrwert, den sie für Krankenhäuser und ihre Lieferanten bieten, zu gewinnen.
- Analyse der Funktionsweise von eProcurement-Plattformen im Gesundheitswesen
- Vergleich der Leistungsportfolios der wichtigsten Anbieter im deutschen Markt
- Identifizierung von Alleinstellungsmerkmalen und Charakteristika der Plattformen
- Bewertung der Auswirkungen auf die Beschaffungsprozesse im Gesundheitswesen
- Beurteilung des Potenzials von eProcurement-Plattformen für die Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz der Arbeit und führt in die Thematik des Electronic Business im Gesundheitswesen ein. Sie definiert grundlegende Begriffszusammenhänge, beschreibt die Ausprägungsformen des eBusiness und beleuchtet die Bedeutung im Kontext des Gesundheitswesens. Des Weiteren werden die Grundlagen des Supply Chain Managements im Gesundheitswesen und die Bedeutung von eBusiness in diesem Kontext dargestellt.
Das zweite Kapitel beschreibt die Methodik der Diplomarbeit. Es geht auf die Informationsrecherchen im Vorfeld, die Webseitenanalyse der Plattformbetreiber und die Forschungsmethode ein. Besondere Aufmerksamkeit wird der Auswahl des Erhebungsinstruments, der Entwicklung des Leitfadens und der Durchführung sowie Auswertung der Experteninterviews gewidmet.
Die Resultate werden im dritten Kapitel zusammengefasst. Es werden die Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen sowie die technischen Aspekte der vier größten eProcurement-Plattformen im deutschen Gesundheitswesen - Health Business Solutions, Gesellschaft für Standardprozesse im Gesundheitswesen, Global Healthcare Exchange und Medical Columbus - detailliert vorgestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themenbereiche wie eProcurement, Transaktionsplattformen, Gesundheitswesen, Supply Chain Management, Beschaffungsprozesse, Geschäftsmodelle, Datenmanagement, technische Aspekte und Kosten. Der Fokus liegt auf den Alleinstellungsmerkmalen und Charakteristika der untersuchten Plattformen im Kontext der deutschen Gesundheitsbranche.
Häufig gestellte Fragen zu eProcurement im Gesundheitswesen
Was ist eProcurement im Krankenhaussektor?
eProcurement bezeichnet die elektronische Abwicklung von Beschaffungsprozessen zwischen Krankenhäusern und Lieferanten über digitale Plattformen.
Welche Vorteile bieten Transaktionsplattformen?
Sie reduzieren Bestellabwicklungskosten, erhöhen die Transparenz in der Supply Chain und automatisieren den Datenaustausch zwischen verschiedenen Materialwirtschaftssystemen.
Wer sind die führenden Anbieter in Deutschland?
Zu den größten Plattformen gehören Global Healthcare Exchange (GHX), GSG, Health Business Solutions (HBS) und Medical Columbus (MC).
Was sind die technischen Voraussetzungen für die Nutzung?
Erforderlich sind kompatible Schnittstellen, eine hohe Datengenauigkeit sowie die Integration der Plattform in das bestehende ERP- oder Materialwirtschaftssystem des Hauses.
Welche Rolle spielen Einkaufsgemeinschaften?
Einkaufsgemeinschaften (wie die P.E.G.) bündeln die Nachfrage von Krankenhäusern, um bessere Konditionen bei Lieferanten zu erzielen, und nutzen dafür oft eProcurement-Plattformen.
- Quote paper
- Dipl.-Kfm. (FH) Anton Jakob (Author), 2009, Leistungsportfolio von eProcurement Transaktionsplattformen. Alleinstellungsmerkmale und Charakteristika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922828