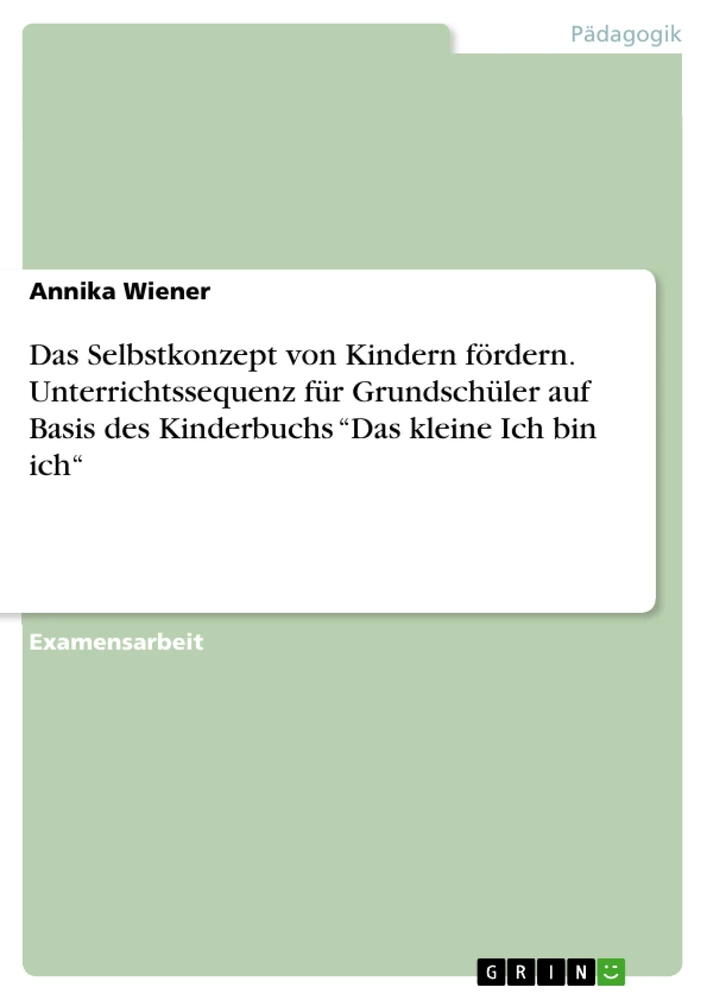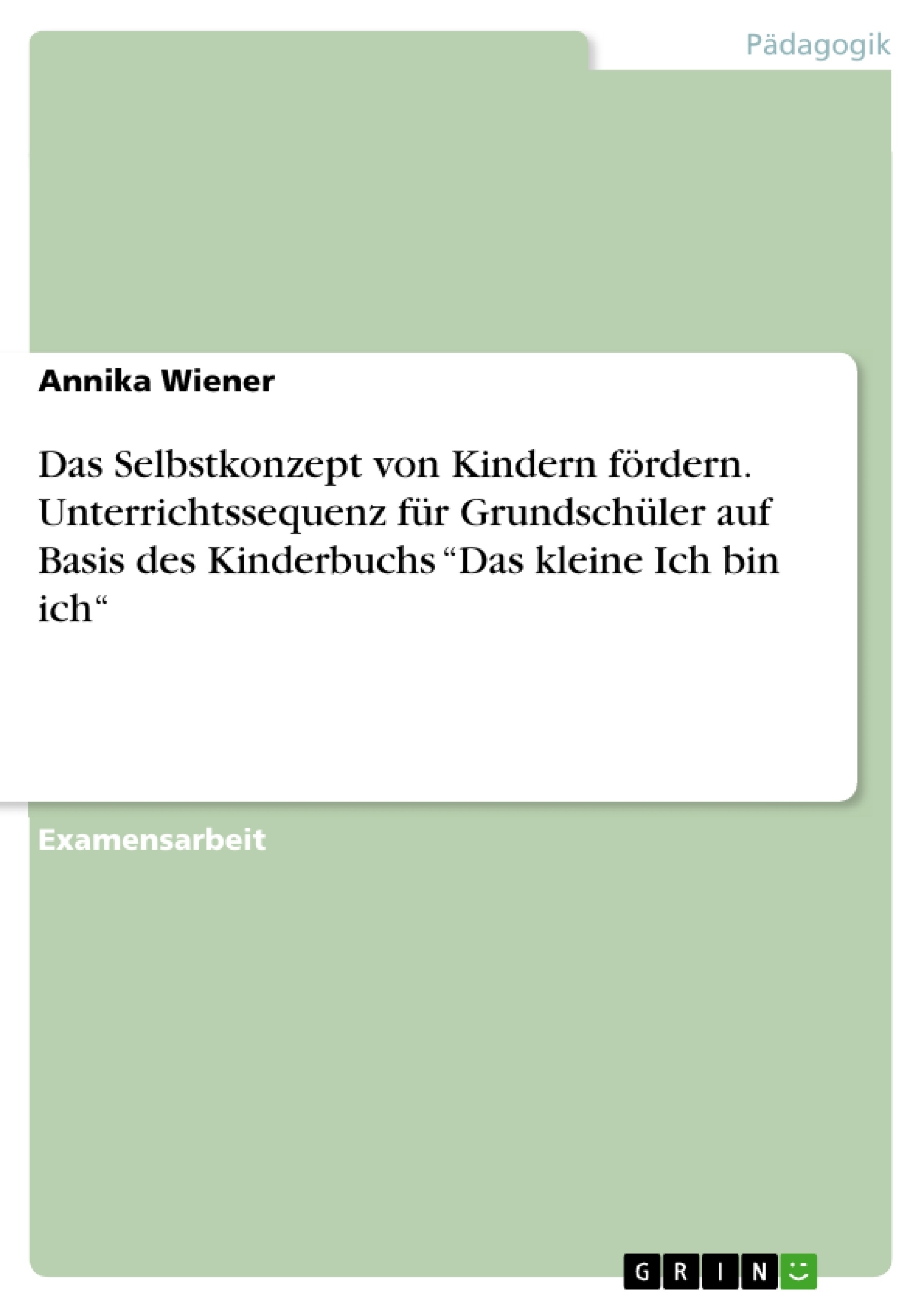Die Frage, die sich Lehrer oft stellen, ist, wie neben der Vermittlung von Kompetenzinhalten zusätzlich eine positive Identitätsentwicklung der Schüler angestoßen werden kann. Zudem muss entschieden werden, ob dies unterrichtsbegleitend über das Schuljahr hinweg und somit mehr spontan und nebenbei geschehen sollte oder ob man systematisch geplant und reflektiert, unter Schaffung geeigneter Lernsituationen, die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts unterstützen will. Mithilfe dieser Arbeit soll versucht werden, diesen Fragen eine Antwort zu geben.
Was genau unter dem Begriff des Selbstkonzepts zu verstehen ist und in welche Elemente es untergliedert werden kann, wird im Folgenden erläutert. Anschließend wird geklärt, wie sich das Selbstkonzept entwickelt, wodurch es beeinflusst wird und welche Bedingungen zur Entstehung eines positiven Konzepts wichtig sind. Dass das Selbstkonzept einige bedeutende Auswirkungen haben kann, die enormen Einfluss auf die Lebensgestaltung nehmen, wird daraufhin erläutert. Der Theorieteil schließt mit der knappen Beschreibung, ob und auf welche Weise das Selbstkonzept einer Person erfasst oder gemessen werden kann.
Es folgt der praktische Teil, der vorerst auf die ausgewählten Erhebungsverfahren eingeht und die Ergebnisse schildert. Infolge der Auswertung und der Betrachtung des amtlichen Lehrplans wird der Aufbau der Unterrichtssequenz grob skizziert und begründet. Daraus folgend werden Ziele genannt und die Auswahl der projektbasierenden Ganzschrift erläutert. Anschließend wird Einblick gegeben in den Ablauf der Sequenz. Die Arbeit schließt mit der Abschlussreflexion, die das Projekt und die Ergebnisse des zweiten Erhebungsverfahren rückblickend beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- A THEORETISCHE VORÜBERLEGUNGEN
- 1. Begriffsklärungen
- 1.1 Das Selbstkonzept im Allgemeinen
- 1.2 Das akademische Selbstkonzept
- 1.3 Das nicht-akademische Selbstkonzept
- 1.3.1 Das soziale Selbstkonzept
- 1.3.2 Das emotionale Selbstkonzept
- 1.3.3 Das physische/körperliche Selbstkonzept
- 2. Entwicklung des Selbstkonzepts
- 2.1 Entwicklung abhängig vom Alter der Kinder
- 2.2 Entwicklung ausgehend von gewonnenen Informationen
- 2.2.1 Fremdbeurteilung
- 2.2.2 Soziale Vergleiche
- 2.2.3 Selbstbeobachtung
- 2.2.4 Sinnessysteme
- 2.3 Bedingungen für Entstehung eines positiven Selbstkonzepts
- 2.3.1 Allgemeine Bedingungen
- 2.3.2 Einfluss des Lehrers auf das Selbstkonzept
- 3. Auswirkungen des Selbstkonzepts
- 3.1 Die "sich selbst erfüllende Prophezeiung"
- 3.2 Erlernte Hilflosigkeit
- 4. Erfassung des Selbstkonzepts
- B PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
- 1. Die Erhebungsverfahren und daraus gewonnene Erkenntnisse
- 1.1 Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klassen (FEESS 1-2)
- 1.1.1 Aufbau
- 1.1.2 Durchführung in der Klasse 1a
- 1.1.3 Ergebnisse
- 1.2 Informeller Fragebogen
- 1.2.1 Inhalt
- 1.2.2 Ergebnisse
- 2. Didaktisch methodische Vorüberlegungen
- 2.1 Amtlicher Lehrplan
- 2.2 Aufbau der Unterrichtssequenz
- 2.3 Ziele
- 2.4 Auswahl der Ganzschrift
- 3. Ablauf
- 3.1 Einführungsstunde
- 3.2 Lesen des Buchs in verteilten Rollen
- 3.3 Gestaltung des Ich-Buchs
- 3.3.1 Äußere Merkmale - Körperkonzept
- 3.3.2 Stärken und Schwächen - Fähigkeitsselbstkonzept
- 3.3.4 Teil einer Gemeinschaft - Soziales Selbstkonzept
- 3.4 Abschlussgottesdienst
- C REFLEXION UND SCHLUSSBEMERKUNG
- LITERATUR- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- ANHANG
- Entwicklung und Bedeutung des Selbstkonzepts
- Einfluss des Lehrers auf das Selbstkonzept
- Praktische Umsetzung der Förderung des Selbstkonzepts anhand der Ganzschrift „Das kleine Ich bin ich“
- Analyse der Ergebnisse und Reflexion der Umsetzung
- Bedeutung der Klassengemeinschaft für die Entwicklung des Selbstkonzepts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Förderung ausgewählter Elemente des Selbstkonzepts von Kindern anhand der Ganzschrift „Das kleine Ich bin ich“ in der Grundschule zu untersuchen. Im Fokus steht dabei die Entwicklung eines positiven Selbstbildes bei Grundschulkindern, insbesondere in Bezug auf ihre Fähigkeiten, sozialen Beziehungen und ihr körperliches Selbstverständnis.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Problematik eines negativen Selbstkonzepts bei Grundschulkindern. Es wird die Frage aufgeworfen, wie eine positive Identitätsentwicklung gefördert werden kann und welche Rolle die Lehrkraft dabei spielt.
Der theoretische Teil der Arbeit beleuchtet zunächst das Selbstkonzept im Allgemeinen, inklusive seiner verschiedenen Facetten und Entwicklungsphasen. Es werden zudem die Auswirkungen eines positiven und negativen Selbstkonzepts auf das Lernverhalten und die soziale Integration von Kindern behandelt.
Der praktische Teil der Arbeit beschreibt die konkrete Umsetzung der Förderung des Selbstkonzepts in der Grundschule. Hierbei wird die Erhebung des Selbstkonzepts mithilfe von Fragebögen und die Gestaltung einer Unterrichtssequenz basierend auf der Ganzschrift „Das kleine Ich bin ich“ vorgestellt.
Schlüsselwörter
Selbstkonzept, Grundschule, Ganzschrift, „Das kleine Ich bin ich“, Förderung, Entwicklung, Identität, Klassengemeinschaft, Lehrerrolle, Soziale Kompetenzen, Emotionales Selbstkonzept, Körperkonzept, Fähigkeitsselbstkonzept.
- Quote paper
- Annika Wiener (Author), 2018, Das Selbstkonzept von Kindern fördern. Unterrichtssequenz für Grundschüler auf Basis des Kinderbuchs “Das kleine Ich bin ich“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/921795